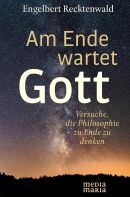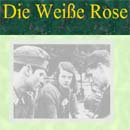zur katholischen Geisteswelt
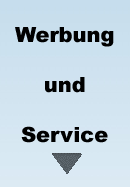
|
Zum
biographischen Bereich |
|
Zum englischen
und polnischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im philosophischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
liturgischen Bereich |
Themen
Atheismus
Atheisten
Atheist. Moral I
Atheist. Moral II
Aufklärung
Autonomie
Autonomiebuch
Biologismus
Entzauberung
Ethik
Euthanasie
Evolutionismus
Existenzphil.
Gender
Gewissen
Gewissen II
Glück
Glück und Wert
Gottesbeweis
Gottesglaube
Gotteshypothese
Handlung
Handlungsmotive
Das Heilige
Kultur
Kulturrelativismus
Langeweile
Liebe
Liebe II
Liebesethik
Menschenwürde
Metaethik
Methodenfrage
Moralillusion
Naturalismus
Naturrecht
Naturrecht II
Naturrecht III
Neurologismus
Opferidee
Philosophie
Proslogion
Relativismus
Sinnparadox
Sittengesetz
Sollen
Theodizee
Tierschutz
Verantwortung
Vernunftphil.
Vernunftrettung
Voluntarismus
Werte
Wirklichkeit
Von P. Engelbert Recktenwald
Wenn wir nach dem wesentlichen Unterschied zwischen Mensch und Tier fragen, stoßen wir in der Philosophie auf viele Antwortversuche. Einige verweisen z.B. auf das Sprachvermögen des Menschen, andere auf seine Fähigkeit, logisch und abstrakt zu denken. Am zutreffendsten ist in meinen Augen die Antwort von Immanuel Kant, sie ist aber zugleich auch eine der umstrittensten: Es ist die Moralfähigkeit des Menschen. Der Mensch ist “Subjekt einer moralisch-praktischen Vernunft” (MS AA VI 434). Dadurch ist er imstande, den höchstmöglichen Wert zu verwirklichen: jenen Wert des schlechthin Guten, der allein dem guten Willen eigen ist. Es ist diese sittliche Güte, wodurch der Wille, wie Kant einmal so schön formulierte, für sich selbst glänzt “wie ein Juwel” (GMS AA IV 394).
Der Christ ist durch die Offenbarung imstande, diesen Sachverhalt noch tiefer zu erfassen. Diese sittliche Güte ist die Heiligkeit, wodurch der Mensch Anteil gewinnt an der Heiligkeit Gottes. Er wird dadurch der Natur Gottes und des göttlichen Lebens teilhaftig. Er gewinnt die Würde eines Gotteskindes. Seine Würde ist eine Teilhabe an der Würde Gottes. Moralfähigkeit läuft auf Gottesfähigkeit hinaus.
Auch Immanuel Kant kennt Würde. Er spricht z.B. von der Würde, die die strengen Gesetze der Pflicht besitzen (GMS IV 425). Der Mensch seinerseits besitzt Würde aufgrund seiner Fähigkeit, aus Achtung vor dem Gesetz zu handeln und so Moralität zu verwirklichen.
Man kann nun beim Menschen eine zweifache Würde unterscheiden: Jene Würde, die der Mensch allein schon aufgrund seiner Moralfähigkeit besitzt, und die Würde aufgrund verwirklichter Moralität. Ich möchte die erste die ontologische, die zweite die sittliche Würde nennen.
Die ontologische Würde kann der Mensch, solange er lebt, nicht verlieren. Sie ist, wie das deutsche Grundgesetz sagt, unantastbar. Das bedeutet: Sie begründet einen unbedingten normativen Anspruch, der es verbietet, den Menschen jemals bloß als Mittel zum Zweck zu gebrauchen. Die Würde des Menschen ist stets und unter allen Umständen zu achten. Sie ist gleichzeitig der Ermöglichungsgrund der sittlichen Würde ihres Trägers, weil sie auch einen Imperativ an diesen enthält, nämlich seiner Würde entsprechend zu handeln und zu leben. Genau darin besteht Moralität. Diese bin ich sowohl der Würde des Anderen wie auch meiner eigenen Würde schuldig.
Sehr schön finden wir dies beim hl. Thomas von Aquin ausgedrückt. Er lehrt, dass der Mensch durch die Sünde von seiner Würde abfällt (“decidit a dignitate humana”, S. th. II-II, 64, 2, ad 3). Diese Würde gründet in seiner Freiheit und Selbstzwecklichkeit (“prout scilicet homo est naturaliter liber et propter seipsum existens”, ebd.). Die Willensfreiheit gehört zur Würde des Menschen (“libertas arbitrii ad dignitatem hominis pertinet”, S. th. I 59, 3, s.c.). Der Mensch hat die Herrschaft (dominium) über seine ... weiterlesen im Buch "Am Ende wartet Gott".
Recktenwald: Wiederverzauberung der Natur?
Die Person geht dem Sittengesetz voraus
In meiner 76. Podcastfolge geht es wieder philosophisch zu. Wie verhalten sich Person und Sittengesetz zueinander? Hier vertreten Immanuel Kant und Robert Spaemann gegensätzliche Positionen. Dabei gehe ich in meinen Überlegungen von dem Diktum des Philosophen Simon Blackburn aus: “Ein Liebhaber, der aus Pflichtgefühl heraus küsst, hat einen Tritt in den Hintern verdient.”
Philosophen
Anselm v. C.
Bacon Francis
Bolzano B.
Ebner F.
Geach P. T.
Geyser J.
Husserl E.
Kant Immanuel
Maritain J.
Müller Max
Nagel Thomas
Nida-Rümelin J.
Pieper Josef
Pinckaers S.
Sartre J.-P.
Spaemann R.
Spaemann II
Tugendhat E.
Wust Peter
Autoren
Bordat J.
Deutinger M.
Hildebrand D. v.
Lewis C. S.
Matlary J. H.
Novak M.
Pieper J.
Pfänder Al.
Recktenwald
Scheler M.
Schwarte J.
Seifert J.
Seubert Harald
Spaemann R.
Spieker M.
Swinburne R.
Switalski W.
Wald Berthold
Wust Peter