zur katholischen Geisteswelt
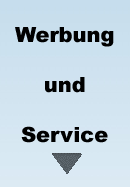
|
Zum Inhalts-
verzeichnis |
|
Zum
biographischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im liturgischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
philosophischen Bereich |
Themen
10 Jahre ED
Alte Messe
Böhm Dom.
Bundesblut
Complet
Ehrfurcht
Fortschritt
Freigabe
Gamber K.
Handkommunion
Herz Jesu-Fest
Juden
Kanon
Karfreitagsfürbitte
Kommunion
Korrektur
Korrektur II
Korrektur III
Liebe
Lumen fidei
Messopfer
Museumswärter
Opferung
Sacr. Caritatis
Sakralität
Saventhem E.
Schicksalsfrage
SP: Leitlinien
SP: Versöhnung
Stuflesser
Sühnopfer
Trad. custodes
Trad. custodes II
Trad. custodes III
Trad. custodes IV
Wandlungsworte
Wort u. Sakrament
Liturgische Erneuerung zwischen Hinführung zur Gestalt und deren Neuentwurf
Das Konservative und das Revolutionäre im Wirken von Theodor Schnitzler (1910–1982)
von P. Lic. Sven Conrad FSSP
I. Biographische Skizzen
Theodor Simon Schnitzler wurde am 1. April 1910 als Kind einer katholischen und wohlhabenden Kaufmannsfamilie in Düsseldorf geboren.
Nach dem Abitur am dortigen Hohenzollerngymnasium begann er zum Sommersemester 1928 sein philosophisch-theologisches Studium in Freiburg im Breisgau. Bereits im nächsten Semester wechselte er nach Rom, um als Alumne des Collegium Germanicum-Hungaricum an der Päpstlichen Universität Gregoriana zu studieren. Kardinal F. Marchetti-Selvaggiani er-teilte ihm am 28. Oktober 1934 in der Kollegskirche das Sakrament der Priesterweihe. Darauf folgt ein einsemestriges Studium an der Münchner Staatsbibliothek.
Ab 1936 war Schnitzler in der Seelsorge eingesetzt, dabei aber weiterhin akademisch tätig. Am 7. Juli 1936 wurde er zum Doktor der Theologie. promoviert. Thema seiner Dissertation war Im Kampf um Chalcedon. Geschichte des Codex Encyclius von 458. Der Kölner Erzbischof Josef Frings ernannte ihn am 4. Oktober 1943 zum Professor für Liturgik, Ritus und Rubrizistik am Priesterseminar seines Erzbistums in Bensberg. Mit diesem Fachbereich war Köln Vorreiter, denn Schnitzler wurde der erste Inhaber eines solchen Lehrstuhls in Deutschland.
Sehr bald schon wurde er auch als Berater für Fragen der Liturgie hinzugezogen. Am 11. August 1958 wurde Theodor Schnitzler von Papst Pius XII. zum Päpstlichen Hausprälaten ernannt. In der Folge war er sowohl bei der Vorbereitung des II. Vatikanischen Konzils als auch bei der Gestaltung der nachkonziliaren Liturgiereform federführend tätig. Im Einzelnen war er Konsultor der vorbereitenden Kommission des Konzils. Unter dem Relator Joseph Andreas Jungmann SJ war er Sekretär jener Unterkommission, die sich mit der Meßliturgie befaßte (vgl. Annibale Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975). Nuova edizione riveduta e arricchita di note e di supplementi per una lettura analistica, BELS 30, Roma 1997, 30). Sekretär der vorbereitenden Kommission war P. Annibale Bugnini CM. Interessant ist die Tatsache, daß weder Schnitzler noch Bugnini Periti des Konzils waren (Dies ist bei Reimund Haas im BBKL, dem ich hier im Wesentlichen folge, nicht vermerkt. Die Liste der offiziellen Konzilsberater in Fragen der Liturgie findet sich z. B. Annibael Bugnini, La riforma liturgica..., 906f.).
Ab dem 11. Mai 1964 [1] war Theodor Schnitzler Konsultor des Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, jenes Rates, dem unter dem Sekretär P. Annibale Bugnini CM durch Papst Paul VI. die Gesamtreform der römischen Liturgie anvertraut worden war.
Stark eingebunden war Schnitzler dabei in die Reformarbeiten am Ordo Missae. So fungierte er bei der experimentellen Vor-Zelebration der neuen Liturgie vom 20. Oktober 1965 in der Kapelle des Instituts Maria Bambina als Verantwortlicher für die Zeremonien (Bugnini, S. 161 f). Zudem gehörte er zu dem von Relator Johannes Wagner geführten Coetus X, jener Arbeitsgruppe, der die Reform des Ordo Missae übertragen war (Bugnini, S. 335).
Bugnini bezeugt, wie Papst Paul VI. eigene Desiderate für den Ordo Missae äußerte, was zu Reaktionen der Experten führte. Schnitzler gehörte in Folge dieses Konfliktes zu einer eigenen Unterkommission, der eine Lösung dieser Fragen aufgetragen war (Bugnini, S. 366 f).
Neben der Arbeit am Ordo Missae und den eucharistischen Hochgebeten (Bugnini, S. 445), gehörte Theodor Schnitzler auch zur von Bugnini selbst geleiteten Kommission der Reform der Päpstlichen Liturgie, der Cappella Papale (Bugnini, S. 779). Insbesondere war es Schnitzler, der den neuen Ritus der Kardinalskreation schuf (Bugnini, S. 788).
Ab dem Jahr 1964 kam die Arbeit an der Reform des Caeremoniale Episcoporum hinzu (Bugnini, S. 789), jenes liturgischen Buches, das hauptsächlich die bischöfliche Liturgie regelt. Nachdem diese Arbeit nach der Neufassung der Bestimmungen über den Gebrauch der Pontifikalien für einige Jahre ruhte, wurde Theodor Schnitzler 1971 Relator einer neuen für die Erstellung des Caeremoniale errichteten Kommission. Sekretär derselben war Piero Marini, der spätere Päpstliche Zeremonienmeister. Mitglieder waren außerdem Aimé Georges Martimort, Pierre Journel und der spätere Päpstliche Zeremoniar und Kardinal Virgilio Noè (Bugnini, S. 792). Mit diesem Caeremoniale, das erst 1984 approbiert wurde, wollte man die ansonsten sehr wortzentrierte neue Liturgie wieder stärker an zeremonielle Vollzüge rückbinden. Aber es erschien zu spät, da vieles an rituellem Verständnis bereits verloren war.
Theodor Schnitzler war im Zuge der Reform auch an der Auseinandersetzung um die geplante Instruktion zur Musica sacra beteiligt. Dabei gehörte er zu den Expertenvertretern der Liturgiewissenschaft (Bugnini, S. 867), die mit jenen von der liturgischen Musikwissenschaft her kommenden Experten um die Abfassung stritten.
Im Zuge der um die Konzilszeit aufblühenden Liturgiewissenschaft erhielt Schnitzler verschiedene Lehraufträge: am bischöflichen Priesterseminar von Essen-Werden (1962-1970), am Spätberufenen-Seminar von Lantershofen (1974-1981), am Katholisch-Theologischen Seminar der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (1980).
Theodor Schnitzler legte aber Wert darauf, nicht nur akademisch und als Berater kirchlicher Gremien tätig zu sein. Von 1960 bis 1977 war er Pfarrer von St. Aposteln in Köln. Von 1977 bis 1982 leitete er die Liturgieschule des Erzbistums Köln. 1980 wurde er Ehrendomherr am Hohen Dom.
Theodor Schnitzler verstarb am 29. August 1982 nach schwerer Krankheit in Meerbusch bei Düsseldorf. Er fand seine letzte Ruhestätte im Hochchor seiner Basilika St. Aposteln zu Köln.
II. Zum Hintergrund des Wirkens und der Methodik des Liturgikers Theodor Schnitzler
Um den Liturgietheologen und -historiker Theodor Schnitzler zu verstehen, müssen wir zunächst einen Blick auf jene Veröffentlichungen werfen, mit denen er eine große Breitenwirkung erzielt hat. Schnitzler hat zweimal einen umfassenden Kommentar zur Liturgie der römischen Messe vorgelegt, einmal in ihrer traditionellen Gestalt (Die Messe in der Betrachtung, 2 Bände, Freiburg 19574) und einmal in ihrer nachkonziliar-reformierten (Was die Messe bedeutet. Hilfen zur Mitfeier, Freiburg Basel Wien 19767).
Schnitzler möchte mit diesen Kommentaren bewußt an das Werk von Nikolaus Gihr anknüpfen, auf den er anerkennend verweist.
Was war das besondere Verdienst von Gihr? Kein geringerer als Joseph Andreas Jungmann SJ verweist in seinem Geleitwort zum ersten Meßkommentar Schnitzlers ebenfalls auf Gihr und würdigt dessen Fähigkeit, „das Ganze des Geheimnisses einzufangen und die religiöse Betrachtung, die erst seinen Reichtum fruchtbar macht, aufzubauen auf dem Vollbesitz der theologischen und historischen Erkenntnisse, die jeweils verfügbar waren“ (Die Messe in der Betrachtung I, S. XIV).
Als Schnitzler in Freiburg sein Studium begann, war die Erinnerung an den vier Jahre zuvor verstorbenen Subregens sicher noch lebendig. Gihrs Ansatz also war weiterzuverfolgen, das Ganze des Geheimnisses im Blick zu haben und den praktischen und innerlich-erfüllten Mitvollzug der hl. Liturgie im Sinne der Mahnung aus der Weiheliturgie: „Agnoscite quod agitis!“ zu ermöglichen. Dies alles sollte auf der Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Meßliturgie erfolgen.
Welche sind diese Erkenntnisse? Theodor Schnitzler ist zutiefst geprägt von den liturgiewissenschaftlichen Forschungen Joseph Andreas Jungmanns SJ. Er versteht sein eigenes Werk über die Messe als „fromme(n) Kommentar“ zu Jungmanns Arbeiten. Das bedeutet, daß man Schnitzler inhaltlich primär von Jungmann her verstehen muß und ohne diesen nicht verstehen kann.
Auf Jungmann kann in unserem Rahmen nicht eingegangen werden, und es wäre vermessen, das große Werk des Innsbrucker Jesuiten mit ein paar Zeilen zu würdigen. Dennoch muß erlaubt sein, zu nennen, daß die heutige Forschung neben den großen Verdiensten auch einige Schlagseiten kennt und nennt, mit denen er behaftet war. Beispielsweise ist hier die Verfallstheorie zu nennen (Vgl. Alcuin Reid, The Organic Developement of the Liturgy. The Principles of Liturgical Reform and their Relation to the Twentieth Century Liturgical Movement Prior to the Second Vatican Council, Saint Michael's Press Farnborough 2004, 151-159), also jene Annahme, daß die römische Liturgie nach ihrer Blütezeit mit Gregor dem Großen nur noch einem Verfallsprozeß unterlag. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch eine zu einseitige Sicht der Liturgie im Mittelalter, die Arnold Angendt kritisiert [2].
Jungmann ist nicht frei davon, Liturgieentwicklung als zum Teil historisch zufällig oder als über Brüche erfolgt zu sehen [3].
Diese geradezu schwärmerische Sicht der Messe in der römischen Antike durchzieht auch das Werk von Schnitzler: „Wir versetzen uns in eine römische Basilika alter Zeit Ein hoher Festtag wird gefeiert ...“ [4]
Bei aller Verehrung dem großen Vorbild gegenüber darf man Schnitzler aber keineswegs seine Eigenständigkeit absprechen. Jungmann selbst sagt über ihn: „Man braucht es ihm übrigens nicht zu glauben, was er auf der ersten Seite behauptet: als ob er nämlich bei keinem Ruderschlag den Blick von einer gewissen Uferlinie gelassen hätte. Nicht selten wagt er sich auf eigene Entdeckungsfahrten, und wenn auch nicht jede gleich erfolgreich ist – mehr als einmal entdeckt er neues Land, wie etwa in den herrlichen Betrachtungen zum Communicantes, wo auf einmal Bilder aus der Geheimen Offenbarung lebendig werden und zum Greifen naherücken, Bilder, die durchaus dem Literalsinn des Textes zugeschrieben werden können“ (Die Messe I, XVIf). Eigenständig ist sicher auch seine Methodologie, d.h. in diesem Zusammenhang die Frage, was er durch seine Arbeiten überhaupt zu vermitteln intendiert. Schnitzler selbst erklärt uns dabei seine Methodik, wenn er im Vorwort von „Was die Messe bedeutet“ schreibt:
„Diese Schrift darf sich nicht wissenschaftlich nennen, obwohl sie Wert darauf legt, auf Ergebnissen der Forschung und Wissenschaft aufgebaut zu sein. Eher möchte sie sich in Erinnerung an den allerersten Lehrer in der Philosophie Edmund Husserl phänomenologisch nennen – immer wieder fragend: Was ist das? Was bedeutet das? Woher kommt das? Was kann ich mir dabei denken? Was gibt mir das? Was kann ich darüber sagen? – Von daher kommt Kirchen- und Liturgiegeschichte als erste und wichtigste Antwortgeberin. Dabei geht es nicht so sehr um Datenwissen, sondern um die Schatzgräberarbeit, die zu Tage fördern soll, auf welchen Fundamenten unser heutiges gottesdienstliches Haus ruht. Hier ergibt sich oft die kleine Entdeckung, wie selbstverständlich das alles unseren Gewohnheiten, unserem Alltag entspricht“ (Was die Messe bedeutet, 7 f).
Ein solcher Beitrag wie der unsrige kann dem Leben und Wirken eines Theologen sicher nicht gerecht werden. Er kann aber sehr wohl aus heutiger Sicht Dinge akzentuieren und hervorheben, was auch mit Blick auf die Liturgiereform problematisch war, und zugleich aufzeigen, was als Schnitzlers bleibendes Verdienst bezeichnet werden muß. Dabei beschränken wir uns weitgehend auf Fragen der Meßliturgie.
III. Problematisches
1. Zum Verhältnis von Musica sacra und Liturgie
Eine wichtige grundsätzliche Kontroverse im Zusammenhang mit der Liturgiereform entzündete sich im Vorfeld der am 5. März 1967 durch die Hl. Ritenkongregation erlassenen Instruktion „Musicam sacram“.
Hier ging es nicht um Detailfragen und Randprobleme, sondern um wichtige liturgische Prinzipien. Annibale Bugnini beschreibt in seinen Erinnerungen das Zustandekommen dieser Instruktion als „Via dolorosa“, denn sie war hart umkämpft (Annibale Bugnini, La riforma liturgica, 866. vgl. zum Entstehen der Instruktion aus der Sicht Bugninis auch 865-880). Es gab insgesamt 12 Schemata zur Vorbereitung! Die Fachleute der liturgischen Musica sacra beklagten damals, daß sie bislang, ja sogar zur bisherigen Vorbereitung dieses Dokumentes, bei sämtlichen Entscheidungen über die Liturgiereform nicht zu Rate gezogen waren, und das, obwohl die Musica sacra eine zentrale Stelle im Liturgieverständnis des II. Vaticanums einnimmt (Bugnini, La riforma liturgica 866).
Daraufhin wurde jene bereits oben erwähnte Kommission zur Vorbereitung der Instruktion gebildet, die zur Hälfte aus Liturgikern wie Schnitzler und zur Hälfte aus Experten des Bereichs der liturgischen Musica sacra bestand. Dabei ist – einem Mißverständnis vorgreifend – zu betonen, daß letztere ebenfalls liturgische Experten waren, wenn sie auch bei Bugnini immer reduzierend als „musicisti“ bezeichnet werden. Auf Seiten dieser Fachleute befand sich federführend ein anderer Kölner, Prälat Prof. Dr. Johannes Overath. Um die Tragweite des bisherigen Vorgehens von Seiten des Consiliums zu erahnen, die sog. „Musiker“ außen vorzulassen: Overath war im Gegensatz zu Bugnini und Schnitzler Peritus des II. Vatikanischen Konzils und an der Abfassung von Sacrosanctum Concilium beteiligt.
Paul VI. war persönlich besorgt über die Entwicklung. Schon mit Chirograph vom 22. November 1963 hatte er die Consociatio Internationalis Musicae Sacrae kanonisch errichtet und Prälat Overath zu deren ersten Präsidenten ernannt. Diese Insitution wurde u.a. deshalb geschaffen, damit „es beim Apostolischen Stuhl eine internationale Einrichtung geben sollte, durch die sich dieser über die Bedürfnisse der Musica Sacra unterrichten ließe und die für die Umsetzung der die Musica Sacra betreffenden Beschlüsse der höchsten kirchlichen Autorität sorgen sollte“ (Handschriftliche Päpstliche Urkunde, zitiert nach Musica Spiritus Sancti Numine Sacra. Beiträge zur Theologie der Musica Sacra aus den Publikationen der Consociatio Internationalis Musicae Sacrae (Romae), ed. Gabriel Maria Steinschulte, Città del Vaticano 2001, 125). Der Papst bezieht sich dabei auch ausdrücklich auf die Behandlung der Musica Sacra durch das II. Vaticanum.
Von Seiten der Experten aus dem Bereich Liturgie und Musik wurde nun in bezug auf die ersten Entwürfe der geplanten Instruktion mit Recht bemängelt, daß das Consilium der Musica sacra nur eine dienende Funktion in der Liturgie zuweisen wollte.
Die Vertreter der Liturgik setzten den Schwerpunkt auf eine als pastoral ausgewiesene Vorentscheidung, die a priori der Idee eines liturgischen Chores und der Polyphonie ablehnend gegenüberstand. Dies spiegelt sich z. B. in der Bewertung der Vorschläge der Musiker durch Bugnini: „riflettevano vecchie concezioni della musica sacra, rifacendosi di preferenza all‘ opera delle cappelle musicali, alle esecuzioni polifoniche e concertistiche, proposte come ideal.“ (Bugnini, La riforma 868) und stand in direktem Gegensatz zu Sacrosanctum Concilium. Dort heißt es: “Die überlieferte Musik der Gesamtkirche stellt einen Reichtum von unschätzbarem Wert dar, ausgezeichnet unter allen übrigen künstlerischen Ausdrucksformen vor allem deshalb, weil sie als der mit dem Wort verbundene gottesdienstliche Gesang einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht. In der Tat haben sowohl die Heilige Schrift 42 wie die heiligen Väter den gottesdienstlichen Gesängen hohes Lob gespendet; desgleichen die römischen Päpste, die in der neueren Zeit im Gefolge des heiligen Pius X. die dienende Aufgabe der Kirchenmusik im Gottesdienst mit größerer Eindringlichkeit herausgestellt haben. So wird denn die Kirchenmusik um so heiliger sein, je enger sie mit der liturgischen Handlung verbunden ist, sei es, daß sie das Gebet inniger zum Ausdruck bringt oder die Einmütigkeit fördert, sei es, daß sie die heiligen Riten mit größerer Feierlichkeit umgibt, Dabei billigt die Kirche alle Formen wahrer Kunst, welche die erforderlichen Eigenschaften besitzen, und läßt sie zur Liturgie zu. Unter Wahrung der Richtlinien und Vorschriften der kirchlichen Tradition und Ordnung sowie im Hinblick auf das Ziel der Kirchenmusik, nämlich die Ehre Gottes und die Heiligung der Gläubigen, verfügt das Heilige Konzil das Folgende” (SC 112) und: “Die Kirche betrachtet den Gregorianischen Choral als den der römischen Liturgie eigenen Gesang; demgemäß soll er in ihren liturgischen Handlungen, wenn im übrigen die gleichen Voraussetzungen gegeben sind, den ersten Platz einnehmen. Andere Arten der Kirchenmusik, besonders die Mehrstimmigkeit, werden für die Feier der Liturgie keineswegs ausgeschlossen, wenn sie dem Geist der Liturgie im Sinne von Art. 30 entsprechen” (SC 116).
Im Prinzip ging die Auseinandersetzung schon damals um die korrekte Interpretation der seit Pius X. vom Lehramt geforderten „participatio actuosa“ (vgl. SC 14) der Gläubigen. Bugnini selbst charakterisiert diese Auseinandersetzung aus seiner Sicht: „Für die Liturgiker ist es wichtig, daß die Gläubigen wirklich singen, um die aktive Teilnahme zu verwirklichen, die von der Liturgiekonstitution gewünscht ist, für die Musiker hingegen begünstigt auch ,das Hören guter, frommer und erbaulicher Musik die tätige Teilnahme“ („per il iturgisti è necessario che i fedeli cantino veramente per realizzare la partecipazione attiva, auspicata dalla Costituzione liturgica; per i musicisti, invece, anche ,il sentire buona, pia, e edificante musica favorisce la partecipazione ,actuosa‘“, Bugnini, La riforma 870). Ein solches Prinzip, wie Bugnini es fordert, würde neben der Polyphonie auch jede gehobene Sprache ausschließen.
Tatsächlich erkennt Bugnini die Brisanz der aufgeworfenen Fragen und sieht in ihnen Angriffe auf die „grundlegenden Prinzipien, auf denen sich die Liturgiereform gründet” („i principi basilari su cui si fonda la riforma liturgica“, Bugnini, La riforma 871).
Wir können hier nicht auf die ganze Auseinandersetzung und ihren Verlauf eingehen. Sicher aber muß man bei den Liturgikern, zu denen Schnitzler gehörte, eine fehlerhafte, auf das aktive Element reduzierte Sicht der Idee „tätiger Teilnahme“ feststellen, eine problematische Sicht mit großen Konsequenzen. In diesen Zusammenhang gehört auch die Problematik, wie sich Landessprache und Musica sacra zueinander verhalten.
Bei dieser Auseinandersetzung stehen wir am Herz der Liturgie; Fehler in diesem Bereich haben Probleme zur Folge, an denen die neue Form des römischen Ritus bis heute leidet.
Im Verständnis von Theodor Schnitzler hat denn auch tatsächlich die gesungene Liturgie nicht jene Stellung, die ihr gebührt, nämlich eine normierende. Auch die einfachste Form ist ihm per se, in sich selbst, noch Gesang: „Weil die Messe ein Fest ist, gehört zu ihr das Singen, überhaupt die Musik. Deshalb empfinden wir das Hochamt mit dem Gregorianischen Choral, mit Chor und Orchester als die höchste Formentfaltung. Die nur gesprochen vorgetragene Lesung entspricht weniger dem Festcharakter der Messe als die gesungene Lesung. Das Bündnis zwischen Messe uns Musik ist untrennbar, manchmal aber auch beschwerlich. Ein unfähiger oder ein zu großartiger oder ein verweltlichter Kirchenmusiker kann die heilige Festfreude verwirren, verwässern, verderben. Auch ohne Musik bleibt die Messe ein einziges Singen. Ihre Psalmen sind Lieder, ihre Präfation ist ein Hochgesang. Ihr Halleluia und ihr Amen sind singende Rufe, ihre Texte stecken voll Rhythmus und Reim. In der stillsten Privatform der Messe kann man sich noch die Frage stellen: ,Was ist dir, meine Seele, daß du singst?‘ Das Schweigen wird manchmal zum frohesten Lied.“ (Schnitzler, Was die Messe bedeutet, 21).
Hier ist aber der Unterschied zwischen Text und Gesang nicht nachvollziehbar. Richtiger müßte man sagen, daß auch die einfachste Form zumindest inspiriert von der hohen Gesangsform gefeiert werden müßte. Die Texte sind nicht per se schon Gesang, als ob dieser als schmückendes Beiwerk nur noch dazu käme und seine Ausführung gegenüber dem reinen Lesen des Textes für die Liturgie unwesentlich wäre.
Dies mögen zum besseren Verständnis einige Zeilen von Leo Cardinal Scheffczyk erhellen, der angesichts der Erfahrungen der Nachkonzilszeit die Musica sacra bezeichnet als „jenes wesentliche Medium ..., welches das Heilsmysterium in seiner aszendenten Bewegung zum Lobpreis und zur Verherrlichung Gottes, sozusagen unter Mitnahme des ganzen sinnenhaften Menschen, vollenden hilft.“ [5] Dann führt er weiter aus: „Sie (sc. die Kirchenmusik) ist dazu so sehr geeignet, daß R. Graber dazu sagen kann: ,Die musica sacra eröffnet uns sonst verschlossene Türen; sie ermöglicht uns den tieferen Einstieg in die Welt des Mysteriums und läßt uns die Glaubenswahrheit erleben, viel stärker und intensiver, als selbst der gläubige Verstand es kann‘ (R. Graber, Musica sacra – musica profana, Regensburg 1975, 10.), ein kühnes Wort, das aber wohl seine Berechtigung hat, zumal auf dem Hintergrund unserer Zeit und einer doch weithin einseitigen Auffassung von der Liturgie. Diese erscheint heute einseitig auf das Wort abgestellt, das in seiner Rationalität, in seiner intellektuellen Klarheit erhellend, klärend, belehrend wirken soll. Wozu das in der Praxis oft geführt hat, wird durch die volkstümliche Bezeichnung der sog. ,sermonitis‘ treffend karikiert. Obwohl sich hinter einer solchen Rationalisierung des Wortes auch schon ein Irrtum verbirgt, so bietet sich doch hier auf dem Hintergrund unserer Zeitsituation der ,musica sacra‘ eine neue Möglichkeit an, dadurch, daß sie die seelische Tiefenschichten des Menschen anspricht und diesen anruft, sich auf das Transzendente hin zu öffnen, sich dem Mysterium entgegenzuheben” (a. a. O.).
In diesem Sinne scheint bei Schnitzler die innere Rückbindung, die der liturgische Text zum Gesang hat, nicht berücksichtigt. Er stellt beispielsweise den Introitus, der ein Gesangs ist, qualitativ so gut wie in eine Linie und auf dieselbe Ebene wie den Eingangsvers im neuen Missale, für den es nie eine gesangliche Fassung gab noch geben wird: „Der lateinische Introitus, das deutsche Eingangslied, der psalmodisch gestaltete Einzugsgesang, der gesprochene Einzugsvers stehen hier fast gleichberechtigt nebeneinander.“ [6]
Schnitzler bemerkt nicht, wie in diesem Punkt die Liturgiereform entgegen dem Konzil die prinzipielle Bindung an die gesungene Liturgie aufgibt, und zwar indem sie Texte kreiert, die niemals zum Gesang gedacht sind. Dies alles weist darauf hin, daß Theodor Schnitzler zumindest in diesem Bereich wesentliche traditionelle Strukturfragen unberücksichtigt ließ.
2. Reformbegriff und Strukturfragen
Was wir bisher im Bereich der Musica sacra in Bezug auf die innere Struktur der Liturgie sagten, ist von nicht geringer Bedeutung, insofern die Liturgiekonstitution des II. Vaticanums gerade Strukturfragen und Fragen liturgischer Gesetzmäßigkeiten per se eine große Bedeutung zumißt, wenn sie beispielsweise feststellt:
„Darüber hinaus sind sowohl die allgemeinen Gestalt- und Sinngesetze der Liturgie zu beachten als auch die Erfahrungen, die aus der jüngsten Liturgiereform und den weithin schon gewährten Indulten gewonnen wurden. Schließlich sollen keine Neuerungen eingeführt werden, es sei denn, ein wirklicher und sicher zu erhoffender Nutzen der Kirche verlange es. Dabei ist Sorge zu tragen, daß die neuen Formen aus den schon bestehenden gewissermaßen organisch herauswachsen” (SC 23).
Gewisse Strukturfragen beachtet Schnitzler kaum. Dies soll am Beispiel der Einzugsriten kurz dargestellt werden. In seinem Frühwerk über die Messe beschreibt er die alten römischen Einzugsriten in ihrer Geschichte und stellt dazu korrekt fest:
„Der ursprüngliche Zustand beim basilikalen Gottesdienst Roms war, daß der Papst aus dem Secretarium, das in der Nähe des Eingangs lag, mit seinem Klerus zum Altar schritt, während der Sängerchor die Einzugsprozession mit dem Introitusgesang begleitete” (Schnitzler, Die Messe II, 32).
Das Entstehen des Stufengebetes begründet er dann allein (!) mit dem fränkischen Stilgesetz, das Handlungen ein Begleitwort des Priesters beifügt. Unberücksichtigt bleibt, daß bereits der Ordo Romanus I. ein Verweilen und Beten des Zelebranten am Altar beim Einzug bezeugt. So stellt auch Rupert Berger deutlich den Charakter des Stufengebetes heraus als „das frühere Rüstgebet des Zelebranten und seiner Assistenz an den Stufen des Altares. ... Ansatzpunkt seiner Entwicklung war das stille Gebet, das der Papst nach dem Einzug vor dem Altar verrichtete. Es nahm allmählich die Gestalt formulierter Sündenbekenntnisse an. ... Fränkischer Brauch ließ während des Ganges zum Altar den Psalm 43 ... sprechen, der schließlich gleichfalls an die Altarstufen verlegt und mit dem Confiteor zum Stufengebet verbunden wurde” (“Stufengebet” in Rupert Berger, Pastoralliturgisches Handlexikon, Freiburg Basel Wien, Sonderausgabe 2005 in 20084, 491). Somit hat das Staffelgebet seine Wurzeln nicht nur in dem fränkischen Prinzip, sondern in einem bereits in den Frühzeugnissen der Liturgie Roms nachweisbaren rituellen Akt.
Schnitzler schaut nicht auf die Struktur, die das Hochamt vorgibt, sondern erklärt das Staffelgebet als ein Wechselgebet zwischen Priester und Gemeinde (vgl. z.B. Schnitzler, Die Messe II, 39). Damit ist er geprägt von der volksliturgischen Ausrichtung der Liturgischen Bewegung, die zuweilen den Charakter des Stufengebetes in ein solches Wechselgebet veränderte (vgl. den Hinweis von Berger zu dieser Praxis; vgl. auch Schnitzler, Die Messe II, 32). Wenn er in seiner nachkonziliaren Erklärung der Liturgie den neuen Bußakt erklärt, kommt er merkwürdigerweise plötzlich auf die alte Prostratio der päpstlichen Messe als sein „Urahn“ zu sprechen, die er beim Stufengebet unerwähnt ließ, eine Feststellung, die aber gerade hier sehr fraglich ist, denn die frühe römische Liturgie kannte nicht das, was heute der gemeinschaftliche Bußakt ist (Schnitzler, Was die Messe bedeutet, 64).
Bei der ganzen Behandlung der Einzugsriten, Stufengebet (alter Form), Bußakt (neuer Form), Einzugsprozession und Introitus, unterläßt es Schnitzler, nach den eigentlich von der Struktur her vorgegebenen Handlungsträgern des jeweiligen rituellen Vollzugs zu fragen. Dies ist der Kern des Problems. Schnitzler schreibt in seiner inhaltlichen Erschließung fast alles univok allen zu (vgl. Schnitzler, Die Messe II, 34f). Um es nochmals deutlich zu sagen: So beginnt für ihn bereits in der alten Form die Messe mit dem Kreuzzeichen und dem Bekenntnis zur Trinität, was er allen Mitfeiernden inhaltlich erschließt. Er sieht nicht, daß hier vom Prinzip eigentlich nur der Zelebrant und seine Assistenz Träger der Handlung sind und die Gläubigen währenddessen den Introitus hören oder ihn (oder ein Lied) singen, also gar nicht auf dieses „In nomine Patris...“ hin, sondern auf den Gesang orientiert sind, der sie in die Meßfeier einstimmen soll.
Unverständlich bleibt, wie Schnitzler dann noch den Introitus als zu den großen Einzugsakten gehörig beurteilen kann (Schnitzler, Die Messe II,6). Und tatsächlich, statt zu einem lebendigen Verständnis, einem mitvollzogenen Verständnis des Introitus vorbehaltlos (!) hinzuführen, hat er Probleme, diesen uralten Einzugsritus der römischen Liturgie einzuordnen (auch wenn er schöne Gedanken dazu findet): „Immerhin bleibt der Introitus auch jetzt noch ein Chorlied, bei dem das Volk zum Schweigen verurteilt ist. Es wäre des ,Schweißes der Edlen wert‘, nach Formen zu sinnen, die es gestatteten, das Volk mit einzubeziehen. Könnte man nicht einen sehr schlichten Vers sehr einfach vertonen, den das Volk als seinen Ruf in den Introitusgesang einstreuen würde, etwa ein Zu dir erheb‘ ich meine Seele oder ein Introibo ad Altare Dei, wie man es für die deutsche Gemeinschaftsmesse beim Katholikentag 1956 so erfolgreich getan hat?“ (Schnitzler, Die Messe II,6. Diese Lösung war beim Katholikentag aber nicht als liturgisches Prinzip gedacht, sondern aufgrund der akustischen Gegebenheiten des Stadions erforderlich.)
Solche Überlegungen der Hinführung zur Liturgie bringen ihn selbst dann zur Forderung nach Umgestaltung, nach Änderung der traditionellen Gestalt in Teilbereichen. So schreibt er: „Die vielen kleinen Texte zwischen Confiteor und Introitus werden im Hochamt völlig überlagert von Gesängen des Chores. Sie werden dort abgewertet zu einem oft kaum noch verständlichen Gemurmel. In der Privatmesse des Priesters wird ihr Vollzug erschwert durch Hast und Eile, die nicht nur die geistige Sinnerfülltheit, sondern sogar die sinnvolle äußere Form der Worte gefährden. Dagegen werden in der sogenannten erweiterten Gemeinschafsmesse diese laut und feierlich gemeinsam rezitierten oder vorgebeteten Texte mit einem so großen Gewicht bedacht, daß sie sogar den Introitus an Feierlichkeit übertreffen. Eine etwaige künftige Meßreform wird sicherlich bei diesen Texten Hand anlegen dürfen. Dennoch dürfen wir auch bei diesen Texten besinnlich innehalten; auch sie sind ja Ausdruck dessen, was die Kirche beim Hinschreiten zum Altare empfindet und was sie unseren Gedanken und Empfindungen nahelegt. Mögen die vorliegenden Texte auch im Zusammenhang des Ganzen einen geringeren Wert haben, für sich genommen enthalten sie manch köstliche Schönheit. Ein Vergleich kommt uns in den Sinn: Da hat ein Künstler der Spätgotik in einer alten Basilika einen aufwendigen Altaraufsatz komponiert; der verständige Restaurator wird vielleicht gezwungen sein, dieses Retabel wegzunehmen, doch die Kostbarkeit der einzelnen Figuren muß ihn bestimmen, sie an anderer Stelle liebevoll zu erhalten und vielleicht noch besser zur Geltung zu bringen.“ (Schnitzler, Die Messe II,44)
Dem Leser mit einem gewissen Abstand zur Liturgiereform kommt ein Zitat eines anderen Autors in den Sinn. Joseph Kardinal Ratzinger hat seinerzeit auch einen Vergleich zur Kunst gezogen: Er vergleicht dabei die Liturgie mit einem Fresko. Dieses Fresko war vor der liturgischen Bewegung „zwar unversehrt bewahrt, aber von einer späteren Übertünchung fast verdeckt. ... Im Meßbuch, nach dem der Priester sie feierte, war ihre von den Ursprüngen her gewachsene Gestalt ganz gegenwärtig, aber für die Gläubigen war sie weithin unter privaten Gebetsanleitungen und -formen verborgen. Durch die Liturgische Bewegung und definitiv durch das II. Vatikanische Konzil wurde das Fresko freigelegt, und einen Augenblick waren wir fasziniert von der Schönheit seiner Farben und Figuren. Inzwischen ist es durch klimatische Bedingungen wie auch durch mancherlei Restaurationen oder Rekonstruktionen gefährdet und droht zerstört zu werden, wenn nicht schnell das Nötige getan wird, um diesen schädlichen Einflüssen Einhalt zu gebieten. Natürlich darf es nicht wieder übertüncht werden, aber eine neue Ehrfurcht im Umgang damit, ein neues Verstehen seiner Aussage und seiner Wirklichkeit ist geboten, damit nicht die Wiederentdeckung zur ersten Stufe des definitiven Verlustes wird.“ (Joseph Kardinal Ratzinger, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, Freiburg Basel Wien 2000, 7f.).
Es ist also ein Fragezeichen zu setzen, inwieweit die Arbeit der Restauratoren nicht doch geschadet hat. Die Eingangsriten – um bei ihnen zu bleiben – wurden auch stark verändert. Wenig überzeugend – wenn auch bei manchem inhaltlich schönen Gedanken – ist die Art und Weise, wie Schnitzler die Eröffnungsriten der jetzigen forma ordinaria präsentiert. Hier wird eine Form verteidigt, die aus päpstlichem Willen so ist, wie sie nun ist. Schnitzler bezeugt:
„Papst Paul VI. kommt nach Bogotá in Kolumbien zum Eucharistischen Kongreß. Er feiert eine heilige Messe mit dem ganz einfachen Volk des Landes. Es ist des Lesens und Schreibens unkundig, hat keine hohe religiöse Schulung und kennt keine geschliffene Liturgie. Aber das Volk ist sich der Anwesenheit des Nachfolgers Petri bewußt. Die Herzen öffnen sich von der Freude, mit dem Papst die heilige Messe zu feiern. Nun dringt die Stimme des zelebrierenden Oberhirten durch die Lautsprecher. Als die ersten Silben bekannter Worte vernehmbar werden, wissen sie sofort Bescheid. Sie fallen ein und sprechen in lautem Chor mit dem Heiligen Vater: 'Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.' Südamerika und Rom vereinen sich im Bekenntnis der Dreifaltigkeit am Beginn der Messe. Seit Jahrhunderten begann so die Feier der Messe. Doch nur der Priester sprach die Worte. Sie lagen unter der Hülle der Introitusgesänge. Dann übte die Gemeinschaftsmesse ein paar Jahrzehnte den Brauch eines vernehmlichen und gemeinsamen Sprechens des Stufengebetes, aber diese Sitte gehörte nicht der Weltkirche. Nun wird in Kolumbien das neue Missale Romanum ins Leben gerufen. Noch sind die Verhandlungen über seine Form und Gestalt nicht beendet. Da entscheidet sich in Bogotá: Die heilige Messe kann nicht anders beginnen als mit dem einfachsten Gebet, das es gibt, nicht anders als mit dem Kreuzzeichen. Denn der Papst ist überwältigt und mitgerissen vom Chor des Volkes in Kolumbien“ (Schnitzler, Was die Messe bedeutet ..., 47).
Diese Erklärung hat den Geschmack des Sentimentalen. Der Introitus wird abgewertet; das Geschick einer sehr differenzierenden römischen Liturgie liegt in der Gunst des Augenblicks einer Papstreise.
Heute wird die in der Schaffung des Bußaktes erfolgte Umordnung der Struktur in ihrer Problematik von verschiedenen Seiten erkannt, vgl. z.B. Studien und Entwürfe zur Meßfeier. Texte der Studienkommission für die Meßliturgie und das Meßbuch, ed. Eduard Nagel (in Verbindung mit Roland Bachleitner, Winfried Bachler, Rupert Berger, Thomas Egloff, Angelus Häußling, Martin Klöckener, Irmgard Pahl, Anton Pomella, Heinrich Rennings †, Emile Seiler), Freiburg Basel Wien 1995, 263f.
Und Schnitzler selbst weist dann darauf hin, daß die Messe eigentlich längst vor dem Kreuzzeichen begonnen hat: „Die Messe begann ...“ (Schnitzler, Was die Messe bedeutet ..., 57-63)
Manchmal hat man den Eindruck, Schnitzler versuche, Änderungen wider besseres Wissen zu verteidigen und ihnen einen Wert abzugewinnen. Dies zeigt sich etwa in seiner Behandlung der Abschaffung der traditionellen Kanonstille, die er nach Einführung des um der Verständlichkeit willen lauten Kanons unverständlicherweise immer noch in der Möglichkeit des „Abschaltens“ gegeben sieht. Er sagt: „Lautes Sprechen des Kanons bedeutet nicht, man müsse ihn mitsprechen. Verstehbarkeit der Worte verlangt nicht, man müsse sie Laut für Laut anhören. Man darf ,abschalten‘. Man kann sich in sein eigenes Gespräch mit Gott vertiefen. Das gelingt nun noch besser als einst, da das Sanctuslied den ersten Teil des Kanons überdeckte, oder als gar noch nach der Wandlung gesungen wurde. Ob die Kanonstille bleibt, ist dem einzelnen Beter überlassen. Die Worte des Zelebranten sollten nicht übermächtig durch die Kirche klingen; so werden sie den stillen Beter nicht hindern, sondern eher durch diesen oder jenen vernommenen Satz führen und anregen“ (Theodor Schnitzler, Der Römische Meßkanon. In Betrachtung, Verkündigung und Gebet, Freiburg Basel Wien 1968, 19). In diesem Punkt zeigt sich auch sein Traditionsverständnis über Brüche: „Laut sangen die Märtyrerbischöfe der Frühzeit das Eucharistiegebet vor ihrer Gemeinde, und Mitbrüdern und Gläubigen prägte sich der Text des dem Tode nahen Bischofs so kraftvoll ein, daß sie die Worte in die Jahrhunderte mitnahmen. Achthundert Jahre später wird der große Lobgesang ein Stillgebet. Wie ein Lettner richtet sich das Schweigen um den Kanon auf, um ihn ehrfürchtig zu bergen und zu hüten. Nun schlägt diese Entwicklung wieder um. Der Kanon wird wieder vernehmlich. Der Lettner wird abgebaut. ... Wir sind also wieder bei den Anfängen angekommen. Unsere Messe ist der Messe der Märtyrer ähnlicher geworden. Sind nicht auch die Zeitläufe den Ursprüngen näher?“ (Der Römisch Meßkanon, 20 f).
Einige Jahrzehnte später wird eine Studienkommission feststellen: Der volkssprachliche, laute Vollzug der bestehenden Hochgebet ist für die Teilnehmer ermüdend und läßt gerade den Höhepunkt der gesamten Feier zu einem emotionalen Tiefpunkt werden“ (Studien und Entwürfe zur Meßfeier, 263).
3. Einfluß des Zeitgeistes der 60er und 70er Jahre
Aus dem Werk Theodor Schnitzlers spricht bisweilen der Zeitgeist der 1960er und 70er Jahre. Während „Die Messe in der Betrachtung“ im Sinn einer inhaltlichen Hinführung (vgl. Wechselwirkung von Gehalt und Gestalt) noch mit einem ausführlichen Blick auf die Bundestheologie beginnt, so ist der Ansatz in „Was die Messe bedeutet“ ein modifizierter, wobei die Bundestheologie durchaus integriert bleibt.
Allerdings ist Schnitzler bei den Erklärungen, die man charakterisieren könnte mit „Was die Messe nicht ist“, nicht ganz frei von allzu schnellen Vorurteilen im Kontext der Zeit. Standesgemäßes Zeremoniell, bei dem etwa herausragenden politischen Personen eine Rolle im Ordo des Ganzen zukommt, wird pauschalierend abgetan:
„Missa sollemnis von Ludwig van Beethoven, Kathedrale einer europäischen Hauptstadt, Zelebrant Seine Exzellenz der Hochwürdigste Herr, in eigenen Sesseln der Herr Ministerpräsident mit Gattin, Vertreter des Parlaments, der Presse usw. Da sind peinliche Ähnlichkeiten mit einer Vorstellung, mit einem religiösen Drama, mit der Oper. Aber so etwas ist doch sehr, sehr selten geworden“ (Was die Messe bedeutet, 17).
Diese Äußerung ist leider rein polemischer Natur. Die Missa sollemnis von Beethoven war nie für die Liturgie gedacht (vgl. “Bachs h-moll-Messe und Beethovens Missa sollemnis sprengen mit ihrem Umfang den Rahmen der Liturgie (Konzertaufführung).” Ulrich Michels, dtv-Atlas Musik. Systematischer Teil. Musikgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2008, 129). Es ist zudem keineswegs zwingend, daß solche polyphonen Meßfeiern im Sinne eines Staatsaktes per se veräußerlicht sind, unser Autor stellt es aber so dar. Man könnte hierin auch noch einen letzten Schatten einer christlich-abendländischen Gesellschaft sehen, die ein Ganzes bildete. Man denke etwa an jenes bewegende Photo aus dem Jahr 1962, das Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer auf zwei Thronsesseln in der Vierung der Kathedrale von Reims bei einem Pontifikalamt zur Besiegelung der Deutsch-Französischen Freundschaft zeigt, ein historisches Ereignis, geschichtsmächtig und Ausdruck des Glaubens im Lauf der Geschichte zugleich (vgl. dazu den Bericht in französischer Sprache).
Vielleicht spiegelt sich auch noch in seinem Beispiel der Missa sollemnis in Gegenwart des Ministerpräsidenten die nachkonziliare Kontroverse um die wahre tätige Teilnahme.
Allerdings hat seine Versammlungstheorie, die er strukturell der Messe auferlegt, durchaus merkwürdigen Charakter. Dabei sei keineswegs der wichtige Charakter der Liturgie als kirchlicher Versammlung im Sinne der Ekklesía geleugnet (Vgl. dazu «Versammlung» in Rupert Berger, Pastoralliturgisches Handlexikon, Freiburg Basel Wien, Sonderausgabe 2005 in 20084, 533).
Bei Schnitzler hingegen nimmt es gekünstelte und säkularisierte Züge an, wenn er schreibt:
„Aus verschiedenen Anlässen werden Versammlungen gehalten. Sie haben immer ein und dieselbe Form. Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung. Er begrüßt die Anwesenden. Das Protokoll der letzten Versammlung wird verlesen; dabei wird festgestellt, welche Beschlüsse nicht durchgeführt wurden. Der Vorsitzende mahnt in einer Art Grundsatzerklärung zur Treue gegenüber den Zielen der Gemeinschaft. Dann verkündet er das Programm der gegenwärtigen Versammlung. Es beginnen die Beratungen. Einer liest vor, was eine Kommission überlegt und vorgeschlagen hat. Man diskutiert darüber und stellt das Wichtigste heraus. Ein zweiter Vorschlag wird verlesen. Auch er wird beraten und besprochen. Den dritten Vorschlag haben vielleicht die Vorsteher selbst ausgedacht und lassen ihn verkünden. Nun erhebt sich der Vorsitzende, um alle Vorschläge zu erläutern und der Versammlung nahezulegen. In einem großen Beschlußakt werden schließlich die Vorschläge angenommen und bekräftigt. Sie werden ausdrücklich für den ganzen Verein bestimmt.“
Dies überträgt Schnitzler auf die Messe:
„(Introitus)
Eröffnung: Im Namen des Vaters ...
Begrüßung: Der Herr sei ...
Besinnung auf das Frühere: Bußakt
Grundsatzerklärung: Kyrie, Gloria = Christus, Herr
Programm: Oration (Herr, du bist heute in den Himmel aufgefahren, laß auch uns mit Sinn und Herz im Himmel wohnen...)
1. Lesung
Antwortgesang
2. Lesung
Antwortgesang
3. Lesung: Evangelium
Darlegung: Homelie
Beschluß: Credo
Allgemeingültigmachung: Fürbitten.“ [7]
IV. Bleibendes Verdienst
Wenn wir nun auf einige auch vom Prinzip her problematische Punkte im Schaffen von Theodor Schnitzler verwiesen haben, so darf doch nicht der Eindruck entstehen, als würden die Nachgeborenen undifferenziert über eine schwierige Zeit zu Gericht sitzen und alles verurteilen.
Manches in der nachkonziliaren Entwicklung hat Schnitzler selbst sehr negativ gesehen. Er verurteilt „den Irrtum jener, die unter allen Umständen nur die Messe im kleinen Kreis und im Speisesaal und am normalen Tisch und inmitten noch nicht abgeräumter Teller begehen wollen“ (Was die Messe bedeutet, 27). Schnitzler betont das Opfer und auch die Tradition. Hier kann man seinen verzweifelten Kampf gegen die damalige Geisteshaltung erahnen, die jede Konvention im Geist der 1968er über Bord werfen wollte:
„Die heilige Messe wird schon in alter Zeit sacra traditio genannt. Grund- und Urgestein des katholischen Gottesdienstes ist Überlieferung-Tradition. ... Auch unsere Lebensformen, unsere Zivilisation und Kultur sind von Vorgegebenheiten erfüllt. Der Geistliche löst sich um der modernen Zeit willen von der traditionellen Kleidung der Klerisei. Er legt eine Krawatte an. Der Gute ahnt nicht, daß er das kroatische (hrvadska) Halstuch des österreichischen Militärs des 17. Jahrhunderts anlegt. Warum trägt man Manschettenknöpfe? Warum gebraucht man ein Taschentuch? Warum nimmt man das Essen in solchen und solchen Formen? Bei jedem einzelnen Stück unserer Zivilisation leben wir in Traditionen. Verlassen wir die eine, steigen wir in eine andere hinein. … Weshalb also nimmt man gegen die Tradition der Messe einen nutzlosen Kampf auf?“ (Was die Messe bedeutet, 39).
Der Liturgiehistoriker und -theologe Theodor Schnitzler hat uns in vielen Punkten die heilige Liturgie erschlossen und schöne Zugänge von bleibender Bedeutung geschenkt. Oft verweist er auf die Hl. Schrift; so erklärt er z.B. sehr schön die Bundestheologie der Messe anhand von Gen 15, 9-18.62.
Einmal Erkanntes vertritt er auch über die Reform hinweg. Obwohl er auch auf das Vater Unser als Tischgebet / Kommunionvorbereitung eingeht, stellt er dennoch fest, was sich aus der durch Gregor den Großen herbeigeführten Stellung des Gebets ergibt: „Das Paternoster hat Hochgebetscharakter“ (Was die Messe bedeutet, 32).
Wenn Schnitzler uns Bleibendes geschenkt hat, dann betrifft dies nicht nur Einzelfragen, wie sie sich etwa in Jungmanns Lob über die Darstellung des Communicantes bei Schnitzler zeigt.
Es betrifft vielmehr auch die Erinnerung an das wichtige Prinzip, daß die hl. Liturgie verinnerlicht werden muß. Das Prinzip der „Schatzgräberarbeit“ von Theodor Schnitzler weist uns den Weg zu einer theologia cordis, die zu vermitteln ihm ein Herzensanliegen war. Als er im Jahr 1976 sein Vorwort zur Meßerklärung verfaßte, mußte er beklagen, daß die Theologie „so vernünftig, so verstandesmäßig geworden ist“. Er fühlt sich „Eisheiligen“ ausgesetzt und betont: „In deren Mitte sehnt man sich nach der alten ,theologia cordis‘, der Anregung für das persönliche Gebet, für das Nachsinnen und die Betrachtung, ohne die es in unserem Leben mit der Kirche nicht geht. Vielleicht dienen die vorliegenden Gedanken dazu, daß man wieder froh wird über das, was wir besitzen, statt nach immer neuen bunten Federn zu suchen“ (Was die Messe bedeutet, 8).
Schatzgräberarbeit meint, die Liturgie so anzunehmen, wie sie die Kirche schenkt, und im Kontext dieser Kirchlichkeit jene Schätze zu heben, die sie birgt, die sie übernatürlich birgt, die sie aber auch natürlich birgt, indem so vieles in ihrem reichen Lauf durch die Jahrhunderte in sie eingegangen und in ihr aufgegangen ist, auch das Erbe von ansonsten untergegangen kulturellen Formen.
Prälat Prof. Dr. Theodor Schnitzler war ein gläubiger Mensch, dem die Liturgie viel bedeutete und der aus ihr lebte. Der Messe geht es um das Herz: „das Herz der Dinge, das Herz des Menschen, das Herz Gottes“ (Was die Messe bedeutet, 19).
Er stand aber in einer Bewegung, die Strukturen auflöste, Prinzipien umkehrte und so – nolens volens – den Weg zur Auflösung jener Gestalt ebnete, zu der hinzuführen zunächst ihre Absicht war.
Anmerkungen:
[1] Vgl. die Angaben bei Annibale Bugnini, La riforma liturgica ..., 161f.; Da das Consilium erst mit dem Motu Proprio Sacram Liturgiam durch Papst Paul VI. am 25. Januar 1964 errichtet wurde (vgl. Annibale Bugnini, La riforma liturgica ..., 63) und die Gottesdienstkongregation erst mit der Apostolischen Konstitution Sacra Rituum Congregatio vom 8. Mai 1969 errichtet wurde, sind die Angaben von Reimund Haas im BBKL fehlerhaft, wenn er schreibt: „... wurde Schnitzler ab 1963 Konsultor des Rates für die Ausführung des Liturgiedekretes und bei der römischen Kongregation für den Gottesdienst (bis 1975).“ a.a.O.
[2] „Wenn Josef A. Jungmann, den ,Stand des liturgischen Lebens am Vorabend der Reformation‘ beleuchtend, neben Zeichen ,des Rückgangs, ja des Verfalls‘ auch eine ,Blüte der Liturgie‘ entdeckte, so vermochte er doch nur ,Volkstümliches‘ auszumachen, daß etwa die Feste des Kirchenjahres ,noch am meisten im Volk lebendig‘ gewesen und ,tief ins Gemüt aufgenommen‘ worden seien, daß offenbar der Heiligenkalender ,die Volksseele angesprochen und das Volksgemüt erfüllt‘ habe. So lautet denn auch Jungmanns abschließende Bewertung: Aber es war eine herbstliche Blüte‘; im Ganzen sah er ,Auflösung im innersten Kerngebiet des kirchlichen und liturgischen Lebens‘. Kein Wort zu den neuen Verinnerlichungsbemühungen, kein Wort auch zu den aufweisbaren neuen Frömmigkeitslogiken und darum auch kein Wort zu Forschungsdesideraten. Tatsächlich ist viel stärker noch, als K. Gamber es bereits getan hat, von ,Liturgie-Bewegung‘ zu sprechen. Umso dringlicher gebietet sich daher, die immer noch nachwirkenden ideologischen Vorbehalte gegen das Spätmittelalter aufzugeben.“ Arnold Angenendt, Liturgik und Historik. Gab es eine organische Liturgie-Entwicklung? (Quaestiones Disputatae 189), Freiburg Basel Wien 2001, 169.
[3] In dieser Sicht steht die Liturgiewissenschaft zum Teil auch heute noch, so etwa Kunzler: „Die großen Liturgiewissenschaftler der Neuzeit entdeckten immer mehr die 'Kontingenz' (Zufälligkeit, geschichtliche Bedingtheit) gottesdienstlicher Entwicklungslinien: Vieles ist späteres Wachstum, und ob es immer glücklich dazu gewachsen ist, das ist zudem eine ganz andere Frage. Viele Verwerfungen und Widersprüche wurden erkannt, was andererseits wieder den Ruf nach Erneuerung möglich gemacht hat: Was in der Geschichte auch mit Brüchen und Verwerfungen so geworden ist, wie es nun einmal ist, das ist für die Zukunft auch veränderbar“. Michael Kunzler, Die „Tridentinische“ Messe. Aufbruch oder Rückschritt?, Paderborn 2008, 26f.
[4] Die Messe II ..., 3. Kritisiert sei keineswegs der inspirierende Blick in die Antike, sondern die Vorstellung des Verfalls nach ihr, die irgendwie mitschwingt.
[5] Leo Cardinal Scheffczyk, Inhalt und Anspruch des Mysteriums der Liturgie, in Musica Spiritus Sancti Numine Sacra. Beiträge zur Theologie der Musica Sacra aus den Publikationen der Consociatio Internationalis Musicae Sacrae (Romae), «ed.» Gabriel Maria Steinschulte, Città del Vaticano 2001, 72.
[6] Theodor Schnitzler, Was die Messe bedeutet ..., 58. Zumindest zwischen einem prinzipiellen Gesangstext (Introitus) und einem prinzipiell gesprochenen Text (Eingangsvers) ist ein wesentlicher Unterschied.
[7] Theodor Schnitzer, Was die Messe bedeutet ..., 21-23. Er erweitert dies auch noch auf die Opfermesse. Als Beispiel für unsere Bewertung genügt aber das Gesagte.







