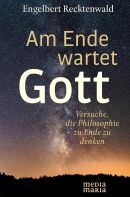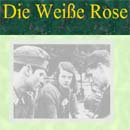zur katholischen Geisteswelt
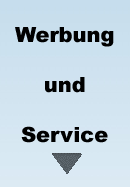
|
Zum
biographischen Bereich |
|
Zum englischen
und polnischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im philosophischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
liturgischen Bereich |
Themen
Atheismus
Atheisten
Atheist. Moral I
Atheist. Moral II
Aufklärung
Autonomie
Autonomiebuch
Biologismus
Entzauberung
Ethik
Euthanasie
Evolutionismus
Existenzphil.
Gender
Gewissen
Gewissen II
Glück
Glück und Wert
Gottesbeweis
Gottesglaube
Gotteshypothese
Handlung
Handlungsmotive
Das Heilige
Kultur
Kulturrelativismus
Langeweile
Liebe
Liebe II
Liebesethik
Menschenwürde
Metaethik
Methodenfrage
Moralillusion
Naturalismus
Naturrecht
Naturrecht II
Naturrecht III
Neurologismus
Opferidee
Philosophie
Proslogion
Relativismus
Sinnparadox
Sittengesetz
Sollen
Theodizee
Tierschutz
Verantwortung
Vernunftphil.
Vernunftrettung
Voluntarismus
Werte
Wirklichkeit
Zur Analyse des Subjektsbegriffs
Eine logisch-psychologische Studie
Von Bronislaw Wladislaus Switalski
Sunt enim et istae plangendae tenebrae,
in quibus me latet facultas mea, quae in me est,
ut animus meus de viribus suis ipse se interrogans
non facile sibi credendum existimet.
S. Aug. Conf. X 32.
Im Erkenntnisakte wird ein erkennendes Subjekt mit dem zu erkennenden Objekt in eine eindeutige allgemeingiltige Beziehung gesetzt; und zwar wird diese Beziehung dadurch allgemeingiltig, das das Subjekt sich bemüht, allseitig und unter Ausschaltung störender Einflüsse über die Gliederung des Objekts und den gesetzmäßigen Zusammenhang seiner Bestandteile sich zu orientieren. Daß zu diesem Zwecke eine Fixierung der zu erforschenden Objekte, eine Heraushebung des Beharrlichen und Gemeinsamen in ihrer stetig wechselnden Mannigfaltigkeit und endlich eine sorgfaltige Bestimmung der Ordnungen erforderlich ist, in die das betrachtete Objekt seinen verschiedenen Seiten nach hineingehört, ist im modernen Wissenschaftsbetriebe allgemein anerkannt. Auch das ist nicht unbekannt, daß das erkennende Subjekt auf selbstgewählten Wegen und mit eigenen Mitteln — „subjektiv" — dem angedeuteten Erkenntnisziele sich zu nähern sucht. Aber diese Tatsache, deren Feststellung der neuzeitlichen Philosophie ihren spezifischen Charakter aufgeprägt hat, ist noch lange nicht in ihrer vollen Tragweite erkannt und gewürdigt. Daher die Mißverständnisse, die immer von neuem bei dem Gebrauche des Subjektivitätsbegriffs mit unterlaufen: auch heute noch wird der Beitrag des Subjekts zum Zustandekommen der Erkenntnis teils unterschätzt, teils ungebührlich übertrieben. Man reflektiert eben nicht zur Genüge über die Bedeutung des Subjekts als eines wichtigen Erkenntnisfaktors. Meist begnügt man sich mit dem Hinweis auf das selbstverständlich erscheinende Ich-Erlebnis: Während die einen dabei nicht im stande sind, das erlebte „Ich", das sie unbedenklich mit dem Erkenntnis-Subjekt identifizieren, von seiner empirischen Ausgestaltung zu sondern, schälen andere, kritischer gesinnt, im Begriff des Erkenntnis-Subjekts sorgfältig die Subjektbestimmtheit, den Charakter des „Sich-Gegenüberstellens" und „Aufeinanderbeziehens" des zu Erkennenden, heraus; sie kommen so zu einem Subjektbegriff, dem als dem „reinen Ich" nichts Empirisches, nichts Konkretes und Individuelles mehr anhaftet. Jene deuten die Mitarbeit des Erkennenden an der Erkenntnis im unklar subjektivistischen Sinne aus: Die nicht weiter analysierte und deshalb keineswegs eindeutig bestimmte Naturausstattung des empirischen Subjekts wird gleichsam als der Käfig betrachtet, in dem wir bei unserem Erkennen eingeschlossen sind, so daß wir zur Erfassung des Nicht-Subjektiven, also zu dem, was das Erkennen eigentlich bezweckt, nicht vordringen können. Diese, die Vertreter des transzendentalen Idealismus, stempeln das „Ich" zum eigentlichen Quell und sozusagen zum schöpferischen Bestimmungsgrund alles Wissens: Das „reine Ich” ist autonom, auf sich selbst gestellt. Alles Andere ist nur „sein" Gegenstand, insofern die konstitutiven Merkmale dieses „Anderen" aus Setzungen des „reinen Ichs" abzuleiten sind. Das Erkenntnisganze, die „Wissenschaft" in idealer Bedeutung, ist das bis ins Einzelne hinein durchsichtige System von Vernunftsetzungen des „Ichs" zum Behufe der einsichtigen Vergegenwärtigung der Erfahrungswirklichkeit als eines vernunftgemäß notwendigen Zusammenhanges.
Man sieht, das „reine Ich" hat mit dem „Ich" der Subjektivisten nichts mehr als den Namen gemein; und doch wird es nur allzuhäufig mit dem empirischen Subjekt zusammengeworfen! Aus dieser Vermengung der Autonomie mit der subjektivistischen Relativität entsteht geradezu ein „gordischer Knoten" erkenntniskritischer Schwierigkeiten: Wie soll sich denn auch die Absolutheit des postulierten „reinen Ichs" und die logische Durchsichtigkeit seiner Setzungen mit der offenkundigen Bedingtheit des empirischen Subjekts und mit dem problematischen Charakter seiner Betätigungen in eins setzen lassen! Sollte es da nicht näher liegen, mit bewußter Ablehnung des auf solche Irrpfade uns führenden Subjektivismus dem extremen Objektivismus zu huldigen und den Beitrag des Subjekts zum Erkenntnisaufbau konsequent zu ignorieren? Der Positivismus ist eine der radikalsten Formen dieser naiv realistischen Interpretation des Erkennens. So verständlich es nun auch ist, daß eine derartige Leugnung aller Subjektivität als Gegengewicht gegen die Irrungen und Wirrungen eines kritiklosen Subjektivismus sich Geltung zu verschaffen sucht, so wenig begründet und berechtigt ist auch dieses Extrem. Um eine allseits befriedigende Lösung des Problems der Subjektivität anzubahnen, muß eben möglichst unbefangen, also ohne jedes polemische Interesse, der Subjektbegriff selbst durch Analyse der in ihm enthaltenen, für die Erkenntnisgewinnung wichtigen Momente geklärt werden. Einen Beitrag zu dieser Klärung soll die vorliegende Studie liefern, indem sie die Begriffspaare: Erkenntnissubjekt und Ichbewußtsein, Bewußtseins-Subjekt und Wirklichkeit, empirisches und absolutes Subjekt vom logischen Gesichtspunkte aus unter Zuhilfenahme psychologischer Erfahrungen genauer zu bestimmen unternimmt.
Quaerens... quid mihi praesto esset
integre de mutabilibus judicanti et dicenti
„hoc ita esse debet, illud non ita",...
inveneram incommutabilem et veram veritatis aeternitatem
supra mentem meam commutabilem.
S. Aug. Conf. VII 17
I. Erkenntnissubjekt und Ich-Bewußtsein
„Subjekt" im logischen Sinne ist der Gegenstand der Urteilsaussage. So angewendet bezeichnet dieses Wort jeden Gegenstand der Erkenntnis, die ja stets in Urteilen sich vollzieht. Wenn wir indes hier von einem „Erkenntnissubjekt" sprechen, so meinen wir damit nicht jeden beliebigen durch einen Erkenntnisakt bestimmbaren Gegenstand; wir verwenden vielmehr das Wort in einem einzigartigen Sinne, in dem es niemals auf das Erkannte, sondern auf den Erkennenden, nicht auf das Beurteilte, sondern auf den jeweils Urteilenden Anwendung findet. Erkenntnisakte werden nun im wesentlichen innerhalb eines Bewußtseins vollzogen; „Erkenntnissubjekt" in dem soeben angedeuteten Sinne kann somit nur ein mit Bewußtsein ausgestattetes Wesen sein. So führt uns das „Erkenntnissubjekt" auf die allgemeinere Bezeichnung „Bewußtseinssubjekt".
Die Bedeutung des Wortes „Subjekt" war ursprünglich nicht auf den Bereich der Bewußtseinswesen eingeengt; „Subjectum" heißt wörtlich das „zu Grunde Gelegte"; es kann deshalb dem Wortsinne nach mit dem metaphysischen Terminus „Substantia" (= Seinsgrundlage) gleichwertig gebraucht werden. Die Verwendung von „subjective" im Mittelalter für die reale, unabhängige Daseinsform, für das also, was wir heute allgemein als „objektiv" bezeichnen, ist nur aus einem solchen Sprachgebrauche erklärlich. Erst die Forderung Descartes', das letzte Fundament aller Gewißheit im Einzelbewußtsein zu suchen, hat die Wandlung des Wortsinnes angebahnt, die zu dem heute allgemein üblichen Sprachgebrauch führte. „Subjektivität” bedeutet fortan die Fähigkeit, die von der Wirklichkeit herrührenden Strahlen in sich auf eine andern unmittelbar nicht mitteilbare Weise zu sammeln und auf Grund der so gewonnenen Erfahrungen individuell-selbständig auf die Reize der Umgebung zu reagieren. Einem jeden von uns ist nur ein Subjekt, nämlich er selbst, unmittelbar gegenwärtig, da die Eigentümlichkeit, Brennpunkt der Erlebnisse und individueller Betätigungsgrund zu sein, jeder nur an sich selbst konstatieren kann.
Wir haben das „Bewußtseinssubjekt" als die allgemeinere Bezeichnung vom „Erkenntnissubjekt" unterschieden. Diese Unterscheidung wird gerechtfertigt durch eine Vergleichung der Begriffe „Bewußtsein" und „Erkennen". „Bewußtsein" bedeutet nun allerdings wörtlich ein „Wissen um etwas", also ein „Erkennen"; aber gleichwohl muß das „Erkennen" als eine von vielen Bewußtseinsfunktionen von diesem genau unterschieden werden. Wenn nämlich auch die Form des „Habens von Bewußtseinsinhalten", die „Bewußtheit", als Wissen gedeutet werden kann, so verstehen wir doch dem psychologischen Sprachgebrauch zufolge unter „Bewußtsein" den Inbegriff alles dessen, was in jener Form gegenwärtig ist. Und dazu gehört sehr Verschiedenartiges: Vom Erleben (Empfinden, Fühlen und Streben) zum Vorstellen (Sich-Erinnern und Phantasieren) bis zum Denken (Erkennen), Wollen und künstlerischen Gestalten! — Von den einfachen Erlebnissen unterscheidet sich nun das Erkennen durch die Selbständigkeit, die in der erkenntnismäßigen Aufnahme der Inhalte sich stets kundgibt; von den übrigen, durch Selbständigkeit ausgezeichneten Bewußtseinsfunktionen aber (dem Wollen und künstlerischen Gestalten) durch die Gebundenheit an ein fest bestimmtes Ziel: Ist doch das Erkennen ein sachlich bedingtes Ordnen und Erfassen der betrachteten Gegenstände! Als „Erkenntnissubjekte" haben wir uns frei zu machen von allen individuellen Beschränkungen und alles auszuschalten, was den Erkenntnisgehalt verfälschen konnte. Nur auf diesem Wege können wir unsere Erkenntnis zum Range der Allgemeingiltigkeit erheben! Das ideale Erkenntnissubjekt wäre somit der zwar selbständige, aber durchaus unparteiische Betrachter der Gegenstände, vergleichbar dem räumlich unausgedehnten Mittelpunkte des Kreises, in den alle Radien einmünden, ohne ihre Eigenart zu verlieren und ohne ihn selbst räumlich zu erweitern.
Diese erkenntnistheoretische Fiktion, die eben als solche im Bereich der Empirie nie völlig realisierbar ist, dient nun als Norm für die Beurteilung der Erkenntnisleistung der empirischen Subjekte. Diese in der Erfahrung allein vorfindlichen Subjekte, wir selbst, sind nämlich — vermöge der Eigenart unseres Bewußtseinslebens — nicht ausschließlich, nicht einmal in erster Linie derartig „reine" Erkenntniswesen: Wie alle Bewußtseinsinhalte mehr oder minder gefühlsbetont sind, uns also tiefinnerlich in Mitleidenschaft ziehen, so sind auch alle auf diese Erlebnisse reagierenden Bewußstseinsäußerungen ursprünglich und vornehmlich von unserem Interesse diktiert, es sind praktische Stellungnahmen dem „Fremden" gegenüber. Wir sind also vor allem praktisch-orientierte Wesen; und wenn der mit so großem Enthusiasmus seinerzeit begrüßte Pragmatismus nichts weiter bezweckte, als einer extrem-theoretischen und darum durchaus wirklichkeitsfremden Ausdeutung des Seelenlebens entgegenzutreten, so wäre gegen ihn nichts einzuwenden.
Die Praxis hat es mit äußerst komplizierten, in ihrer raschen Veränderlichkeit sofort Antwort erheischenden Verhältnissen zu tun. Das Bewußtseinssubjekt als Praktiker hat somit keine Muße aus dem Strome der Ereignisse emporzutauchen, um in unparteiischer Ruhe sie zu betrachten. Es fühlt sich selbst in Wirkung und Gegenwirkung verstrickt und vermag so zur Würdigung seiner einzigartigen Einheitlichkeit nicht vorzudringen. Auf dieser Stufe verharrt das Bewußtsein der Tiere. Wir wenden deshalb auf sie die Bezeichnung “Subjekt” nicht gern an, weil dieser Ehrentitel nach unserem Gefühle nur den Bewußtseinswesen zukommt, die im Vollbewußtsein ihrer Subjektivität zu wahrhaft selbständigem Handeln sich durchzuringen vermögen. In uns selbst nehmen wir nun diese Fähigkeit wahr. Wir bleiben nicht ständig auf der Stufe der reinen Praxis. Wir stellen uns allmählich immer bestimmter dem von uns Erlebten gegenüber. Wir machen es zu unserem “Gegenstande” im wahrsten Sinne des Wortes, indem wir es aus dem Strome des unmittelbaren Erlebens herauslösen, um es “für sich” zu betrachten. Diese Fähigkeit zur Vergegenständlichung, die uns als das Grundmerkmal unserer geistigen Würde erscheint, lockert zunächst die Bande der praktischen Bedürfnisse, um uns im Verlaufe unserer geistigen Entwicklung immer vollständiger von ihnen zu befreien. So werden wir aus rein praktisch interessierten Subjekten immer mehr zu unparteiischen Beschauern, zu Theoretikern. Wir nähern uns damit dem Ideale des “reinen Erkenntnissubjekts”, wenn wir es auch nie völlig erreichen.
Daraus ergibt sich für uns als Erkenntnissubjekte die Forderung, unsere Selbständigkeit derart auszubilden, daß sie gegebenenfalls im stande ist, rein das Erkenntnisziel zu verfolgen und dabei alles Unsachliche, affektiv und praktisch Bestimmende zu eliminieren. Das Bewußtseinssubjekt muß sich somit zum Erkenntnissubjekt emporentwickeln, da es nicht in jedem seiner Stadien in gleicher Weise befähigt ist als Begründer allgemeingiltiger Erkenntnisbeziehungen zu fungieren. Wenn aber dieser notwendigen Entwicklung die richtigen Wege gewiesen werden sollen, so müssen wir uns zunächst noch genauer über die unmittelbar vorfindliche Eigenart des Bewußtseinssubjekts orientieren.
Unmittelbar tritt uns das Bewußtseinssubjekt in der “Ich”-Form gegenüber. Die Bestimmung des Subjekts hebt deshalb zweckmäßig mit der Analyse des Ich-Bewußtseins an. Was wir mit “Ich” meinen, scheint uns nun freilich auf den ersten Blick einer Analyse weder fähig noch bedürftig zu sein. Glaubte doch schon Descartes mit seinem berühmt gewordenen Grundsatz: “Cogito, ergo sum”, also mit dem Hinweis auf das Ich-Erlebnis endlich eine solide Basis für alle Gewißheitsbegründung gefunden zu haben! Wenn wir nun aber bedenken, wie weit ernste Denker in ihren Ansichten über die Bedeutung des “Ich-Begriffs” von einander abweichen, ja wie man es sogar versucht hat, das Ich-Erlebnis als Illusion aus der Reihe des unmittelbar Gegebenen zu streichen, dann dürfte man wohl kaum mehr von einer Selbstverständlichkeit und durchsichtigen Klarheit des Ich-Erlebnisses sprechen wollen! Fragen wir uns nun zunächst, was bezeichnen wir mit dem “Ich-Begriff”? Durch die “Ich-Bezeichnung” wird das Gemeinte unfraglich nach zwei Seiten hin abgegrenzt: Dem “Ich” steht einerseits die ihm fremde, von ihm unabhängige Wirklichkeit gegenüber, und anderseits wird das “Ich” seinen Inhalten gegenübergestellt. Das Ich ist somit jedenfalls ein Beziehungsbegriff, aber eben als solcher braucht es nicht immer auf einen und denselben Gegenstand Anwendung zu finden. Das “Ich” ist vielmehr der “Eins” in der Zahlenreihe vergleichbar: Was mit diesen Beziehungsbegriffen gemeint ist, hängt eben jeweils von dem Ansatz und von der Beziehungsrichtung ab, in der sie gebraucht werden. “Ich” meine zwar mit diesem Worte nur “mich”; jeder andere aber, der dieses Wort sinnvoll gebraucht, meint eben “sich” damit.
Indem „ich" mich nun den von mir unabhängigen Gegenstanden einerseits und meinen Erlebnissen anderseits gegenüberstelle, stehe „ich" immer auf Seiten des anderes „sich" Gegenüberstellenden. „Ich" bin somit stets „Subjekt", und „ich" kann eigentlich nie „mich" objektivieren. Mit dieser Feststellung scheinen wir uns indes von vorneherein die Möglichkeit genommen zu haben, tiefer in der Analyse des Ich-Erlebnisses vorzudringen. In der Tat, wenn „ich" „mich" betrachte, so ist eben das betrachtete „Mich", und nicht das betrachtende „Ich" der eigentliche Gegenstand der Reflexion. Dieser Einwand, der so manchem Denker geradezu unaufhebbar zu sein scheint, ist allerdings so lange nicht zu beseitigen, als wir uns lediglich auf den Standpunkt der Reflexion stellen. In der Rückwendung des geistigen Blickes, die wir als Reflexion bezeichnen, ist ja stets eine ideelle Spaltung des Bewustseins gegeben. Aber die Reflexion baut sich doch auf dem unmittelbaren Erleben auf, und hier, in der Erlebnissphäre, ist in ungeschiedener Einheit gegeben, was von der Reflexion in seine Komponenten zerlegt wird. Wenn wir nun in Sachen des Ich-Bewußtseins an das unmittelbare Erleben appellieren, so finden wir in der Tat, daß wir durchaus berechtigt sind, das betrachtete „Mich" und das betrachtende „Ich" in eins zu setzen. Konstatieren wir doch dabei nicht nur, daß die gegenwärtig erlebten Inhalte (im „Querschnitt" des Bewußtseins) wechselseitig zu einer restlos nicht auflösbaren Einheit verknüpft sind; wir sind vielmehr auf Grund der Nachwirkungen unserer Erlebnisse ebenso unmittelbar gewiß, das dieselbe Bewußtseinseinheit auch im Nacheinander unserer Zustände (im „Längsschnitt" des Bewußtseinsstromes) sich behauptet, und dabei wird uns nun auch von unserem Erleben bezeugt, daß das Betrachter-Ich des einen Augenblickes, so sehr es sich in ihm der Gesamtheit der Bewußtseinserlebnisse, dem „Mich", gegenüberstellt, im nächsten Augenblick ohne weiteres in den „Mich"-Zusammenhang sich einordnet, so das an der Identität beider im Ernste nicht zu zweifeln ist. Durch diese Erwägung haben wir uns also für eine weiterdringende Analyse des „Ich"-Begriffs freie Bahn geschaffen.
Wenn ich nun auf mein „Erlebnis-Ich" reflektiere, so drängt sich meiner Betrachtung zweierlei, anscheinend Gleichberechtigtes auf: es ist die Fülle der Vorgänge einerseits, die ich als „meine" Erlebnisse und „meine" Betätigungen vorfinde, und anderseits der eigenartige Zusammenhang, der sie nicht bloß wechselseitig verknüpft, sondern im eigentlichen Sinne erst zu „meinem" Eigentum macht, ihre Richtung auf einen Einheitspunkt, auf den sie hinweisen und von dem sie ausgehen, das Moment der Einheit also, das sie zu einem „Reiche für sich", zu einem in sich geschlossenen und organisierten Zusammenhang abschließt. Nennen wir die Fülle der Erlebnisse und Betätigungen die „materiale Ich-Komponente" und jenes Einheitsmoment die „formale" Ich-Komponente, so unterliegt es keinem Zweifel, daß dieses formale Element das konstituierende Merkmal des Ich-Begriffes ist. Das materiale Element gibt seinen abgeleiteten Charakter schon in den großen Schwankungen kund, denen es unterworfen ist: Inhalte tauchen auf und verschwinden wieder; ja, der Bereich dessen, was ich als zu „mir" gehörig aus dem Umkreis des Gegebenen heraushebe, wechselt sogar je nach dem Gesichtspunkte, unter dem ich das mir vorliegende Material betrachte: „Meine" Empfindung, „mein" Streben, „mein" Denken, „mein" Körper, „mein" Buch, „mein" Vaterland -, welche Mannigfaltigkeit von Umkreisen, die ich mit diesen Bezeichnungen als „materiale" Ich-Komponente aus dem Wahrgenommenen herausgehoben habe! Jedesmal aber ist es das formale Ich-Element, das bei dieser verschiedenartigen Accentuation des Gegebenen in „Ich" und „Nicht-Ich" eine bestimmende und zwar stets die gleiche Rolle gespielt hat.
Sollen wir nun daraus folgern, das die „materiale" Ich-Komponente fur die Bestimmung unseres Subjektscharakters von keiner Bedeutung ist? Wir würden damit entschieden über das Ziel hinausschießen! Denn einerseits finden wir bei näherem Zusehen, dass ein Teil von Inhalten enger, als andere Inhalte, und zwar so unlöslich mit der formalen Ich-Komponente verknüpft ist, dass er sich nötigenfalls sein „Bürgerrecht" in dem Reiche meines „Ich-Bewusstseins" erzwingt, und anderseits erlebe ich, dass diese so mit mir verbundenen materialen Momente auf die Ausgestaltung der formalen Ich-Komponente unter Umständen einen bestimmenden Einfluss ausüben. Ich konstatiere deshalb, dass jenes im engeren Sinne zur materialen Ich-Komponente gehört, das auf diese Weise als zu „mir" in unlöslichem „realen" Zusammenhang stehend erlebt oder auf Grund der Erlebnisse ermittelt wird. Mit dieser zuletzt erwähnten Bestimmung werden wir aus dem Bereich des unmittelbar Gegebenen hinausgeleitet. Wir wollen deshalb hier den Gedanken nicht weiter verfolgen und nur auf den für die weitere Untersuchung grundlegenden Unterschied zwischen realem Bestand und ideellem Vorfinden mit einigen Worten hinweisen: Was zu mir in realer Weise gehört, braucht mir nicht unmittelbar (ideell) gegenwärtig zu sein. In der Tat fällt vieles davon aus dem Rahmen meines Bewusstseinslebens heraus. Ja, selbst was in meinem Bewusstsein realiter vorgeht, wird von mir nicht immer (idealiter) bemerkt. Zu mir „gehört" eben vieles, was ich nicht zu mir „rechne". Realer Zusammenhang und ideelle Zusammenordnung sind zweierlei. Daraus ergibt sich aber für unser spezielles Problem, dass das „Ich", soweit es mir in der Reflexion gegenwärtig ist, sich nicht mit dem Erlebnis-Ich restlos deckt, und dass dieses hinwiederum wohl zu unterscheiden ist von dem realen Bewusstseinssubjekt, das in ihm sich selbst erlebt.
Immerhin darf auch diese Unterscheidung nicht überspannt werden. Das „Erleben" und die „Reflexion" sind selbst reale Vorgänge, und so erklärt es sich denn, dass das Ich-Bewusstsein, wie es mir im Erleben und schärfer noch in der Reflexion gegenwärtig ist, auch auf den realen Erlebnis-Zusammenhang einen bestimmenden Einfluss ausüben kann. Was insbesondere den realen Erkenntnisprozess anbetrifft, so wird er überhaupt erst möglich, sobald das Subjekt, wenn auch zunächst in noch so primitiver Form, sich als „ich" der Umwelt gegenübergestellt, und die Zuverlässigkeit, Schärfe und Konsequenz meines Erkennens hält gleichen Schritt mit der gleichsinnigen Entwicklung meines „Ich"-Bewusstseins. Man kann unbedenklich die Behauptung aufstellen, dass genau so viel von unserem realen Subjektcharakter für das Erkennen — und nicht nur für dieses, sondern für jede selbständige Stellungnahme — aktualisiert, wirkungsfähig gemacht wird, als es im „Ich" uns bewusst wird und als solches sich verfestigt.
Wie kommt indes dieses „Ich"-Bewusstsein zustande? und wie kann es somit sich vervollkommnen? Als das eigentlich „Ich"-bildende Moment erschien uns die formale Ich-Komponente: Die an sich ungeschiedene Erlebnismasse wird in Ich und Nicht-Ich accentuiert durch jede Betätigung dieser Komponente. Dunkel gibt sie sich bereits im Fühlen, im „Angemutetsein von den einzelnen Erlebnissen" kund; bestimmter regt sie sich in jeder Triebäußerung, im Akte des Strebens. Gefühl und Streben sind somit die ersten Kristallisationspunkte für die Bildung des Bewusstseins vom eigenen Selbst. Je bestimmter nun diese Selbständigkeit sich äußert, je mehr durch sie von dem erlebten Material verarbeitet, organisiert, also einheitlich durchgestaltet wird, um so schärfer umrissen tritt das „Ich" in seiner Einheitlichkeit hervor. Hier kommt nun auch die materiale Ich-Komponente wieder zur Geltung: die Selbständigkeit kann sich nicht im „luftleeren Raume" äußern. Sie braucht nicht nur einen Gegenstand, an dem sie sich erproben kann; sie bedarf vielmehr auch eines konkreten Stützpunktes, an dem sie sich orientiert, und von dem aus sie sich äußert. Gerade als dieser konkrete Stützpunkt dient nun für unser Selbstbewusstsein die materiale Ich-Komponente, also der Inbegriff von „meinen" Erlebnissen und „meinen" Handlungen. Die Einheitlichkeit eines jeden Querschnittes meines Bewusstseins und damit mein gegenwärtiges Ich-Erlebnis wird von mir bemerkt, weil ich eben finde, wie alle bewussten Inhalte wechselseitig zusammenhängen und sich um einen einheitlichen Mittelpunkt gruppieren; und die Identität meines „Ich" in den verschiedenen Stadien meiner Entwicklung würde von mir nicht konstatiert werden können, wenn nicht Fäden des Zusammenhanges mein früheres, nun dispositionell in „mir" ruhendes Erleben mit dem gegenwärtigen Erleben auf das engste verknüpfen würden.
Eine kurze Vergegenwärtigung von Zuständen, in denen das Ich-Bewusstsein sei es vollständig fehlt, sei es krankhaft verändert ist, mag zur Bekräftigung unserer Ausführungen dienen! Im frühesten Kindesalter fehlt jedes Selbstbewusstsein, weil die selbständigen Regungen noch nicht stark genug sind, um eine Accentuierung in Ich und Nicht-Ich anzuregen. Im Traume ist es für gewöhnlich ebenfalls nicht vorhanden, weil die Lockerung der Vorstellungsbeziehungen, wie sie mit der Herabsetzung des seelischen Lebens im Schlafe gegeben ist, das vereinheitlichende Moment völlig zurücktreten, wenn nicht ganz verschwinden last. Aus dieser Dissoziation der einzelnen dispositionellen Verknüpfungen und zwar aus einer eigenartigen Auflösung in einzelne, in sich abgeschlossene Komplexe von Dispositionen erklärt sich auch die krankhafte Erscheinung der sog. “Spaltung der Persönlichkeit” und das alternierende Auftreten verschiedener “Persönlichkeiten” in einem Subjekt. Gerade diese Anomalien sind besonders lehrreich, da in ihnen die formale Ichkomponente augenscheinlich wirksam ist. Wegen der vollständigen Loslösung einzelner Komplexe der materialen Ich-Komponente erscheint sie sich aber, weil sie jeden einzelnen Komplex als Stützpunkt benutzt, in den einzelnen Stadien als “nicht dieselbe” Persönlichkeit. Aber auch im normalen entwickelten Bewusstseinsleben kommen Trübungen des Ich-Bewusstseins vor: Wer “in den Tag” hineinlebt und heute um das sich nicht kümmert, was gestern war, bei dem ist das Identitätsbewusstsein des Ich zum mindesten sehr schwach. In die früheste Kindheit kann sich kaum einer von uns zurückversetzen, weil die allmähliche Umwandlung der materialen Ich-Komponente im Laufe der Jahre einen solchen Umfang angenommen hat, dass die Beziehungsfäden zu jenem ersten Stadium fast gänzlich für unser Bewusstsein verloren sind: wir sagen “fast gänzlich”, denn es kann vorkommen, das bei etwas günstigeren Bedingungen, bei einem mit der Kindheitsstimmung verwandten Gesamtgefühlszustand z. B., auch von weit entfernten Erlebnissen sich gleichsam der Schleier lüftet. Zum Schluss sei noch auf die gewaltsamen Erschütterungen des Seelenlebens — nach Krankheiten, Trauerfällen u. ähnl. — hingewiesen, die unter Umständen derartig revolutionierend auf das Ichbewusstsein einwirken, das “ich” “mich selbst”, wie “ich” unmittelbar vor dem Vorfall war, nicht mehr wiedererkenne! — Das “Ich”-Bewusstsein ist also einer Vervollkommnung ebenso fähig, wie es jederzeit der Gefahr einer Herabsetzung ausgesetzt ist. Wollen wir dieser Gefahr begegnen und jene Vervollkommnung immer mehr realisieren, dann gilt es eben, durch selbständige, vielseitige Vereinheitlichung und Ordnung des in der materialen Ich-Komponente aufgespeicherten Materials das “Ich” in seiner einheitbildenden Bedeutung für unser Bewusstsein im “Querschnitt” und im “Längsschnitt” scharf zu entwickeln.
Das “Ich”, so können wir sagen, “ist” nicht, es “wird”, und es wird um so bestimmter zur Geltung kommen, je mehr ich mir einerseits die Identität der formalen Ich-Komponente im Wechsel der Bewusstseinsstadien vergegenwärtige und anderseits diese Stadien selbst genau auseinanderhalte und ihnen jeweils die entsprechende Entwicklungsstufe der materialen Ich-Komponente zuordne. Eine besondere Hilfe für diese Vervollkommnung des Ich-Bewusstseins bietet die Ausbildung des Zeitbewusstseins. Je genauer mein Begriff von einem stetigen Nacheinander ist, je mehr ich imstande bin, konkrete zeitliche Verhältnisse sorgfältig in ihrer Aufeinanderfolge zu bestimmen, um so mehr werde ich auch in der Lage sein, mir über die Phasen meiner Entwicklung Rechenschaft abzulegen, ja, wir können geradezu sagen, dass wir nur so viel von unseren früheren Erlebnissen in sichern Eigenbesitz geborgen haben, als wir in eine übersichtliche zeitliche Ordnung einzureihen vermögen. Indem wir vom Standpunkt der Gegenwart auf das Vergangene zurückblicken, suchen wir unser früheres Leben zu rekonstruieren, und nur soweit lässt es sich eben rekonstruieren, als wir es zeitlich wenigstens annähernd genau bestimmen können.
Wir haben nun noch die Resultate unserer Analyse des Ich-Bewusstseins nach ihrer Bedeutung für den Erkenntnisprozess zu würdigen. Zunächst, ein negatives Ergebnis: Wegen der Wandelbarkeit des Ich-Bewusstseins und wegen der nur allmählich fortschreitenden Aktualisierung des Bewusstseinssubjekts im Ich-Bewusstsein darf das erkennende Ich einer Phase nicht ohne weiteres als gleichwertig mit dem Ich einer anderen Phase meines Bewusstseins betrachtet werden. Die in den verschiedenen Entwicklungsstadien gewonnenen
Erkenntnisse sollen also nicht bloß sachlich miteinander verglichen werden; will man vielmehr ihnen vollkommen gerecht werden und zugleich ihren Sinn möglichst adäquat erfassen, so muss man sie auf den Zustand des Ich-Bewusstseins beziehen, von dem aus sie gebildet sind. Jeder Versuch einer unterschiedslosen Gleichsetzung der einzelnen Ich-Stadien oder gar einer Verabsolutierung eines unter ihnen führt zu einem Begriffsrealismus schlimmster Art und verwickelt in unheilvolle Widersprüche. Wir ersehen daraus, wie logisch widersinnig es ist, bei seinen Entscheidungen auf sein Ich zu pochen, als wäre es eine unwandelbare, in jedem Augenblicke klar umrissene Größe!
Die Schwankungen und Unstimmigkeiten, die für den Erkenntnisprozeß aus der Wandelbarkeit des Ich-Bewustseins und aus der nur allmählichen Verwirklichung des Subjektscharakters im Erkennenden sich ergeben, suchen wir nun gerade durch die Herausarbeitung eines einheitlichen, seiner steten Entwicklung und seiner Identität in dieser Entwicklung sich bewußten „Ichs" zu beseitigen. Wir erkämpfen uns dadurch einen festen Ausgangspunkt für die zum Behufe der Erkenntnis anzustellenden Beobachtungen. Wie wir mit unserem Auge nur dann einen Körper scharf visieren, wenn unser Auge in der Ruhelage sich befindet, so sind wir eben auch nur nach Herstellung einer Ruhelage für unseren geistigen Blick durch Ordnung und eindeutige Bestimmung des erkennenden Subjekts im stande, den zu erforschenden Gegenstand zu fixieren und seiner Eigenart gemäß ohne Schwankungen zu umgrenzen.
Die fortschreitende Herausarbeitung des „Ich"-Charakters befreit uns also immer mehr vom Strome des Erlebens, der uns selbst fortzureißen droht, und gewährt uns jene Selbständigkeit, deren wir zur Vollziehung der Erkenntnisakte bedürfen. Erkennen ist ja kein passives Hinnehmen; Erkennen bedeutet vielmehr, von der subjektiven Seite aus betrachtet, ein Erfassen, ein Aneignen von dem jeweiligen Stand meiner Entwicklung aus und ein Einordnen in den bisher gewonnenen Schatz der Erfahrungen. Darum ist das für den Erkenntnisakt günstige Verhalten nicht eine völlige Selbstentäußerung, sondern gerade eine Steigerung der Aktivität, die uns in den Stand setzt, von einem hohen und freien Standort aus nach selbstgewählten Gesichtspunkten dasMaterial zu sichten, zu gliedern und so allmählich die in ihm verborgenen Fäden (Gesetzmäßigkeiten) in voller Reinheit herauszulösen.
Gerade weil der Erkenntnisprozeß ohne Selbständigkeit nicht realisierbar wäre, muß das ideale Erkenntnissubjekt als autonom, als absolut selbständig gedacht werden. Die Erkenntnis wäre eben dann vollendet, wenn es für den Erkennenden keine Dunkelheit, nichts lediglich Gegebenes und darum einfach Anzuerkennendes gäbe, wenn er also in der Lage wäre, alles aus eigenen Setzungen abzuleiten. Das empirische Subjekt, das wegen seiner unaufhebbaren Bedingtheit dieses Ziel nie erreichen kann, strebt wenigstens diesem Ideale nach: es hat nur soviel wirklich erkannt, als es durch selbständige Verarbeitung sich angeeignet hat.
Man verwechselt die Autonomie, die hier als Ideal des Erkenntnissubjektes gewürdigt wurde, meist mit der Willkür des landläufigen Subjektivismus. Die hier gemeinte Selbständigkeit ist indes das gerade Wider spiel von Willkür und dumpfer Laune. Die Forderung der Autonomie darf also keineswegs als ein Freibrief aufgefaßt werden für eine schrankenlose Auswirkung aller Anlagen und Neigungen des empirischen Subjekts. Autonomie bezweckt vielmehr auf sich selbst gestellte, in sich selbst ruhende Gewißheit des Subjekts, und eine derartige Gewißheit schließt nicht bloß das einfache Gegebensein der Objekte, sondern ebenso das blinde Hingegebensein an das in uns zufällig Auftauchende aus. Wenn wir in der Fähigkeit der Vergegenständlichung das konstituierende Merkmal unserer geistigen Würde sahen, so können wir die Möglichkeit der Konstruktion des autonomen Ideals als die Feuerprobe unserer Geistigkeit, als den Höhepunkt geistigen Ringens bezeichnen!
Das Erkennen als subjektive Funktion ist aber nicht lediglich durch die zu betätigende Selbständigkeit charakterisiert; es ist vielmehr, wie wir sahen, ein “Einordnen in den bisher gewonnenen Schatz der Erfahrungen”. Die Ordnung und Beherrschung der materialen Ich-Komponente kommt uns hier in ihrer Bedeutung für den Erkenntnisprozeß zum Bewusstsein: Was wir erlebt und uns durch Beachtung angeeignet haben, dient uns fortan als Hilfsmittel zur Aneignung (Apperzeption) des neu und fremdartig uns Entgegentretenden. Je reicher der so gewonnene Erfahrungsschatz ist, und je mehr er durch vielfältige Verknüpfung erregbar ist, um so besser sind wir für die Aufnahme und Beachtung des Neuen ausgerüstet, weil die zu seiner Interpretation verwendbaren Spuren präsent sind oder doch leicht präsent gemacht werden können. Auch hierbei spielt übrigens die Aktivität eine wichtige Rolle: Blitzartig knüpft sie Beziehungen des Neuen mit dem bereits Erfahrenen, die den zu erfassenden Gegenstand in einem besonderen Lichte erscheinen lassen (Intuition), und durch Erregung bald der einen bald der anderen Dispositionsreihe arbeitet sie ihn gleichsam plastisch heraus, indem sie ihn von den verschiedensten Seiten beleuchtet. So ist das Ich mit dem im Laufe seiner Entwicklung erworbenen und selbständig geordneten Erfahrungsschatz einem mehr oder minder fein gestimmten Apparat vergleichbar, der die Eindrücke nicht bloß aufnimmt, sondern auch in die uns verständliche Sprache übersetzt.
Dass unserem Erkennen in der Tat ein solcher Aneignungs- und Ausdeutungsprozess zu Grunde liegt, können wir unaufhörlich an uns selbst konstatieren: Wie vieles wird von uns nur obenhin erfasst! Und wenn manches uns nicht nur mehr interessiert, sondern auch schärfer erkannt und vollständiger gewürdigt wird, so liegt es eben daran, dass unsere Aktivität gerade auf diesem Gebiete sich besonders leicht und gewandt äußert, und diese Leichtigkeit hinwiederum ist zum größten Teil bedingt durch unsere “Erfahrung” und “Übung” auf diesem Gebiete d. h. aber durch die Stärke der entsprechenden Dispositionen und ihre feste, vielseitige Assoziation, die eben ihre Erregbarkeit und Verfügbarkeit bedingen! Wenn endlich es bei einem an sich alltäglichen Gegenstande uns “wie Schuppen von den Augen fällt”, so dass wir neue Seiten an ihm erkennen, so erklärt sich diese plötzliche Neubeleuchtung nur dadurch, das bis dahin noch nicht erregte Dispositionen wirksam werden und dabei jenen scheinbar altbekannten Gegenstand meiner Betrachtung von einem neuen Gesichtspunkte aus zeigen.
Es liegt nahe aus dieser Feststellung die Folgerung zu ziehen, dass eine fortschreitende Beachtung des in mir Vorgehenden, eine stete Vertiefung in das eigene Innere also, mit der Entdeckung neuer Mannigfaltigkeiten im Eigenleben zugleich eine weitergehende Feinheit in der Aufnahme der “fremden” Eindrücke bedingt, und in der Tat belehrt uns die Geistesgeschichte der Menschheit, dass eine genauere Orientierung über das eigene Innere stets eine Erweiterung und Bereicherung unseres objektiven Gesichtskreises zur Folge hatte, wobei freilich schon hier darauf hingewiesen sein mag, dass auch umgekehrt unsere Geisteskraft durch Erforschung und Erfassung des Gegenständlichen geschärft und geschult wird für die Analyse und genauere Bestimmung unserer Ich-Zustände.
Ist indes durch Betonung der subjektiven Seite des Erkenntnisprozesses das Erkennen als ein lediglich “sachlich bedingtes” Erfassen des Erkenntnisgegenstandes nicht aufgegeben? Wie lässt sich Subjektivität und Sachlichkeit mit einander versöhnen? Das Bedenken erscheint so schwerwiegend, weil man mit dem Begriff der Subjektivität ohne weiteres den Nebengedanken des subjektiven Verfälschens des Aufzunehmenden verbindet. Unsere Analyse des Ich-Bewusstseins sollte uns aber zeigen, auf welchem Wege wir uns immer mehr aus den einengenden Fesseln der empirischen Anlage zu befreien vermögen: Die Aktivität, die ein wesentliches Moment der formalen Ich-Komponente bildet, setzt uns in den Stand, auch über unsere eigene Bedingtheit zu reflektieren und damit ihren Einfluss auf die Aufnahme der zu erkennenden Gegenstände zu kontrollieren, und gerade je mehr wir den Schatz unserer Erfahrungen selbständig durchgestaltend uns angeeignet haben, um so weniger werden wir eine “von selbst” erfolgende Apperzeption des Neuen einfach hinnehmen, um so mehr werden wir vielmehr bestrebt sein, unsere Erkenntnis immer genauer dem Objekt anzupassen. So liegt gerade in einer derartig gereinigten Subjektivität das nie rastende Streben nach ungetrübter Sachlichkeit unserer Erkenntnis und die einzig zuverlässige Bürgschaft ihrer Erreichbarkeit. Nur dem so selbständig zu stärkenden Wahrheitssinn erschließt die Welt der Erkenntnisgegenstände endlich ihre letzten Rätsel!
Ein Streben, wie es hier angedeutet ist, erfordert allerdings ein bestimmtes Ziel, und, wenn es von aller beengenden Fessel befreit sein soll, dann muss das ihm vorschwebende Ziel über die Zufälligkeiten und den Wechsel des empirischen Daseins erhaben sein. So sehen wir als das notwendige Korrelat der zu erstrebenden subjektiven Selbständigkeit die Anerkennung eines überindividuellen und überempirischen Zieles des Erkenntnisstrebens! Das Ich-Bewusstsein kann sich nur dann voll entfalten, wenn es an einem solchem Ziele sich orientiert, und von diesem Ziele, der absoluten Autonomie her, nimmt das Erkenntnissubjekt dann auch die unveränderlichen Masstäbe zur eindeutigen Fixierung und allseitigen Bestimmung des Erkenntnisgegenstandes.
II. Bewusstseinssubjekt und Wirklichkeit
Quis porro nos docet
nisi stabilis veritas, quia
et per creaturam mutabilem
cum admonemur,
ad veritatem stabilem
ducimur?
S. Aug. Conf., XI. 8.
Bei der Analyse des „Ich-Bewusstseins" und seiner erkenntnistheoretischen Bedeutung suchten wir uns strenge an das unmittelbar Gegebene zu halten, um vermittelst einer einfachen Beschreibung die konstituierenden Merkmale des Ich-Begriffs, die Phasen der „Ich"-Entfaltung und die Richtungen einer zu erstrebenden Vervollkommnung des Ich-Bewusstseins zu ermitteln.
Wir kamen allerdings bereits dort mit den Mitteln einer bloßen Deskription nicht aus: Der Hinweis auf die Dispositionen und auf die mit ihrer Hilfe vollziehbare Rekonstruktion unseres vergangenen Lebens führte uns schon aus dem Rahmen des unmittelbar Gegebenen heraus. Aber wir mussten noch weiter gehen: das Ich-Bewusstsein erschien eins nur als eine Form, in der das reale Bewusstseinssubjekt sich auswirkt; und dieser Begriff des Realen und des realen Zusammenhanges, dem wir die ideelle Zusammenordnung gegenüberstellten, eröffnete uns eine Perspektive, die wir dort nicht weiter verfolgen konnten. Wenn wir nämlich erwägen, dass die Ordnung unserer Erkenntnisse nur gleichsam ein Oberbau ist auf dem Fundamente einer andersartigen Ordnung, der Wirklichkeitsordnung, von der sie abhängt, auf die sie aber auch selbst einwirkt, dann tritt uns die Verwicklung des Erkenntnisproblems erst recht klar vor Augen: Wir haben eben nicht zu tun mit zwei parallel laufenden Reihen, der Seinsreihe auf der einen, der Erkenntnisreihe auf der anderen Seite, von denen jede für sich abgeschlossen wäre, — in Wahrheit schießen vielmehr Beziehungsfäden zwischen den beiden Reihen hin und her! Ist durch diese enge Wechselbeziehung einer Wirklichkeitsfremdheit der Erkenntnis nach Möglichkeit vorgebeugt, so ist doch anderseits eben dadurch die ungestörte Betrachtung einer der Reihen für sich überaus erschwert. Der Analyse eröffnet sich somit ein neues Arbeitsfeld: Es gilt die Hauptfäden der wechselseitigen Verknüpfung der beiden Reihen sorgfaltig zu entwirren und so das Erkenntnisproblem von einer neuen Seite seiner endgültigen Lösung näher zu bringen.
Bevor wir indes diese Analyse beginnen, müssen wir uns - wenigstens skizzenhaft - die Motive vergegenwärtigen, die uns nötigen, vom unmittelbar Gegebenen aus eine diesem zu Grunde liegende Wirklichkeit zu erschließen. Wir berühren damit das heftig umstrittene Realitätsproblem. Man kann sich den Weg zu einer befriedigenden Beantwortung dieses Problems von vorneherein durch eine falsche Formulierung verbauen. Das ist der Fall, wenn man fragt, wie das Bewusstseinssubjekt, dessen Realität als selbstverständlich hingenommen und deshalb nicht genauer kritisch umgrenzt wird, seine Überzeugung von dem Vorhandensein einer von ihm unabhängig existierenden Wirklichkeit rechtfertigen könne. In Wahrheit ist die Realität des Bewusstseinssubjekts ebenso Problem, wie die übrige Wirklichkeit. Unmittelbar gegeben ist nur eine Mannigfaltigkeit von Inhalten und ein zunächst nicht näher definierbarer Zusammenhang dieser Inhalte, der bei näherem Zusehen eine Differenzierung in einzelne fester zusammengehörige Bereiche in sich birgt. Alles Beharrliche und Gesetzmäßige wird von uns zum Behufe einer widerspruchsfreien Interpretation des Gegebenen durch gedankliche, die Lücken des Gegebenen ergänzende Operationen festgestellt. Reales Bewusstseinssubjekt und Wirklichkeit sind deshalb, um einen glücklich gewählten Ausdruck der modernen Psychologie zu verwenden, innerhalb der Erkenntnisreihe “Funktions”-, nicht “Deskriptions”-begriffe.
Wenn wir so die ideelle Konstruktion des Subjekts- und des Wirklichkeitsbegriffs betonen, wollen wir keineswegs die Realität der durch diese Begriffe bezeichneten Gegenstände leugnen. Die idealistische Einschränkung der Giltigkeit dieser Begriffe auf den in sich geschlossenen Bereich des Wissenssystems halten wir für ebenso verfehlt, wie die naiv realistische Identifizierung des Begriffs mit dem realen Gegenstand. Unsere Betonung der ideellen Konstruktion jener Begriffe sollte nur dem Nachweis dienen, dass bei der Frage nach der Berechtigung der Überzeugung von der Realität das Bewusstseinssubjekt ebenso in Mitleidenschaft gezogen wird, wie die Wirklichkeit im engeren Sinne.
Wenn wir uns nun nach dem Sinn des Begriffes “Realität” fragen, so muss der Ansatzpunkt zur Beantwortung dieser Frage innerhalb des unmittelbar Gegebenen gesucht werden. Dieses “Gegeben”-sein ist für uns die Urform des Realitätsbewusstseins. Mit dieser Urform der Realität kommen wir aber auf die Dauer nicht aus: Innerhalb des fluchtartigen Nacheinander “gegebener” Inhalte lösen sich - zunächst ohne Mithilfe des selbständigen Denkens - beharrliche Komplexe, regelmäßig wiederkehrende Verlaufe heraus. So tritt eine Differenzierung im Bereiche des “Gegebenen” ein: Das Beharrliche und Regelmäßige erscheint als das eigentlich Wirkliche dem Flüchtigen als seiner bloßen “Erscheinung” gegenüber. Nicht bloß die Befriedigung an den ersten Spuren einer Ordnung ist es, die uns zu dieser Bevorzugung des Beharrlichen und Regelmäßigen veranlasst. Eine tiefer dringende Erfahrung zeigt uns vielmehr, dass hier wichtige, praktische Lebensinteressen mit im Spiele sind. Sind doch Beharrlichkeit und Regelmäßigkeit die ersten Kennzeichen jener Unerbittlichkeit, mit der die Naturordnung uns umspannt! Immerhin ist es richtig, dass durch diese Spuren einer Ordnung, die sich uns aufdrängen, unser Ordnungsbewusstsein erweckt wird, und, einmal erweckt, versucht es, schüchtern zunächst, dann immer entschiedener und bewusster den Ordnungszusammenhängen des Gegebenen selbständig nachzuforschen.
Nun sucht man alles Wechselnde auf beharrliche Grundlagen, alles Mannigfaltige auf möglichst einfache Prinzipien zurückzuführen. Man forscht nach dem „wahrhaft seienden" Wesen der fluchtigen Erscheinungen, und, weil man es nicht innerhalb der Reihe des unmittelbar Gegebenen findet, so sucht man es eben jenseits dieses Gegebenen. Je nach dem Grade der Gewaltsamkeit, die man mit seinem jugendlichen, durch Enttäuschungen noch nicht gewitzigten Denken bei der Bestimmung dieses „wahrhaft Seienden" entwickelt, verliert man sich in mehr oder minder einseitige Spekulationen, indem man in verschiedenem Maße von der im unmittelbar Gegebenen sich kundtuenden Wirklichkeitsfülle bei seinem Erklärungsversuche abweicht. So losen einander irrige Ansichten über das Wesen der Wirklichkeit ab, aber unerschütterliches Gemeingut des forschenden Geistes bleibt doch die Überzeugung, dass nur im Beharrlichen und Regelmäßigen, nur in der gesetzmäßigen Ordnung das eigentliche Wirkliche zu suchen sei: sowohl die Durchsichtigkeit allgemeiner Gesetzmäßigkeiten, als auch die praktischen Erfolge der auf diesen Gesetzmäßigkeiten aufgebauten Erwägungen, also die durch die unmittelbare Erfahrung bezeugten Bestätigungen für die Richtigkeit jener Tendenz bestärken ihn in seiner Zuversicht bei dem Forschen nach dem Wesen des Wirklichen. Nur vorsichtiger wird der Forscher im Fortschritt seiner Erfahrung: das allein gilt ihm fortan als real, was auf methodisch einwandfreie Weise als Dauergrund des unmittelbar Gegebenen sich ermitteln lässt. So spürt er dem Realen mit kritischer Vorsicht nach: Der feste Ausgangspunkt, an dem er sich immer von neuem orientiert, bleibt die „Urform des Realen", das unmittelbar Gegebene. Die in ihm sich kundtuenden Beziehungsfäden (Regelmäßigkeiten) knüpft er geschickt zu Maschen (Gesetzen) eines Forschungsnetzes; so gelingt es ihm allmählich immer besser, das feste Gestein des Substantiellen, für sich Bestehenden aus dem Meere, dessen Oberfläche das unmittelbar Gegebene ist, zu bergen. Zwischen dem unmittelbar Gegebenen und seinem Seinsgrunde besteht also für den Forscher nicht eine unüberbruckbare Kluft, sondern ein steter Zusammenhang!
Allerdings, bei dem Versuche immer eindeutiger die Seinsgrundlagen des Gegebenen zu bestimmen, türmen sich neue Schwierigkeiten auf. Nun handelt es sich nicht mehr um das Realitätsproblem im allgemeinen, sondern um genaue Angabe dessen, was als real zu betrachten ist! Und hier setzt nun die Scheidung zwischen realem Subjekt und Wirklichkeit im engeren Sinne ein: Wirklichkeit, das ist das Ergebnis unserer skizzenhaften Ausführungen, ist der gesetzmäßig geordnete Inbegriff in Wechselwirkung stehender Gegenstande, deren Existenz (d. i. die Form des „wirklichen" Seins) letzten Endes nicht weiter begrifflich ableitbar, sondern, als durch das unmittelbar Gegebene bezeugt, einfach als tatsächlich anzuerkennen ist. Wirkliche Gegenstände sind beharrliche Einheitsgründe gesetzmäßigen Wirkens, gleichsam die Knotenpunkte im Netzwerk der Wirklichkeitsordnung. Als eines unter diesen Gegenständen finde ich nun auch mich. Zwar als „Ich" stehe ich stets allem andern in souveräner Subjektivität gegenüber. Aber ich konstatiere, auf mein Erleben reflektierend, das ,,ich" selbst real und als reales Wesen ein bedingtes Glied eines größeren realen Zusammenhanges (eben der Wirklichkeits- oder ,,Natur"-ordnung) bin. So entstehen nun für mich die brennenden Fragen: Welcher Inbegriff realer Gegenständlichkeit gehört zu mir, macht also mein reales Wesen aus? Und wie verhält sich dieser so aus dem Wirklichkeitsganzen herausgelöste und mit unserer Subjektivität enger in Beziehung tretende Inbegriff zu dem gleichfalls noch näher zu bestimmenden Wirklichkeitszusammenhang? Welche Stellung nimmt, anders ausgedrückt, unser reales Bewusstseinssubjekt innerhalb der Naturordnung ein? Auf diese Fragen will uns nun die Wirklichkeitserforschung Antwort geben, indem sie — nach den Gesichtspunkten einerseits des mit unserem Ich-Bewusstsein unlöslich Verbundenen und gesetzmäßig zu seiner Erklärung als Dauergrund Geforderten und anderseits des in der Umwelt zu konstatierenden Gesetzmäßigen und hier als beharrlich bestehend zu Ermittelnden — die Scheidung zwischen Subjektivem und Objektivem in realem Sinne immer genauer und eindeutiger zu vollziehen sich bemüht. Die Wirklichkeitserkenntnis können wir somit geradezu als eine nach Maßgabe der erworbenen Erfahrung immer feinere Sonderung dessen bezeichnen, was von der Basis des unmittelbar Gegebenen aus als subjektiv, mit meinem „Ich" real verbunden, und was als objektiv, meinem „Ich" selbständig gegenüberstehend, aufzufassen ist.
Dieser immer feiner und sorgfältiger zu gestaltenden Sonderung leistet nun unser reales Verflochtensein in den Wirklichkeitszusammenhang auf der einen Seite unschätzbare Dienste: Die Notwendigkeit, den auf uns unaufhörlich anstürmenden Einflüssen der Umwelt sich immer besser anzupassen, hält unser einmal gewecktes Wirklichkeitsinteresse in steter Erregung und wirft zugleich alle voreilig und einseitig konstruierten Erkenntnisgebäude unbarmherzig über den Haufen. So ist das durch jene Einflüsse ausgelöste Erleben das unerschöpfliche Korrektiv für jede Etappe unserer Erkenntnis des Wirklichen. Obwohl übrigens dieses Erkennen von vornherein im Dienste jener Sonderung steht, ist die Aufmerksamkeit des Betrachters der Wirklichkeit - entsprechend dem allmählichen Erwachen und Erstarken des Ich-Bewusstseins - nicht von Anfang an auf diese beiden Beziehungsglieder eingestellt. An einer Sichtung und Ordnung des von der Umwelt an uns Herantretenden, das, wie wir bereits wissen, ungestüm von uns einen praktischen Entscheid fordert, kräftigt sich unser selbständiges Denken; in der Orientierung innerhalb der uns umgebenden Lebensverhältnisse sehen wir unser nächstes Erkenntnisziel. Aber eben in dem Maße, als wir in der Umwelt uns zurechtfinden, und als wir lernen, die in ihr herrschende, in sich geschlossene Gesetzmäßigkeit zu beachten, schärft sich auch unser Blick für die Würdigung unserer Subjektivität, und zwar sind es die uns beunruhigenden Unstimmigkeiten zwischen dem, was wir in uns vorfinden und dem, was wir als beharrliche Ordnung an der Wirklichkeit bewundern, die den ersten Anstoß zu einer reinlichen Scheidung beider Gebiete geben, und jetzt beginnt jenes unaufhörliche Wechselspiel zwischen dem objektiven Eindruck und der subjektiven Einsicht, das nicht bloß zu einer Sonderung, sondern auch zu einer Bereicherung unserer Erkenntnis auf beiden Gebieten führt.
Auf der anderen Seite freilich kompliziert gerade jene unaufhörliche Wechselwirkung zwischen Bewusstseinssubjekt und realer Umwelt den Erkenntnisprozess in hohem Grade! Zunächst wird nämlich das rein theoretische Verhalten diesem Ordnungsproblem gegenüber durch die praktischen Interessen, die mit allem Wirklichkeitsgeschehen mehr oder minder eng stets verbunden sind, ungemein erschwert, ja, bei manchen Fragen, wie besonders bei den uns besonders nahe angehenden Anforderungen des Alltagslebens und bei den alle in gleicher Weise unmittelbar berührenden allgemeinsten Lebensfragen, eigentlich ganz unmöglich gemacht. Wir sind nur zu oft Partei, wo wir streng sachlich uns entscheiden sollen! So bleibt unserem Urteil meist ein Charakter der Bedingtheit eingeprägt, der die Allgemeingültigkeit unserer Erkenntnisakte naturgemäß beeinträchtigt.
Wichtiger noch ist eine weitere Erkenntnisschwierigkeit, die wir geradezu als die Quelle aller Hemmnisse für unsere Erkenntnisbetätigung bezeichnen können: Es ist die Verwicklung, die durch die Veränderlichkeit, das allmähliche Auswirken also, des Bewusstseinssubjekts einerseits und der übrigen Wirklichkeit anderseits verursacht wird. Das Ziel unserer Wirklichkeitserkenntnis, die sachlich bedingte und darum allgemeingiltige Erfassung dessen, was ist, besteht, genauer betrachtet, aus zwei Einzelzielen, nämlich aus einer scharfen Sonderung des Subjektiven und des Objektiven und aus einer eindeutigen Zuordnung der Glieder der Erkenntnisreihe einerseits und der sei es subjektiven sei es objektiven Wirklichkeitsreihe andrerseits; und von diesen beiden Einzelzielen ist die Zuordnung deswegen besonders zu betonen, weil nur vermittelst einer sachlich gerechtfertigten Zuordnung der beim Erkenntnisprozess beachteten Bestandteile die Sonderung zwischen Subjektivem und Objektivem überhaupt erst vollziehbar ist. Befanden sich nun die beiden Beziehungsglieder, Erkenntnissubjekt und Gegenstand, in vollständiger Ruhelage, so konnte, vorausgesetzt, dass beide Reihen sich vollständig deckten, die Zuordnung mühelos erzielt werden. Schwieriger wäre schon die Herstellung einer solchen eindeutigen Beziehung, wenn nur eines dieser beiden Glieder in steter Veränderung begriffen wäre. Man denke doch nur, um ein Beispiel aus dem Gebiete der sinnlichen Wahrnehmung anzuführen, wie schwer es uns fällt, ja, wie es ohne Zuhilfenahme sonstiger Erfahrungen eigentlich unmöglich ist, im Laufe über die Ordnung ruhender räumlicher Gegenstande sich zu orientieren. Nun kann man bereits ahnen, welche Schwierigkeiten unser Erkenntnisprozess zu überwinden hat, bei dem zwei, eigentlich drei variable Reihen in Betracht zu ziehen sind. Haben wir es doch beim Erkennen zunächst mit der Veränderlichkeit der subjektiven Erlebnisreihe und der objektiven Reihe zu tun, die wir gewöhnlich als „Wirklichkeit" im engern Sinne unserem realen Bewusstseinssubjekt gegenüberstellen, und kommt doch zu diesen zwei Variablen die Reihe des Erkenntnisprozesses hinzu, der, selbst eine Bewusstseinsfunktion, die Aufgabe hat, die Veränderungen jener Reihen in die Form allgemeingiltiger Urteile zu prägen, und diese Aufgabe nur in stetig fortschreitender Verbesserung, also in veränderlicher Form zu lösen vermag! Es liegt nahe angesichts dieser Schwierigkeiten, an einer eindeutigen, allgemeingiltigen und deshalb unveränderlichen Erkenntnis überhaupt zu verzweifeln, und unsere Urteilsakte mitsamt ihrer Giltigkeit mutlos dem Strome einer alles mit sich fortreißenden Veränderung zu überliefern. Es ist die Stimmung des modernen Relativismus, die wir damit angedeutet haben! Geht aber nun wirklich alle Erkenntnisgewissheit im Verlaufe des Erkenntnisprozesses unter? Ist es uns also nicht gegeben, zu festen, endgiltigen oder doch der Endgiltigkeit sich nähernden Erkenntnissen zu gelangen? Man könnte zur Widerlegung des Relativismus darauf hinweisen, dass er selbst doch auch wenigstens eine unerschütterliche Erkenntnis zu haben behaupte, eben die Einsicht in die alles beherrschende Relativität. Doch dürfte damit kaum der Kernpunkt des relativistischen Bedenkens getroffen werden. Man kann aber auch, — und das scheint uns zutreffender zu sein —, auf die tatsächlich feststellbaren Einsichten verweisen, an denen im Ernst keiner rüttelt, auf die unleugbaren Erfolge wissenschaftlichen Forschens und auf die Allgemeingiltigkeit und Folgerichtigkeit als das unentbehrliche Knochengerüst jedes wissenschaftlichen Systems. Aber auch mit dieser Antwort dürfte sich der Relativismus kaum für vollbefriedigt erklären: ohne weiteres wurde er die Einstimmigkeit und Solidität des Wissensaufbaues als notwendiges Erfordernis eines vollendeten Wissenssystems einräumen, aber, ob „Wissen" überhaupt erreichbar, ob die in ihm zu fordernde eindeutige Zuordnung unserer Erkenntnisse zu den ihnen entsprechenden Gegenständen überhaupt realisierbar ist, würde er nach wie vor bezweifeln. Mit den allgemeingiltigen Feststellungen, auf die wir als auf unerschütterliche Ansatzpunkte der Gewissheit hindeuteten, befänden wir uns, so wird er uns als echter Idealist entgegenhalten, immer nur im Bereich begrifflicher Konstruktionen. Die Zuordnung dieser Gebilde zu realen Entwicklungsphasen bleibe aber nach wie vor problematisch!
Aber eben die Möglichkeit begrifflicher Konstruktionen, deren Bedeutungsgehalt aus dem Strome der Veränderlichkeit sich erhebt, führt uns trotz aller Bedenken des Relativismus um einen wichtigen Schritt näher an das Ziel jener eindeutigen Zuordnung. In den Reihen des steten räumlichen Nebeneinander, des gleichförmigen Nacheinander, des auf den einzelnen Gebieten sachlich Verwandten, in dem Zählen und Gruppieren als den diese Reihenbildungen konstituierenden Funktionen haben wir uns - zwar von der Basis der Erfahrung aus ermittelte, aber ihrer Geltung nach über der Relativität der Erfahrung stehende - Ordnungen gebildet, die als „Invarianten" [1] die allmähliche Orientierung in den variablen Erfahrungsreihen und ihre wechselseitige eindeutige Zuordnung ermöglichen. Mag also auch diese Zuordnung selbst einer steten Vervollkommnung bedürftig sein und insofern unter dem Gesetz der Relativität stehen, - ein rettungsloses Versinken in diesem Strome verwehrt uns jener Inbegriff allmählich gefundener Invarianten, die als unerschütterliches Gerüst allem Erkennen, ja, allem Werten erst festen Halt geben. Dass es aber solche „Invarianten" gibt, darüber belehrt uns nicht nur die Reflexion auf den Wissensbetrieb, sondern die Evidenz jener „erfahrungsfreien" (apriorischen) Gesetzmäßigkeiten selbst. Auch der Relativist erkennt solche an: Er könnte von einer Relativität nicht sprechen, wenn er nicht im stande wäre, an der Hand eben dieser Invarianten sich über die Veränderlichkeit zu erheben.
Mit der Veränderlichkeit und dem nur allmählich fortschreitenden Sich-auswirken der Realität auf sämtlichen Erfahrungsgebieten hängt sofort eine weitere Unvollkommenheit unserer Erkenntnismöglichkeit zusammen: wir meinen die Begrenztheit des jeweils uns gegenwärtigen Wirklichkeitsausschnittes, der als Erfahrungsbasis für unsere Erkenntnisbetätigung uns zur Verfügung steht. Da wir nämlich, wie bereits angedeutet, als reale Subjekte nur sozusagen Knotenpunkte innerhalb der Maschen des Wirklichkeitsgeschehens sind, so wird von den Gegenständen und Veränderungen innerhalb der Wirklichkeit immer nur der uns näher liegende, auf uns unmittelbar einwirkende und darum uns besonders angehende Teil der Wirklichkeit von uns gesichtet und vornehmlich beachtet, und da ferner wegen der Variabilität der subjektiven wie der objektiven Wirklichkeitsreihe unsere Stellung zur Umwelt, zum Teil wenigstens, stetig eine andere wird, so wird dieser Wechsel uns nicht einmal diesen jeweils gegenwärtigen Teil scharf erfassen lassen. Eine glückliche Fügung sehen wir nun aber darin, dass innerhalb dieses Wechsels ein Teil der gegebenen Inhalte rascher, ein anderer Teil weniger rasch sich verändert, und dass anderseits im Verlaufe der Veränderung selbst Altbekanntes von neuem auftritt und so Stützpunkte gegeben sind für die Orientierung auch innerhalb des Neuen und Fremdartigen selbst. Unter diesen Umständen wirkt sogar der Wechsel selbst erkenntnisbereichernd: Durch die auf diesem Wege erlebbare Mannigfaltigkeit der „Wirklichkeitsausschnitte" wird eine Ergänzung und Korrektur der einzelnen Erlebnisphasen ermöglicht; das Wirkliche tritt uns im weiteren Umfange und vor allem von den verschiedensten Seiten, also gleichsam plastischer gegenüber, und das als das „eigentlich Wirkliche" Ermittelte wird nunmehr das sein, was als einheitlicher, widerspruchsfreier Daseinsgrund in den wechselnden Konstellationen eben die wechselnden „Ausschnitte" (Ansichten) zu liefern imstande ist. Das ist denn auch der methodische Gesichtspunkt, unter dem die Erfahrungswissenschaften sich bemühen, das „allgemeingiltig Wirkliche" festzustellen.
In hohem Maße scheint nun diese Korrektur und Ergänzung dadurch gefordert zu werden, dass unser nach den Einheitsgründen des Wirklichen forschender Blick innerhalb der Wirklichkeit eine Mannigfaltigkeit uns gleichgearteter Subjekte vorfindet: Da ein jedes dieser Subjekte seinen eigenen Schatz von Erfahrungen hat, so steigt die Zahl der so im Erleben erfassbaren und dem ordnenden Erkennen erreichbaren Wirklichkeitsausschnitte ins Unübersehbare. Wie können sich da die einzelnen Subjekte durch wechselseitigen Austausch der Erfahrungen bei ihrer Arbeit an der steten Erweiterung des geistigen Horizontes und an der Verfeinerung der in der Erkenntnis festgestellten Beziehungen untereinander unterstützen! In der Tat, dieser Austausch der Erfahrungen ist eines der wichtigsten Hilfsmittel unseres Wissensbetriebes: Nicht der Einzelne, sondern die Menschheit als Ganzes arbeitet im Laufe der Jahrtausende an der Ausgestaltung des Erkenntnisgebäudes!
Man übersehe indes in allzu großem Optimismus nicht, dass mit der Zahl der Bewusstseinssubjekte die mit der Variabilität der zu einander in Beziehung zu setzenden Reihen gegebene Schwierigkeit nur vergrößert wird: Jetzt haben wir ja auf einmal so viele variable Reihen, als es subjektive „Brennpunkte" in der Wirklichkeit gibt! Eine jede dieser subjektiven Erlebnis- und Erkenntnisreihen weicht zudem auf unberechenbare Weise derart von den übrigen ab, das die Grundbedingung aller eindeutigen Zuordnung, die Feststellung des Zuzuordnenden, also hier das Verständnis des von andern Erlebten bezw. Erkannten, fast unmöglich zu erfüllen ist. Man werfe doch nur einen flüchtigen Blick auf die vielen, einander mehr oder minder zufällig durchkreuzenden Faktoren, die zum Aufbau der Erfahrung im konkreten Einzelsubjekt bestimmend mitwirken! Zu den wichtigsten von diesen Faktoren gehören Verschiedenartigkeit der ererbten Anlage, Eigenart der Umgebung, in der man aufwächst, und der Geschicke, die den Einzelnen von frühester Jugend an beeinflussen, Bereicherung der Erfahrung durch Überlieferung (Lernen) und ihre verschiedenartige Aneignung (harmonische Einordnung in den übrigen Erfahrungsbestand), durch Lücken in der Erfahrung oder durch Unreife, Oberflächlichkeit und Energielosigkeit veranlaßte Vorurteile, die einer trüben Schlammdecke vergleichbar im Einzelbewußtsein sich ansammeln, und damit zusammenhängend üble Angewöhnungen in der gesamten psychischen Haltung des Subjekts, die u. a. auch eine affektive Schwächung und Trübung der Erkenntnisbetätigung, also der sachlichen Ordnung des Erfahrungsschatzes zur Folge haben.
Wenn wir nun trotz alledem das fremde Subjekt und seine Erfahrung “verstehen” (vgl. Benno Enlmann, Erkennen u. Verstehen, Sitz.-Ber. der Berl. Akad. d. Wiss. 1912, 53. S. 1240 ff) wollen, so müssen wir eben versuchen, all diese Faktoren, indem wir sie in ihrer konkreten Wechselwirkung würdigen, in Anschlag zu bringen. Nur auf diese Weise können wir das irgendwie zum Ausdruck gebrachte Erleben des fremden Einzelsubjekts in seinem Werden und in seiner subjektiven Bedingtheit fixieren, und nur vermöge dieser Feststellung können wir dann daran denken, die so “verstandenen” Einzelreihen in den eindeutigen Erkenntniszusammenhang einzuordnen.
Dieses “Verstehen” der fremden Subjekte setzt nun einerseits die Fähigkeit voraus, sich kongenial in die verschiedenartige subjektive Eigenart “einzufühlen” und in dem so ermittelten Eigengesetz des fremden seelischen Lebens gewissermaßen den Kristallisationspunkt zu finden, um den sich die Eigenschaften, Erlebnisse und Betätigungen gruppieren; anderseits ist dazu erforderlich, die “Äußerungen” der Subjekte exakt zu bestimmen und aus ihnen — unter Berücksichtigung der subjektiven Ausdrucksfähigkeit und des in concreto schwer zu erfassenden Ausdruckswillens — ihren “Sinn”, das von dem sich Äußernden “Gemeinte” herauszuschälen. Ursprünglich vollzieht sich freilich auch dieser Erkenntnisprozess, das “Verstehen” sozusagen “von selbst”: Einer glücklichen Veranlagung unserer seelischen Natur zufolge “verstehen” wir, wenn auch vorerst nur obenhin, was in den fremden Einzelsubjekten vorgeht. Aber dieses “Verstehen”, das den Anknüpfungspunkt für alle Beziehungen von Mensch zu Mensch bildet, muss von allem störenden Beiwerk gereinigt und durch intuitives Sich-Hineinversenken wie durch kritisch vorsichtige Feststellung der Tatbestände vertieft werden. Auch hierbei wirkt die organische Einheit und Wechselbeziehung der Erkenntnisfunktionen in uns fordernd mit: Sowohl die Exaktheit, mit der die Naturwissenschaften die Vorgänge der Wirklichkeit und ihre Gesetzmäßigkeiten zu bestimmen bestrebt sind, wie die fortgesetzte Klärung und Verselbständigung des Bewusstseins-Ichs schärfen unseren Blick für das Verstehen fremden Seelenlebens, wie sie anderseits von den vermittelst dieses Verständnisses hergestellten Rekonstruktionen des Erlebens und Erkennens fremder Subjekte neues Licht und vielseitige Anregung empfangen.
Die bisher betrachteten Ordnungen, in die sich die eine Wirklichkeit vor unserem analysierenden Geistesblick zerlegt hat, nämlich die variable Wirklichkeit im engeren Sinne, die variable eigene Erlebnis- und Erkenntnisreihe und die variablen Erlebnis- und Erkenntnisreihen (unzählig vieler) fremder Subjekte, sind indes nicht die einzigen, in der Erfahrung vorfindlichen “Wirklichkeits”-Bezirke: Durch die Wechselwirkung der genannten Ordnungen bauen sich vielmehr auf dem Unterbau der Natur neue Inbegriffe von Tatbeständen auf, die sämtlich den Stempel subjektiver Betätigungen an sich tragen und darum der “schlichten” Natur als Kultur d. h. als eine von Subjekten zu subjektiv ausgewählten Zwecken bearbeitete Natur gegenübergestellt werden. Wenn wir übrigens von dem “subjektiven” Einschlag dieser neuen Ordnung (der Kultur) reden, so darf dabei durchaus nicht an etwas “Zufälliges”, “Nebensächliches” oder gar “Störendes” gedacht werden. Der subjektive Faktor gehört vielmehr zu den konstituierenden Merkmalen der Kultur: wir meinen damit den kausalen Beitrag, den die Einzelsubjekte zum Aufbau dieser sie als etwas Überindividuelles überragenden Ordnung liefern; und eben wegen dieser Überindividualität der Kultur können wir sie mit Hegel als Niederschlag des “objektiven Geistes” bezeichnen, sofern wir nur, damit allerdings von Hegel abweichend, unter dem “objektiven Geiste” den Inbegriff der einander wechselweise bedingenden und dadurch eben kulturell sich betätigenden Einzelsubjekte verstehen.
Bei näherem Zusehen zerfällt nun die Kultur selbst in eine Fülle von Einzelordnungen, je nach den Richtungen eben, in denen der Geist die Bearbeitung und Beherrschung der Natur unternimmt. Auch auf diesem Gebiete erwächst somit für den Forscher die Aufgabe, die Einzelbezirke scharf abzugrenzen und sie in ihrer eigenen Gliederung zu betrachten, um daraufhin ihr Wechselverhältnis eindeutig zu bestimmen. Aber diese eindeutige Bestimmung, die wir auf allen Gebieten als das eigentliche Erkenntnisziel begriffen, hat auch auf dem Kulturgebiete mit der sie so ungemein erschwerenden Variabilität der einzelnen Reihen zu rechnen. Ja, die Variabilität der Kulturprodukte birgt die neue, ihnen allein eigentümliche Schwierigkeit in sich, dass durch das Zusammenarbeiten vieler Einzelsubjekte an ihrer Herstellung die Einheitlichkeit und Stetigkeit ihres Entwicklungsprozesses gefährdet wird: Scheint doch eine sinnvolle Eigengesetzlichkeit der Gesamtkultur ebenso unmöglich zu sein, als sich ein künstlerisches Mosaikbild aus zufällig zusammengesetzten Steinen herstellen ließe!
Wenn man nun gleichwohl nach einem derartig sinnvollen, einheitlichen Kulturzusammenhange forscht, so kann dieser Versuch nur Erfolg versprechen, sofern man auch hier, wie bei der Beziehung von Einzelsubjekt einerseits und Wirklichkeit anderseits Invarianten feststellt, also ein festes Gerüst von Beziehungen, die erfahrungsfrei, also den Zufälligkeiten der Veränderung entrückt, uns eine unerschütterliche Basis liefern, von der wir sowohl die empirischen Beziehungen von Subjekt zu Subjekt, wie die ebenso variablen Verhältnisse von einer Kulturreihe zur anderen und von einer Kulturphase zur anderen gegeneinander abwägen und einander zweifelsfrei zuordnen können. So springt uns auch hier wiederum die Unentbehrlichkeit des apriorischen, übersubjektiven Ordnungsmaßstabes in die Augen: Nur sofern ich mir vergegenwärtigen kann, in welche möglichen Wechselbeziehungen Subjekte zueinander treten können, und inwiefern Kulturreihen und Kulturperioden a priori bestimmbar sind, bekomme ich auch durchsichtige Klarheit bei der Feststellung und Abschätzung empirischer Tatbestände der kulturellen Entwicklung, bei der Ermittelung der in diesen Tatbeständen wirksamen Faktoren und der ihre Wirksamkeit beherrschenden Gesetzmäßigkeiten. Das apriorische Element, die zu konstruierende „Invariante" spielt somit bei der Erforschung des Kulturlebens eine ebenso wichtige Rolle, wie bei der Beziehung des variablen Subjekts zur variablen Natur.
Das Erkennen auf sämtlichen Wirklichkeitsgebieten kann darum einer apriorischen Grundlegung nicht entraten, und je allseitiger ausgebaut und zugleich einheitlich geschlossener der so gefundene Inbegriff von Invarianten ist, um so vollendeter ist der an ihnen sich orientierende Erkenntnisprozeß einer Periode. Man wende nicht ein, daß die Erfahrungserkenntnis diesen apriorischen Konstruktionen vorausgehe und somit bei ihrer Orientierung innerhalb des Gegebenen augenscheinlich dieser erfahrungsfreien Systematisierung der Invarianten nicht bedürfe! So unbezweifelbar es nämlich ist, daß wir in den Anfangsstadien der Erkenntnisgewinnung instinktiv das „Richtige" bei der Ordnung des Gegebenen treffen, so wenig können wir auf dieser Entwicklungsstufe von„Erkenntnissen" im strengen Sinne sprechen. Diese Erkenntnisse liegen erst dort vor, wo man sich über die eigentliche Gliederung und Grundlegung des Wissens auf den einzelnen Gebieten Rechenschaft zu geben vermag, und eben diese Rechenschaftsablegung, also ein zielbewußtes, einsichtiges und alles seiner sachlichen Bestimmtheit nach wertendes Erkennen ist ohne Konstruktion jener apriorischen „Strebepfeiler" des Wissensgebäudes nicht realisierbar.
Die Apriorität dieses Invariantensystems wird übrigens keineswegs durch die Tatsache in Frage gestellt, dass die Anregung zu ihrer Konstruktion stets von der Erfahrung gegeben wird: Nicht die Invarianten selbst werden ja dadurch zu Erfahrungsprodukten; es ist vielmehr nur unser einer Bereicherung und Vertiefung immer zugänglicher Begriff von ihnen, der, wie jede unserer Leistungen, von dem Erleben abhängig bleibt. Die in den Invarianten uns zum Bewusstsein kommende ideale Gesetzmäßigkeit entsteht also selbst nicht, sie ist und bleibt überzeitlich und erfahrungsfrei, aber sie wird von uns nur allmählich entdeckt und als unerschütterliche Grundlage aller Erfahrungserkenntnis gewertet, wie denn ja auch bei einem Gebäude die Fundamente, auf denen es ruht, nicht unmittelbar beobachtet, sondern nur allmählich bloßgelegt werden!
Wir kommen somit zu folgendem Ergebnis: Die Erkenntnisbeziehung zwischen Bewusstseinssubjekt einerseits und Umwelt anderseits ist äußerst verwickelt, weil bei ihr unzählig viele, nicht unmittelbar durchsichtige und vor allem variable Faktoren in Frage kommen. Die Gewinnung der Wirklichkeitserkenntnis zerspaltet sich somit in mannigfach sich durchkreuzende und wechselseitig einander beeinflussende Einzelprozesse. Vollständig gerecht kann unser Forschen der Wirklichkeit nur werden, wenn es die komplizierte Bedingtheit und Veränderlichkeit der einzelnen Faktoren sorgfältig im Auge behält und die darin enthaltenen Hemmnisse für die Gewinnung allgemeingiltiger Erkenntnisse durch stete Orientierung an dem überindividuellen, den Strom der Erfahrung überragenden Invariantensystem (vgl. Platos Ideen!) zu überwinden trachtet. Wie die Analyse des Erkenntnissubjekts (I) dem empirischen „Ich'' das „reine" Ich, dem Subjektivismus die Autonomie als Norm und Ideal gegenüberstellte, so hat die Analyse der Beziehungen, in die das empirische Subjekt sich verwickelt findet (II), dem Einzelsubjekt die Umwelt mit vielen gleichgearteten Subjekten und der Relativität der konkreten Wechselverhältnisse und Wechselwirkungen die absolute Reinheit des idealen Grundgerüstes von Beziehungen entgegengesetzt und dieses ideale Invariantensystem zugleich als einzig zuverlässige Basis aller Erkenntnisbetätigung erwiesen. Die Idealität dieses Systems allgemeingiltiger Beziehungen bringt es in einen besonders engen Zusammenhang, ja, in ein Abhängigkeitsverhältnis zum autonomen, „reinen" Ich, da „ideale Geltung" immer „Geltung für ein Subjekt" besagt. So schließt sich das Ergebnis des ersten und des zweiten Abschnittes zu einer inneren Einheit zusammen.
III. Empirisches und absolutes Subjekt
Superior enim eram
istis, te (Deo) vero in
ferior, ... et tu mihi
subieceras, quae infra
me creasti.
S. Aug. Conf. VII. 7.
Das Erkennen definierten wir eingangs als selbständiges und zugleich sachlich bedingtes Ordnen der zu erfassenden Gegenstande. Die Selbständigkeit des Erkenntnisaktes erschien uns am besten in dem überempirischen Ideal des autonomen Subjekts gewahrt, und das sachlich bedingte Ordnen des Gegebenen führte uns zu unveränderlichen Ordnungssystemen (Invarianten), die allein dem nach festen Beziehungspunkten innerhalb des Variablen suchenden Blick sicher die Richtung zu weisen vermögen. So erschien uns das Erlebnis-Ich und auch das ihm zu grunde liegende empirische Subjekt in mehr als einer Hinsicht unfähig, letzter und einziger Bestimmungsgrund und Maßstab der Erkenntnis zu sein. Der Subjektivismus in seiner landläufigen Form ist hiermit gerichtet: Das jeweilige Erlebnis-Ich ist eben nur eine Phase in der Entwicklung des realen Subjekts, und dieses so sich allmählich auswirkende Subjekt selbst ist nach allen Seiten mit unzähligen Fäden an die einzelnen Wirklichkeitsordnungen geknüpft, eine Bedingtheit, die der vom Subjektivismus angemaßten Selbstherrlichkeit radikal widerspricht.
Jene idealen Beziehungspunkte allerdings, die uns in den Stand setzen, uns über die Bedingtheit zu erheben, sind selbst zunächst Gebilde des empirischen Subjekts, und es erschien uns sogar als charakteristisches Merkmal unserer geistigen Würde, daß wir das Ideal der Autonomie und die Idee des Invariantensystems selbständig konzipieren können. Ist nun damit nicht der krasseste Subjektivismus durch eine Hinterpforte wieder hereingelassen? Um dieses schwerwiegende Bedenken zu beseitigen, müssen wir genauer feststellen, was wir mit jenen apriorischen Konstruktionen eigentlich bezwecken, und was unter ihrer „idealen", „überempirischen" Geltung zu verstehen ist.
Die Vergegenständlichung des zu Erforschenden, welche uns als die unerlässliche Vorbedingung des eigentlichen Erkenntnisprozesses erschien, gelingt uns um so mehr, je mehr wir uns aus den wechselnden Komplikationen der in stetem Flusse befindlichen Erfahrung zu retten vermögen. Indem wir nun zu diesem Zwecke einzelne Fäden aus dieser konkreten Verwicklung herauslösen und sie dann für sich d. h. ohne weiteren Appell an die Erfahrung zergliedernd betrachten, gehen wir zwar von der Erfahrung aus, aber wir halten uns nicht sklavisch an ihren Verlauf, wir ziehen gleichsam die in ihr vorfindlichen Linien rein aus und erhalten so die Möglichkeit, innerhalb der Erfahrung das festzustellen, was sich lediglich aus dem uns vorliegenden Gegenstande ergibt, und was ihm durch störende Einflüsse sozusagen aufoktroyiert ist. Auf diese Weise gibt uns der Begriff des autonomen Subjekts oder auch (was dasselbe besagt) des „Bewußtseins überhaupt" Aufschluß über die wesentliche Struktur des Subjekts, und er schärft damit unseren Blick für alles, was den Subjektscharakter nicht voll zur Geltung kommen last. Ebenso vermittelt uns der Begriff des „reinen Raumes", - um eine gegenständliche Invariante als Beispiel anzuführen -, die Einsicht in den Stetigkeitscharakter und in das Richtungsgerüst (Koordinatensystem) per Ausdehnung, so daß der ursprüngliche Wirrwarr der konkreten ausgedehnten Dinge sich auf einmal klärt und so allmählich als übersichtliche Ordnung erscheint. Die apriorische Konstruktion, so können wir nunmehr abschließend sagen, „stilisiert" die in der Erfahrung gegebenen Merkmale und bringt so die ihnen eigentümliche Natur uneingeschränkt zur Geltung.
Dieses „Stilisieren", das für gewöhnlich auch als „Idealisieren" bezeichnet wird, ist nun, obwohl im empirischen Einzelsubjekt unternommen, von überindividueller Geltung: Wir sind mit unmittelbarer Einsicht in den Sachverhalt gewiß, daß die von uns gefundenen apriorischen Bestimmungen von jedem, der sie nachzudenken fähig ist, in gleicher Weise entdeckt werden müssen. Unsere begrifflichen Konstruktionen sind also nicht auf unsere Subjektsphäre eingeengt; sie fordern und finden Anerkennung bei allen sie verstehenden Subjekten. Dieser auf den ersten Blick frappierende Charakter der Allgemeingiltigkeit, der allen Idealbegriffen und Idealgesetzen eignet, und der sich dann auch in der Konsequenz verrät, mit der diese allgemeingiltige Gesetzlichkeit in allen Variationen der Elemente (man denke z. B. an die verschiedenartigen, von einer einheitlichen Gesetzmäßigkeit beherrschten arithmetischen Funktionen!) sich äußert, hat zu der geistvoll-paradoxen Bemerkung Lichtenbergs (Vermischte Schriften S. 70, 99. citiert bei A. Drews, das Ich als Grundproblem der Metaphysik 1897, S. 146) geführt: „Es denkt, müßte man sagen, wie man sagt: es blitzt."
Wir wollen nun zwar diese Paradoxie nicht unterschreiben, da das Denken als Subjektsfunktion nach unserer Überzeugung immer auf ein Wesen zurückweist, das sich seiner „Ichheit" bewußt ist. So viel freilich müssen wir Lichtenberg's Ansicht zugeben: Das „Ich" des Denkers muß eben wegen seines allgemeingiltigen, überindividuellen Charakters als „reines", von aller individuellen Beschränkung befreites „Ich" gedacht werden, als qualitätsloser Beziehungspunkt, der in allen empirischen Subjekten in gleicherweise zur Geltung kommt und darum den auf ihn bezogenen Denkinhalten den Rang der Allgemeingiltigkeit verbürgt. So ragt das Gedachte, wiewohl auf empirisch-subjektivem Boden erwachsen, seiner Bedeutung nach in ein allen Erfahrungsschwankungen entrücktes Reich hinein, das als Subjekt-Korrelat, dessen es wegen seiner Idealität vor dem Forum unseres Denkens bedarf, nicht mehr das empirische Einzel-Ich, sondern das zunächst nur abstrakt zu fassende „Ideal-Ich" fordert: Aus der exzentrischen Stellung, in der wir uns wegen unserer individuellen Beschränktheit und Variabilität dem Wirklichkeitsganzen gegenüber befinden, erscheint uns das Weltgeschehen nur im lückenhaften Ausschnitt und in unübersichtlichen Komplikationen. Um diese Verwicklung zu entwirren, um die individuellen Ausschnitte zu ergänzen und die in ihrer undurchsichtigen Tatsächlichkeit uns gegenübertretenden Vorgänge auf allgemeingiltige Gesetzmäßigkeiten und eindeutige Zusammenhänge zurückzuführen, beziehen wir eben unsere Erkenntnisfragmente auf ein vorerst ideell konstruiertes „Bewußtsein überhaupt", das uns den absolut ruhenden Mittelpunkt alles Wissens und das ebenso festgefügte Gerüst (Invariantensystem) aller Erkenntnisfunktionen repräsentiert, und dadurch wird uns die Möglichkeit geboten, „unser" Wissen von allem störenden individuellen Beiwerk zu reinigen und so uns „der" Wissenschaft anzunähern, die als das endgiltige, alles erschöpfende Erkennen von seiten jenes Idealbewußtseins gedacht wird.
Genügt nun aber zur allseitigen Begründung unseres auf Allgemeingiltigkeit Anspruch erhebenden Erkennens das logische Postulat eines rein „idealen" Ich's, als dessen ebenfalls „ideale" Struktur eben das Invariantensystem des gesamten Wissens anzusehen wäre?
Solange man lediglich „das" Wissen und „die" Wissenschaft ins Auge faßt, liegt es nahe, mit Kant und den Neukantianern den Hinweis auf das „Bewußtsein überhaupt" und auf dessen rationale „Setzungen“ als hinreichende Erklärung für die Allgemeingiltigkeit der Erkenntnis anzusehen. Das Wissensgebäude ruht ja, als ideelles System, in sich selbst; der seinen Ausbau leitende Grundgedanke ist die Forderung, restlos einsichtig und streng notwendig alles Wissen aus evidenten Grundlagen abzuleiten; der Ausblick auf eine dem Erkennen vorangehende, also „denkfremde" Wirklichkeit erscheint demnach als ein den Rahmen „der" Wissenschaft sprengender Fehlschluß.
„Die" Wissenschaft ist aber eben ein Ideal. Jene restlos einsichtige, ja, eigentlich schöpferische Ableitung des Erkennens aus letzten rationalen Grundsätzen ist darum wohl ein stets uns vorschwebendes Ziel, — die Pfade, die jenem Ziele uns annähern, sind indes damit nicht festgelegt; sie richten sich nach „unseren" Anlagen und nach dem „uns" zur Verfügung stehenden Material.
„Unser" Wissen ist bedingt, wie wir selbst: Indem es sich auf das Erleben stützt und nur unter steter Rücksichtnahme auf dieses Erleben den in diesem sich kundgebenden gesetzmäßigen Zusammenhang nachzukonstruieren sucht, ist es selbst ein „realer" Prozeß, wie das Erleben; es „schafft" nicht die Grundlagen des Erkennens, sondern es „entdeckt" sie; es „findet" die Einzeltatsache „vor", aber es „erdichtet" sie nicht, und wenn es das so anerkannte Einzelne zu erkennen, also aus letzten Grundlagen abzuleiten sucht, so ist es sich gleichwohl der mit seiner Naturbedingtheit gegebenen Grenzen jener Ableitbarkeit wohlbewußt.
Wenn nun aber unser Forschen und Erkennen selbst in dem wechselseitig abhängigen Wirklichkeitszusammenhange steht, dann kann zu seiner vollständigen Begründung die Konstruktion eines idealen Subjekts mit einer gleichfalls lediglich idealen Struktur von gedanklichen Setzungen nicht genügen. Als realer und stetig zu realisierender Prozeß muß vielmehr unser Erkennen auch auf reale Gründe zurückgeführt werden. Sollten wir bei dem Versuche dieser Begründung nicht in jeder Hinsicht rationale Durchsichtigkeit erreichen, so würde dieses Hinausgeführtwerden aus den starren Schranken des idealen Wissensdomes den Vorwurf des Fehlschlusses solange nicht zureichend begründen, als wir uns auf solider Erfahrungsbasis unter steter kritischer Selbstkontrolle bei unseren „Denkschritten" vorsichtig fortbewegen. Etwaige Dunkelheiten müssen wir als unausweichlichen Tribut unserer Bedingtheit betrachten!
Durch die Feststellung, daß die Allgemeingiltigkeit unseres Erkennens nicht bloß ihrer idealen Bedeutung nach, sondern vor allem ihrer Realisierbarkeit nach für uns ein Problem sein muß, eröffnet sich unserem kritisch sondierenden Geistesblick gleichsam eine neue Dimension des Erkenntnisgebäudes. Drei Fragen drängen sich uns hierbei besonders auf: I. Woher die Harmonie zwischen unserem Wissen und dem von uns unabhängigen, „für sich" existierenden und sich verändernden realen Erkenntnisgegenstand? 2. Wie kann ferner der ideale Gehalt bestimmend auf Reales einwirken? 3. Und wenn zur befriedigenden Beantwortung dieser Fragen auf ein absolutes (nicht bloß abstraktes!), zugleich ideales und reales Subjekt (auf Gott) zurückgegriffen werden muß, — welche Folgerungen ergeben sich dann daraus für uns, die empirischen, bedingten Erkenntnissubjekte?
I. Die Harmonie zwischen Wissen und Sein, die glückliche Fügung also, die es ermöglicht, daß das seinen eigenen Gesetzen folgende Sein von der Gesetzmäßigkeit des Erkennens erfaßt werden kann, und daß auf Grund dieses Erfassens für das Sein zutreffende Vorausberechnungen des Erkenntnissubjekts möglich sind, ist das eigentliche Grundrätsel der Stellung dieses Subjekts zur Wirklichkeit. Wenn man nämlich auch eine Kluft zwischen Subjekt und Objekt nicht annimmt, wenn man sich vielmehr mit uns begnügt, Erkenntnissubjekt und reales Objekt zu unterscheiden, ohne diesen Unterschied, durchaus unbegründet, zur unüberbrückbaren Kluft zu erweitern, — wer bürgt uns doch dafür, daß das Erkenntnissubjekt mit seinen Erkenntnissen dem eigentlichen Gehalte der Wirklichkeit und seiner z. T. noch im Schoße der Zukunft ruhenden Entwicklung gerecht zu werden vermag? Wir glauben hiermit die tiefste Wurzel des Subjektivismus bloßgelegt zu haben: Immer wieder beruft er sich auf die allzu schmale Erfahrungsbasis, von der aus wir allgemeingiltige Erkenntnisse über Wirkliches und sich stetig Entwickelndes gewinnen zu können glauben. Der transzendentale Idealismus macht sich nun die Lösung dieses Rätsels verhältnismäßig leicht: indem er die Erfaßbarkeit der „Dinge an sich" leugnet, schränkt er eben die auch von ihm postulierte Allgemeingiltigkeit des Erkennens auf das einsichtig in sich ruhende und durch Setzungen des Erkenntnissubjekts festgefügte Wissenssystem ein. Unter dieser Voraussetzung hat allerdings die Frage nach jener Harmonie keinen Sinn! Und doch drängt sie sich uns auf! Wir können uns deshalb — angesichts des in unserem Erleben uns unmittelbar Gegebenen – nicht mit der idealistischen Einengung der Erkenntnisbedeutung begnügen: Die Erkenntnis ist nicht bloß ein notwendig geordnetes und lückenlos einsichtig ableitbares System; eine wesentliche Aufgabe des Erkennens ist und bleibt vielmehr nach unserer Auffassung die stetig zu vervollkommnende Erfassung und Begründung des Wirklichen. Das Problem der Harmonisierung des Wissens mit dem Sein tritt auf diesem nüchternen, den Tatsachen allein entsprechenden Standpunkt schärfer, denn je, in den Vordergrund, und die durch dieses Problem motivierte subjektivistische Skepsis läßt sich nun endgiltig nur beseitigen durch die grundsätzliche und konsequent bis ins Einzelne hinein durchgeführte Fundierung der Erkenntnisordnung einerseits und der Seinsordnung anderseits in einem beides in gleicher Weise bedingenden und normierenden Grunde. Da wir nun diesen Grund bei der Analyse des Wissenssystems in dem „reinen" idealen Subjekt mit seiner idealen Struktur gefunden haben, so müssen wir eben zum Behufe einer einheitlichen Fundierung von Wissen und Sein von der Realität jenes idealen Subjekts überzeugt sein: Der Grund für beide Ordnungen, der uns deshalb die Möglichkeit, beide Reihen einander eindeutig zuzuordnen, erklärt, ist also das absolute, real-ideale Subjekt (Gott). — Man wende demgegenüber von idealistischer Seite nicht ein, daß dieser „real-ideale" Grund doch selbst nur eine gedankliche Konzeption, also ein rein ideales Gebilde sei! Denn diese Idealität betrifft nur den Begriff von jenem „real-idealen" Wesen; daß wir aber diesem Gedankengebilde reale Bedeutung zuschreiben, beruht eben auf dem von uns oben erwähnten Wirklichkeitskriterium, wonach alles, was erlebt wird oder zur vollbefriedigenden Begründung des Erlebten erschlossen werden muß, als real anzusprechen ist. So hängt unsere Überzeugung vom Dasein Gottes letzten Endes von unserem Erleben ab, während sein Dasein selbst absolut, also von allem außer ihm Liegenden unabhängig ist.
2. Die Divergenz zwischen Idealität des Erkennens und Realität des Seins, zwischen „intelligiblem" Gesetz und „brutaler" Tatsache ist somit prinzipiell beseitigt. Es handelt sich aber bei näherem Zusehen nicht bloß um eine harmonische Zuordnung beider Reihen, sondern um die eigenartige Wechselbeziehung, die zwischen ihnen besteht, um die Tatsache, daß durch reale Verläufe ideale Zusammenhänge hergestellt werden, und daß anderseits ideale Gesetzmäßigkeiten bestimmend auf reale Verläufe einwirken: Wir haben jetzt nicht die stetige, sinnvolle Ordnung der Naturgesetzlichkeit im Auge, die als letzter Stützpunkt aller Erfaßbarkeit des Wirklichen eben jene harmonische Zuordnung von Wissen und Sein grundsätzlich ermöglicht. Wir denken hier vielmehr an die von Fall zu Fall sich ändernde und sich stetig erneuernde konkrete Hervorbringung von Sinnvollem, also Idealem durch scheinbar regellos mit einander wirkende Faktoren und die eben damit gegebene Determination konkreter realer Vorgänge durch Ideales. Bereits auf dem Gebiete der Lebenserscheinungen haben wir dieses wunderbare Ineinandergreifen von Realem und Idealem zu konstatieren: Die wirkursächlichen Faktoren, die zur Entstehung und Erhaltung des Lebewesens ihren Beitrag zu liefern haben, stehen sämtlich unter der starren Gesetzmäßigkeit der anorganischen Natur; aber diese allein genügt nicht, um uns das aus der „zufälligen" Komplikation dieser Faktoren entstehende und in ihr sich erhaltende organische Gebilde in seinem immanenten Zweckzusammenhang zu erklären. Hier spielt unfraglich ein den realen Verlauf richtunggebend bestimmender idealer Faktor mit; und das Staunenswerte besteht nun darin, daß er auf dieselben realen Faktoren determinierend einwirkt, denen er die Realisierung des in ihm ideell Angelegten verdankt!
Dieselbe Beeinflussung realer Ereignisreihen durch ideale Gesetze finden wir nun auch innerhalb der Kulturentwicklung der Menschheit. Wenn wir nämlich den Kulturprozeß als die fortgesetzte Bearbeitung der Natur zur Realisierung der von Menschen selbständig gesetzten Zwecke definieren, so fällt uns auf, daß die Kulturentwicklung in einer Abfolge von Perioden verläuft, die unter einander in einer sinnvollen Abhängigkeit stehen und so trotz aller Zwischenfälle einen im großen und ganzen einheitlichen, logisch begreiflichen Charakter zeigen; und doch sind es, die Jahrtausende hindurch, unzählige, verschieden veranlagte und mannigfach praktisch interessierte Subjekte, die z. T. in ganz „zufälligen" Konstellationen an der Kultivierung der Natur arbeiten! Zeigt sich darin nicht besonders deutlich die Herrschaft der Ideen, die — allerdings meist durch das Medium der empirischen Subjekte — dem realen Kulturprozeß trotz des Wechsels der Generationen inneren Halt und fruchtbare Triebkraft gewähren? Was man als „Logik der Tatsachen" der subjektiven Willkür gegenüberstellt, findet hier in dem Bereiche der Kulturarbeit sein besonderes Anwendungsgebiet. Wenn wir übrigens diese „Logik der Tatsachen", die uns einen besonders deutlichen Beweis für das reale Walten eines überempirischen Subjekts zu liefern scheint, nicht bis ins Einzelne hinein verfolgen können, so liegt es eben an der Komplikation der empirischen Vorgänge, zu deren übersichtlicher Beherrschung wir als bedingte, innerhalb der Erfahrungswirklichkeit stehende Subjekte, nicht die genügende Distanz gewinnen können.
Was wir im Großen in der organischen Natur und im Kulturprozeß der Menschheit vorfanden, das können wir sozusagen mit Händen greifen, wenn wir die „Kleinwelt" unseres Innenlebens betrachten: Macht es die geistige Würde unserer Natur aus, daß wir uns aus dem Strom der Erlebnisse gerade vermittelst der in ihnen wirkenden realen Faktoren zur Konzeption idealer Gedankengebilde aufschwingen können, so hat uns anderseits vor allem die Analyse des Ich-Begriffs (I) gezeigt, wie diese idealen Gebilde als wirkungskräftige Ziele auf die Auswirkung und einheitliche Durchgestaltung der realen Subjektsnatur Einfluß gewinnen können. Im übrigen belehrt uns die Reflexion auf unseren realen Begriffsbildungsprozeß zur Genüge darüber, wie bedeutsam die determinierende Einwirkung idealer Gesetzmäßigkeiten auf die reale Gedankenbewegung und Gedankenverknüpfung ist. Im gewöhnlichen Leben erscheint uns freilich diese Wechselbeziehung des Idealen und Realen in unserem Innern als selbstverständlich. Sobald wir uns aber den Unterschied zwischen idealem Gelten und realem Existieren klar gemacht und zugleich vergegenwärtigt haben, welche realen Faktoren bei der Erkenntnisbetätigung im Spiele sind, dann dürfte uns die Rätselhaftigkeit dieses Verhältnisses einleuchten, zumal der Einfluß des „Idealen" keineswegs ungehemmt, „von selbst" erfolgt, sondern sich erst energisch durchsetzen muß. Die einfach als tatsächlich anzuerkennende Möglichkeit dieser Wechselbeziehung können wir uns nur aus einer ursprünglichen Veranlagung unserer Subjektsnatur, die wir eben als Geistigkeit bezeichnen, verständlich machen. Diese „subjektive" Geistigkeit weist aber, wie jener „objektive" geistige Gehalt in Natur und Kultur, zurück auf das sie real begründende Wesen, das als Einheitsgrund des Idealen und Realen, der zugleich ihre Wechselwirkung ermöglicht, des Subjektscharakters nicht entraten kann. So hat auch die Beantwortung der zweiten Frage uns auf das real-ideale Subjekt (Gott) hingewiesen, das als absolute Persönlichkeit, das Ideal des autonomen Subjekts in sich realisiert und als souveräner Schöpfer die empirische Realität mit idealem Gehalt erfüllt und so zur fortschreitenden Realisierung des Idealen befähigt. Der Idealismus, der die Tatsächlichkeit ignoriert, und der Positivismus, der dem idealen Gesetzescharakter des Realen nicht gerecht wird, finden ihre Überwindung in dem theozentrischen Real-Idealismus, der allein die in beiden steckenden Wahrheitskeime in originaler Weise zu einer Einheit zu verschmelzen vermag.
3. In Gott haben wir somit das absolut autonome Subjekt als Idealgrund aller Gesetzmäßigkeit und als Realgrund allen Seins gefunden. Die als Ideal uns vorschwebende Autonomie hat in Gott ihre einzig mögliche und einzig vollendete Realisierung erreicht: Nur das reale, absolut autonome Subjekt (Theonomie) erfüllt die Idee des selbständigen Gestaltens und des restlos einsichtsvollen Erkennens, weil es schöpferisch handelt, und weil sein souveränes Wissen die Dinge nicht nachträglich erfaßt, sondern in ihrer Eigenart überhaupt erst begründet. Frei von jedem Schatten der Beschränktheit und Veränderlichkeit stellt dieses Subjekt den absolut unabhängigen Mittelpunkt dar, um den alles in der Wirklichkeit schwingt, weil alles von ihm in jeder Hinsicht abhängig ist. So ist Gott denn auch die Wirklichkeit in ihrer Totalität — sub specie aeterni — gegenwärtig. Alles wird von ihm allseitig erfaßt, wie es ist; denn die Seinsordnung und die in ihr herrschende objektive Wertabstufung erhält ja vom Erkennen Gottes selbst erst ihr Fundament und ihre Norm.
Wie verhält sich nun das empirische Erkenntnissubjekt zu diesem wahrhaft autonomen, realen und alle Empirie voraussetzungslos realisierenden Subjekte? Man könnte versucht sein, angesichts der Souveränität des göttlichen Subjekts pantheistisch alle Selbständigkeit empirischer Subjekte zu leugnen und das Erkenntnisideal in dem passiven Versinken in Gottes unendliche Natur zu suchen, jenes „es denkt" Lichtenbergs könnte eine solche pantheistische Auffassung als Devise erwählen, da sie ja die Auslöschung aller Individualität als Endziel auch für das Denken predigt.
Es ist eine eigenartige Ironie, daß die wirklichkeitsfremde, pantheistische Überspannung des geschöpflichen Abhängigkeitsverhältnisses zu demselben Resultate führt, wie der die Gottheit ignorierende Positivismus: Für beide ist die Individualität empirischer Subjekte eine Illusion. Wird sie im Pantheismus von der das Wesen der Wirklichkeit ausmachenden Gottheit gleichsam aufgesogen, so zerfällt sie in der Hand des Positivismus in einzelne „Gegebenheits"-elemente, aus denen sie als rein zufälliges Gebilde äußerlich zusammengesetzt sein soll!
Eine vorurteilsfreie, alles gewissenhaft berücksichtigende Betrachtung kommt nun freilich zu einem ganz anderen Ergebnis: Die Analyse des Ich-Bewußtseins vergewisserte uns ja, daß „ich" der Brennpunkt für alle Strahlen bin, die von außen auf „mich" einwirken, und daß „ich" nach Maßgabe meiner Entwicklung alles in mir Vorfindliche selbständig organisiere, so daß „ich" eine „Welt für mich" habe, ein Reich von Erlebnissen, dessen Beherrscher „ich selbst" bin, und dessen Grundgesetz in dem von mir in mir selbst entdeckten idealen Invariantensystem besteht. Die Bausteine zu dieser „Welt für mich" stammen freilich letzten Endes von der Umwelt, der Wirklichkeitsordnung, als deren Glieder wir uns selbst erkannt haben, aber „ich" bin es doch, der diese Bausteine zu einem Ganzen fügt und so u. a. auch einen möglichst getreuen Begriff von der Wirklichkeit (d. h. ihre Erkenntnis) anstrebt. Und so wie „ich", so bauen alle empirischen Subjekte, deren Existenz uns die kritische Umschau in der Erlebnissphäre bezeugte, ihre eigene Welt auf.
An der Selbständigkeit der empirischen Subjekte ist demnach nicht zu zweifeln, wenn wir auch Gelegenheit hatten, uns wiederholt von der Relativität dieser Selbständigkeit zu überzeugen.
Diese relative Selbständigkeit der empirischen Subjekte, die unseren positiven Eigenwert bildet, ist nun bei der Bestimmung unseres Verhältnisses zu Gott nicht außer Acht zu lassen. Kann sie als Selbständigkeit „von Gottes Gnaden" die Absolutheit Gottes in keiner Weise beeinträchtigen, so wird anderseits die durch sie gegebene „Spannung" zwischen unserer Subjektivität und Gottes Persönlichkeit wie für die Auswirkung unseres gesamten geistigen Lebens, so besonders für den Ausbau unseres Erkenntnissystems von weittragender Bedeutung sein. In genialer Weise hat der hl. Augustin dem einzigartigen Werte dieser grandiosen „Gewölbespannung" unseres Wissensgebäudes, wie überhaupt unserer gesamten Lebensführung einen prägnanten Ausdruck am Anfang seiner Soliloquien verliehen: Deum et animam scire cupio. Nihilne plus? Nihil omnino!
Die Lösung der Erkenntnisrätsel besteht somit nicht in einer pantheistisch-mystischen Aufhebung dieser von Gott selbst gewollten „Spannung", sondern in der Normierung ihrer „Spannweite" nach objektiven Wertmaßstäben d. h. aber nach Gesetzen, die in Gott, dem absolut autonomen Subjekte selbst, ihre zureichende Begründung finden.
Das empirische Erkenntnissubjekt verhält sich zum absoluten Subjekt wie der Planet zu der Sonne, um die er kreist. Wie bei diesem, soll er seine Bahn beschreiben, die Zentrifugal- und Zentripetalkraft, die beide aus der Rotation der Sonne und aus der von ihr ausgeübten Anziehung herstammen, sich die Waage halten müssen, so kann das empirische Subjekt seine Erkenntnisfunktion nur dann in normaler Weise ausüben, wenn die Zentrifugalkraft des Strebens nach Autonomie, nach selbständiger Gestaltung des Erkenntnisstoffes, sich harmonisch verknüpft mit der Zentripetalkraft der Einordnung der eigenen relativen Autonomie in die absolute theonome Ordnung, unserer Wahrheitserkenntnis in die „Wahrheit an sich".
Was für den transzendentalen Idealisten ein unlösbares Rätsel bleiben mus, die Naturgebundenheit der empirischen Subjekte und die daraus sich ergebenden Verkürzungen und Überschneidungen, die Lücken, Dunkelheiten und Widersprüche der subjektiven Weltbilder, das alles erhält vom Standpunkt unserer theozentrischen Weltauffassung seine vollgiltige Begründung. Wie von dem Planeten aus – seiner exzentrischen Stellung gemäß – das Sonnensystem eine fragmentarische, unübersichtliche Form gewinnt, während es von der es einheitlich beherrschenden Sonne aus in seiner „wirklichen" Gestalt sich zeigt, so ist es nur natürlich, das vom Standpunkt des empirischen Subjekts aus die gesamte Wirklichkeit nicht in ihrer eigentlichen Seins- und Wertabstufung, sondern wegen des unverhältnismäßigen Hervortretens des Nahen und uns besonders Angehenden gegenüber dem ungebührlich vernachlässigten und verdrängten, objektiv vielleicht wichtigeren „Fernen" in einem „verzerrten", dunkeln und lückenhaften Charakter erscheint. Nicht in der Wirklichkeit als solcher sind ja diese Lücken und Dunkelheiten begründet, sondern in unserer individuellen Stellung zur Wirklichkeit. Wenn es uns deshalb auch nicht gelingt, den letzten Schleier von den Welträtseln zu lüften, so finden wir doch unsere intellektuelle Befriedigung in der Gewissheit, daß diese Schleier nur für unser relatives Erkennen bestehen, und daß ein Strom schattenlosen Lichtes von dem absolut autonomen Subjekte aus die ganze Wirklichkeit durchflutet. |vgl. S. Aug. Conf. I. 6: Quid ad me si quis non intelligat? … amet non inveniendo invenire potius, quam inveniendo non invenire te (Deum).]
So findet das empirische, von Unruhen und Zweifeln zerquälte, an den Schranken seiner Relativität und Variabilität rüttelnde Subjekt einen absolut festen Stützpunkt in der Überzeugung vom Dasein Gottes, des absolut autonomen Subjekts. Nicht ein bloßes Postulat, nicht die Idee des „Bewustseins überhaupt" dient nun mehr seinem Forschen als überindividuelles Orientierungsmittel; er hat eine weit festere Basis gefunden, von der aus er wieder Vertrauen zu der realen Geltung idealer Gesetze und Zuversicht zu einer, wenn auch nur allmählich fortschreitenden Erfaßbarkeit des Realen gewinnen kann. Nun vermag er auch an der ihm allein erreichbaren Autonomie erfolgreich zu arbeiten. Die Richtung des empirischen Subjekts auf das absolut autonome Subjekt erdrückt nicht die eigene Selbständigkeit; sie fordert sie vielmehr, weil nur durch eine immer vollkommenere Auswirkung dieser Selbständigkeit und durch die damit gegebene Überwindung aller Hemmnisse ihrer Betätigung die objektiv geforderte normale Beziehung zwischen dem positiv Wertvollen in uns und Gott, dem Begründer aller Werte, hergestellt werden kann. Indem wir in uns das Pflichtgefühl erleben, unser fragmentarisches Erkennen immer besser mit der „Wahrheit an sich" in Einklang zu bringen, läutert sich unser Wahrheitssinn, und es erstarkt in uns die Spannkraft, allen Enttäuschungen zum Trotz durch Entfaltung der in uns schlummernden Kräfte an der erkenntnismäßigen Bewältigung und Beherrschung der Wirklichkeit zu arbeiten. Wir entfalten und behaupten somit unser „Selbst" (unsere Subjektivität), wenn wir in vertrauensvoller Unterordnung unter das göttliche Wahrheitsideal dem Strom der Erlebnisse, der uns unbarmherzig fortzuspülen droht, uns entgegenstemmen.
Aber dieses „Selbst" darf nicht einer Phase der Subjektsentwickelung gleichgesetzt werden. Unsere Subjektivität soll ja, das wissen wir schon, von allen Zufälligkeiten der Veränderlichkeit befreit werden. Nicht auf die Einzelphase kommt es an; sie muss überwunden werden; insofern ist also Selbstverleugnung Pflicht des Subjekts: Was sorgfältig bewahrt und rein zur Geltung gebracht werden muss, ist vielmehr das einheitliche, unsere individuelle Subjektsnatur konkret durchwaltende Gesetz, und dieses „Selbst" kann in seiner Einheitlichkeit und Konsequenz nur behauptet werden, wenn es sich an das absolut einheitliche und unveränderliche Subjekt anschließt: nur so vermag unsere Subjektivität alle in der Empirie scheinbar unaufhaltsam auseinanderstrebenden Momente energisch zusammenzuhalten und selbständig zu organisieren. Dieses Organisieren ist aber die eigentliche autonome Funktion. Der Imperativ „Crede ut intelligas" gilt für alle Gebiete unseres Wissens. Das einfache Hinnehmen ist Notbehelf, z. T. unentbehrlicher Notbehelf, da die Schranken unserer Natur ein allseitiges, selbständiges Aneignen uns unmöglich machen. Aber immerhin bleibt bestehen, dass eigentlich gewusst nur das wird, was auf selbständige, einsichtige Weise aus letzten Gründen abgeleitet ist. So ist das seiner Schranken sich bewusste Streben nach kritisch fundierter, autonomer Gewissheit nicht Auflehnung gegen das absolut autonome Subjekt, sondern die einzig unserer Subjektsnatur entsprechende Ausprägung seines Ebenbildes! Je mehr wir unsere Einheitlichkeit wahren, und je mehr sie bis ins einzelne unserer Überzeugungen hinein zur Geltung kommt, um so mehr gelingt uns auch die als Erkenntnisziel uns ständig vorschwebende Anpassung an die absolute Wahrheit!
Einheitlichkeit bedeutet aber nicht Einseitigkeit. Wer ehrlich vom Dasein und Walten Gottes überzeugt ist, der fühlt in sich nicht das Bedürfnis, sich engherzig vor der Durchforschung der Wirklichkeitsfülle zu verschließen. Er weiß ja, dass etwaige Schwierigkeiten seinem eigenen beschränkten Erfassen und der Schwäche seiner selbständigen Gestaltungskraft, nicht aber einer objektiv unauflösbaren Disharmonie, die eine schwerwiegende Instanz gegen Gottes Allmacht und Weisheit wäre, zuzuschreiben sind. Wer darum als Theist bei seinem Forschen absichtlich Schwierigkeiten, die sich ihm entgegenstellen, aus dem Wege geht und das von ihm Erforschte allzu einfach darstellt, handelt nicht nur unehrlich; er erweist vielmehr seiner Weltanschauung einen schlechten Dienst, ja, er verrät sie eigentlich, indem er mit ihrem Deckmantel die Blöße seiner subjektiven Beschränktheit zu verhüllen sucht.
Selbständig errungene Einheitlichkeit führt zugleich zur Schlichtheit: Mit seinem Wissen zu prunken, vermag nur der, dem es nichts mehr als äußerer Prunk und Schmuck bedeutet. Wer dagegen an der selbständigen Durchdringung des Wissenstoffes unermüdlich arbeitet und dabei neben dem Errungenen stets neue Rätsel und Dunkelheiten mit Ehrfurchtschauern erschaut, der vergisst über der zu erforschenden Wahrheit sich selbst. Nicht wie etwas gesagt wird, sondern was gesagt wird, erscheint nunmehr als das Wichtigste, und dieses „Was", dieser Wesenskern leuchtet als Einheitsgrund des Mannigfaltigen am klarsten hervor im einfachsten Gewande, wie ja auch Gottes Werke, soweit wir sie zu würdigen wissen, uns durch ihre majestätische Einfachheit ergreifen. Simplex sigillum veri!
Eben wegen der Selbstvergessenheit wird die Schlichtheit, in der wir den Gipfel der Selbstvollendung erblicken, zur unbedingten Sachlichkeit. Wenn nämlich auch das Erkennen nach unserer Überzeugung Subjektsfunktion ist und bleibt, so sahen wir doch bereits ein, dass es als sachlich bedingtes Erfassen von aller empirisch-subjektiven Verfälschung sich befreien muss. Diese Loslösung ist aber erreicht, sobald wir gelernt haben, im Hinblick auf die „Wahrheit an sich" unsere „materiale lch-Komponente", sofern sie die Forschung stören könnte, außer Wirksamkeit zu setzen, uns so selbst zu vergessen und mit unserer derart geläuterten Subjektivität uns ganz in die zu erforschende Sache selbst zu versenken. Reine Subjektivitat ist in diesem Sinne zugleich reine Sachlichkeit, während ein Untergehen im Sachlichen ohne Wahrung der subjektiv-synthetischen Funktion uns nie zur vollen Würdigung des Sachlichen, also zu seiner Erkenntnis führen kann, weil wir dann unbarmherzig von der verwirrenden Fülle des Sachlichen erdrückt werden. Aber „reine Subjektivität" (Autonomie) oder, was dasselbe ist, „reine Sachlichkeit" muss wegen unserer realen Variabilität ständig von neuem errungen werden. Wiederum dient die Theonomie für diesen Kampf nicht nur als unwandelbarer Richtpunkt, sondern auch als untrügliche Bürgschaft unseres Sieges, (vgl. S. Aug. Conf. 119. Ita … servabis me, et augebuntur et perficientur quae dedisti mihi, et ero ipse tecum, quia et ut sim, tu dedisti mihi!)
Ab uno te (Deus) aversus,
in multa evanui.
S. Aug. Conf. II 1.
Subjektivitat und Autonomie gegen einander abzuwägen und in das rechte Verhältnis zu einander zu setzen, bildete die eigentliche Aufgabe unserer Studie. Wenn wir hierbei unsere Aufmerksamkeit auf das Erkenntnisgebiet konzentrierten, obwohl an sich jede wertende Stellungnahme des Subjekts an diesem Problem beteiligt ist, so geschah es deshalb, um auf einem uns geläufigen Gebiete und zugleich, wie es uns scheint, an einem klassischen Beispiele die eigentümliche Problemverschlingung darzustellen und kritisch zu analysieren. Wir glauben nun nachgewiesen zu haben, dass die eigenartige Mittelstellung des empirischen Subjekts zwischen vorgefundener Naturgebundenheit und selbständiger Geistigkeit eine uneingeschrankte Gleichsetzung unserer im „Ich" sich kundtuenden Subjektivität mit der Autonomie verwehrt. Nur durch Selbstüberwindung d. h. durch Loslösung von allem empirisch Variablen in uns gelangen wir zur Erstarkung unserer Selbständigkeit, also zur allmahlich fortschreitenden Annäherung an das Ideal der Autonomie. (I.)
Diese Vollendung des eigenen „Selbst" wird aber dadurch erschwert, dass wir nicht bloß Beobachter, sondern Glieder des Wirklichkeilszusammenhanges sind. Im Wirken und Leiden haben wir zur Umwelt Stellung zu nehmen und in diesem Ringen mit ihr unsere Subjektsnatur zu entfalten. Die Variabilität der einzelnen Wirklichkeitsreihen, zu denen auch unsere Subjektivität im allgemeinen und unser Erkenntnisprozes im besonderen gehört, steigert die Komplikation unserer Erkenntnis, die eine allseitige, eindeutige Zuordnung ihrer selbst zu den übrigen Wirklichkeitsreihen anzustreben hat. Von dem Versinken im Strome des wirklichen Geschehens sucht sich nun das empirische Subjekt zu retten, indem es vermöge der in ihm erwachenden und erstarkenden Selbständigkeit (Autonomie) ein ideales Invariantensystem zum Behufe der Fixierung der einzelnen Reihen und ihrer Beziehung zu einander konstruiert. (II.)
Das Ideal des autonomen Subjekts mit dieser Struktur eines apriorischen, aller Erfahrung zu Grunde liegenden Invariantensystems reicht aber als solches nicht aus, um alle Rätsel des Erkenntnisproblems, die aus dem Gegensatz unserer Subjektivität zu den von uns unabhängigen Erkenntnisobjekten sich ergeben, zu beseitigen. Gerade die Beziehung unserer Erkenntnisse auf die Realität wie die einander vielfach durchkreuzende Verknüpfung des Idealen und Realen in uns und um uns hat uns zu der Überzeugung geführt, dass unser Streben nach Autonomie und zugleich nach allgemeingiltiger, sachlich bedingter Erfassung des Gegebenen nur deshalb realisierbar ist, weil das absolut autonome Subjekt nicht bloß ein von uns konstruiertes Ideal, sondern der aus sich seiende, Idealität und Realität, uns und die Umwelt in gleicher Weise schöpferisch begründende Gott ist. Für das empirische Subjekt ergab sich aus dieser Erkenntnis und der in ihr gesetzten Spannung zwischen dem empirischen und dem absoluten Subjekte erst die vollgiltige, unausgesetzt uns anregende und antreibende, ethisch religiöse Verpflichtung, aus der uns zersplitternden Vielheit des Erfahrungslebens zur Einheit einer in Gott begründeten Weltansicht vorzudringen und so unsere Wahrheitserkenntnis immer mehr vom Dunkel der Empirie zu befreien, indem wir auf sie das Licht der „Wahrheit an sich" wirken lassen. (III.)
Die Etappen dieses Vollendungsprozesses unserer Subjektivität und ihrer Umwandlung in die uns erreichbare Autonomie konnen wir zum Schlusse in die Formeln zusammenfassen: Selbstüberwindung zum Behufe der Selbstvollendung! Selbstentfaltung, nicht Selbstvernichtung! Selbstentfaltung durch Selbstbehauptung! Selbstbehauptung durch selbstgewollte Unterordnung unter das absolut autonome Subjekt! Selbstvollendung als Bürgschaft vollendeter Sachlichkeit!
Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas, et si animam mutabilem inveneris, transcende te ipsum! S. Aug. de ver. vel. 72.
Anmerkungen:
Die Studie von B. W. Switalski Zur Analyse des Subjektbegriffs erschien 1914 in Braunsberg in Ostpreußen.
Ich wurde auf sie durch eine warme Empfehlung aufmerksam, die ich bei Peter Wust gelesen hatte.
Was besser ist als Autonomie
In dieser Predigt erkläre ich, warum es ein Irrweg ist, wenn katholische Theologen den Autonomiegedanken in unsere Gottesbeziehung hineintragen wollen.
Recktenwald-Predigten · 3. Fastensonntag: Freundschaft statt Autonomie
Da ich sonntags zweimal predige, gibt es dieselbe Predigt noch in einer anderen Fassung.
Philosophen
Anselm v. C.
Bacon Francis
Bolzano B.
Ebner F.
Geach P. T.
Geyser J.
Husserl E.
Kant Immanuel
Maritain J.
Müller Max
Nagel Thomas
Nida-Rümelin J.
Pieper Josef
Pinckaers S.
Sartre J.-P.
Spaemann R.
Spaemann II
Tugendhat E.
Wust Peter
Autoren
Bordat J.
Deutinger M.
Hildebrand D. v.
Lewis C. S.
Matlary J. H.
Novak M.
Pieper J.
Pfänder Al.
Recktenwald
Scheler M.
Schwarte J.
Seifert J.
Seubert Harald
Spaemann R.
Spieker M.
Swinburne R.
Switalski W.
Wald Berthold
Wust Peter