zur katholischen Geisteswelt
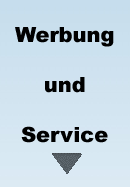
|
Zum
biographischen Bereich |
|
Zum englischen
und polnischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im philosophischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
liturgischen Bereich |
Themen
Atheismus
Atheisten
Atheist. Moral I
Atheist. Moral II
Aufklärung
Autonomie
Autonomiebuch
Biologismus
Entzauberung
Ethik
Euthanasie
Evolutionismus
Existenzphil.
Gender
Gewissen
Gewissen II
Glück
Glück und Wert
Gottesbeweis
Gottesglaube
Gotteshypothese
Handlung
Handlungsmotive
Das Heilige
Kultur
Kulturrelativismus
Langeweile
Liebe
Liebe II
Liebesethik
Menschenwürde
Metaethik
Methodenfrage
Moralillusion
Naturalismus
Naturrecht
Naturrecht II
Naturrecht III
Neurologismus
Opferidee
Philosophie
Proslogion
Relativismus
Sinnparadox
Sittengesetz
Sollen
Theodizee
Tierschutz
Verantwortung
Vernunftphil.
Vernunftrettung
Voluntarismus
Werte
Wirklichkeit
Vernunft und Tyrannei der Mehrheit
Von Janne Haaland Matláry
In diesem Buch haben wir uns immer wieder unter verschiedenen Blickwinkeln mit dem Problem von Wahrheit und Demokratie befaßt. Wir haben gezeigt, daß es einen lebenswichtigen Unterschied zwischen Pluralismus und Relativismus gibt – ersterer ein Wesensmerkmal, letzterer eine Gefährdung der Demokratie. Wir haben auch gezeigt, daß die westliche Demokratie heute in Gestalt des Nihilismus vor einer relativistischen Herausforderung steht, die die Demokratie und ihre zentralen Werte, die Menschenrechte, zu untergraben droht. Zwei zeitgenössische europäische Intellektuelle haben zu dieser Debatte hervorragende Beiträge geleistet. Beide sind Professoren – Jürgen Habermas für Soziologie, Joseph Ratzinger, der im April 2005 zum Papst gewählt wurde, für Theologie. Die Debatte zwischen ihnen beruht auf zwei verschiedenen Ansichten über Metaphysik: Während Habermas die Auffassung vertritt, daß wir uns in einer definitiv postmetaphysischen Epoche befinden, daß also die Möglichkeit der Metaphysik heute nicht mehr gegeben ist, vertritt Ratzinger die entgegengesetzte Auffassung: Ohne eine metaphysische Grundlegung ist Vernunft nicht möglich, so seine Schlußfolgerung.
Metaphysik ist nichts Geheimnisvolleres als das Wissen von der menschlichen Natur und der damit verbundenen Fähigkeit, mit Hilfe des Verstandes Fakten und Fiktion, Wahrheit und Täuschung, Richtiges und Falsches voneinander zu unterscheiden. In der klassischen Tradition bildeten die menschliche Natur und ihre rationalen Fähigkeiten den Ausgangspunkt, und die Wissenschaften, die sich mit diesen Aspekten beschäftigten, kamen „nach der Physik“ und hießen daher „Metaphysik“. Physik, Mathematik und Logik basierten auf der Metaphysik – Logik war beispielsweise ohne eine rationale menschliche Natur nicht möglich. Ehe wir uns der Metaphysik und dem Naturrecht zuwenden, wollen wir einen Blick auf die derzeitige Debatte werfen.
Habermas fragt, wie ein Konsens möglich ist, wenn es keine Wahrheit gibt, denn Wahrheit ist vor allem im ethischen Bereich seiner Ansicht nach nicht möglich. Seine Antwort lautet, daß der rationale Dialog der Weg, ein Ideal und eine Möglichkeit zwischen Individuen ist, die nach Vernunft streben und versuchen, sich selbst aus allen Machtstrukturen und Interessen zu lösen. Die Notwendigkeit, Interesse und Erkenntnis voneinander zu trennen, durchzieht Habermas’ gesamtes, sehr umfangreiches wissenschaftliches Werk (Erkenntnis und Interesse, 1968), und dasselbe gilt für die Analyse der materiellen und immateriellen Machtstrukturen in der Gesellschaft (Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962). Habermas’ bekannter Aufruf zu einem „herrschaftsfreien Dialog“ als der Vorbedingung für Vernunft wird von allen unterstützt, die sich eine freie und offene öffentliche Debatte wünschen.
Doch diese Hypothese setzt voraus, daß es tatsächlich möglich ist, als Bürger interessenfrei zu handeln. Das wird von vielen bestritten, ist meines Erachtens jedoch nicht das Hauptproblem an diesem im übrigen sehr tiefgründigen Vorschlag.
Die Logik des interessenfreien Dialogs als Ersatz für das Streben nach der Wahrheit ist in einer Gesellschaft, die den Anspruch auf Wahrheit aufgegeben hat, klar genug, kann jedoch niemals an die Stelle der Wahrheit treten. Der norwegische Forschungsrat arrangiert von Zeit zu Zeit – zweifellos in Anlehnung an eben diese Logik – sogenannte „Konsenskonferenzen“ zu kontroversen Themen wie Biotechnologie oder Feminismus. Die Logik ist habermasianisch: Durch einen offenen und „interessenfreien“ Dialog will man in dem betreffenden Bereich letztlich zu einem Konsens gelangen. Das ist die einzige verfügbare Wahrheit; sie beruht auf einem induktiven Prozeß der Kompromißfindung. Aber sind Induktion und Kompromiß mehr als die politische „Kunst des Möglichen“?
Gesetzt den Fall, die habermasianische Lösung stellt uns nicht zufrieden: Gibt es eine Alternative? Kann man in normativen Fragen ebenso rational argumentieren wie in den Naturwissenschaften? Ist das Problem heute wirklich ein eingeschränkter Vernunftbegriff?
Das ist Professor Ratzingers These, die er in verschiedenen Büchern, Gesprächen und Artikeln vertritt (Diese Aussagen hat Joseph Ratzinger nicht als Kardinal oder in seiner Funktion als Präfekt der Glaubenskongregation und auch nicht als Papst Benedikt XVI., sondern als Professor und Intellektueller formuliert). Seine wesentliche Aussage ist die, daß die moderne Vernunft begrenzt und verarmt ist und daß wir die klassische Vernunft wiederentdecken müssen, um zu verstehen, was der Mensch wirklich ist. Nur ein korrektes Verständnis vom Menschen kann die Basis der Demokratie und der Menschenrechte bilden. Wir wollen uns seine Analyse einmal genauer ansehen.
Das Hauptproblem der modernen europäischen Gesellschaft ist, so Ratzingers Einschätzung, das eingeschränkte Verständnis von Vernunft. Während der Fortschritt in den Naturwissenschaften seit der Renaissance und vor allem seit der Aufklärung immens gewesen ist, hat es in dem Bereich, den man als die „Moralwissenschaften“ bezeichnen könnte, keinerlei Fortschritt gegeben: „Die moralische Kraft ist mit dem Fortschritt der Wissenschaft nicht mitgewachsen, eher hat sie abgenommen, weil die technische Mentalität Moral ins Subjektive verweist.“ (Europa in der Krise der Kulturen, Ansprache anläßlich der Verleihung des Premio San Benedetto 2005, in: Joseph Ratzinger, Marcello Pera, Ohne Wurzeln. Der Relativismus und die Krise der europäischen Kultur, Augsburg 2005, S. 63). Vernunft, so Ratzinger, ist als „rein funktionale Rationalität“ oder als Zweckrationalität im Sinne Max Webers definiert worden: Dient etwas dem Zweck, der erreicht werden soll?
Diese Form der Vernunft ist vollkommen gerechtfertigt, aber begrenzt. Gleichzeitig gibt es natürlich Werte, über die in der Gesellschaft immer mehr gesprochen wird – es scheint fast so, als sei noch nie soviel über Werte und über Ethik gesprochen worden wie in unserer Zeit –, doch die Definitionen dieser Werte sind völlig subjektiv und werden häufig im Namen der Political Correctness instrumentalisiert. In der Politik wie in der Theologie ist der Moralismus immer weiter verbreitet, so Ratzinger, doch dieser Moralismus ist uninteressant und anti-intellektuell, so lange er eine Sache des subjektiven Empfindens bleibt. Der politische Moralismus der 70er Jahre war „ein fehlgeleiteter Moralismus, weil ihm die geduldige Rationalität fehlte …“ (Ratzinger, 2005, S. 64).
Vernunft ist das Schlüsselwort für Ratzinger. Er kommt auf die Grenzen der funktionalen Rationalität zurück: „Vernünftig ist danach nur, was im Experiment nachgewiesen werden kann“ (ebd., S. 66). Doch das Experiment als die spezifisch naturwissenschaftliche Methode ist nicht die spezifisch philosophische oder spezifisch theologische Methode, und das würde auch niemand erwarten. Dennoch ist es den Vertretern der letztgenannten Disziplinen nicht gelungen, ihre Vernunft deutlich zu machen, die notwendigerweise im Wissen vom Menschen wurzelt. Doch während Immanuel Kant noch von einer Kategorie des Guten an sich sprechen und seinen kategorischen Imperativ als Axiom formulieren konnte, ist dies, so Ratzinger, heute nicht mehr möglich. Das moderne Europa, das die Kultur der Philosophie und der Theologie, so wie wir sie kennen, gewesen ist, hat auch ihre Antithese hervorgebracht: die heute vorherrschende Kultur der instrumentellen Vernunft, in der jedes Wissen vom Menschen eine reine Laune oder subjektive Empfindung ist.
Worin besteht die Begrenztheit dieser instrumentellen Vernunft unserer Zeit? Mit messerscharfer Logik stellt Ratzinger seine Hypothese vor, daß die instrumentelle Vernunft des heutigen Europa nicht als universales Paradigma dienen kann. Nur in Europa sind moralische Normen und Religion in einer recht krassen Form des Säkularismus aus dem öffentlichen Leben der Nationen verbannt worden. Doch dieser Säkularismus stellt sich selbst als den einzig gültigen Maßstab dar, an dem sich auch andere Kulturen und Zivilisationen messen lassen müssen, wodurch er seine Achtung vor Pluralismus und Relativismus ad absurdum führt. Das einzige, was nicht im Namen des Relativismus kritisiert werden darf, ist diese durch und durch europäische Kultur selbst. Das europäische Paradigma wird zur einzigen politisch korrekten Möglichkeit – doch dahinter verbirgt sich der logische Trugschluß, daß ein Wertesystem wertvoller ist als andere, was doch nur denkbar wäre, wenn es auf objektiven Werten beruhen würde.
Ein sehr anschauliches Beispiel hierfür ist die Debatte um die Veröffentlichung von Karikaturen des Propheten Mohammed im Februar 2006. Diese Karikaturen erschienen zuerst in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten und später in einem rechtsgerichteten christlichen Publikationsorgan in Norwegen. Die heftigen Reaktionen reichten von Boykotten bis hin zu Brandanschlägen auf Botschaftsgebäude im Mittleren Osten. Die im Zusammenhang mit diesem Fall in den nordischen Ländern geführte Debatte um die Meinungsfreiheit zeigt überdeutlich, mit welcher Selbstverständlichkeit die aggressiv säkularistische Sicht auf alle Verhältnisse übertragen wird: Die Pressefreiheit ist unanfechtbar, so die Argumentation der dänischen und norwegischen Journalisten, und diese Pressefreiheit äußert sich eben auch darin, daß die Religion diffamiert, lächerlich gemacht und verunglimpft wird – wenn manche Leute das als Blasphemie empfinden, beweist das nur, wie sehr sie noch an den religiösen Tabus festhalten, die allein schon deshalb, weil sie Tabus sind, bekämpft werden müssen. Nichts ist heilig, so das Argument, und der Anspruch, daß irgend etwas heilig ist, zeigt nur, daß die Religionen Sonderrechte beanspruchen. Wer soll entscheiden, was heilig ist? Etwa die Religionen? Damit verschaffen sie sich doch nur Privilegien, die sie vor allen Angriffen und jeglicher Kritik schützen.
Diese Argumentationsweise ist wichtig, denn sie ist eine perfekte Veranschaulichung von Ratzingers These, daß ein intoleranter Säkularismus, der in einigen europäischen Ländern verbreitet ist, sich nun selbst als Verteidiger der Menschenrechte und der Demokratie auf der ganzen Welt und damit als ein Maßstab zu profilieren sucht, dem andere, weniger entwickelte Länder folgen müssen. Außerdem belegt diese säkulare Hegemonie in Europa die Menschenrechte mit Beschlag, indem sie die Freiheit der Meinungsäußerung in ihrer eigenen intoleranten und respektlosen Weise definiert – wenn die Beleidigung und Verhöhnung der Religion ihren Höhepunkt erreicht, dann hat man es mit einem absoluten, in größter Freiheit ausgeübten Menschenrecht zu tun. Es ist geradezu eine Gesetzmäßigkeit: Je mehr die Religion beleidigt wird, desto freier war die Meinungsäußerung.
Das ist natürlich blanker Unsinn und hat außer mit primitiver Geschmacklosigkeit mit nichts etwas zu tun. Die Freiheit der Meinungsäußerung ist ein sehr weiter – in der Gesetzgebung mancher europäischer Staaten sogar allumfassender – Begriff, doch das bedeutet nicht, daß sie ein Freibrief für alle Arten von Beleidigungen sein darf. Wer seine Meinung äußert, muß sowohl die Religionsfreiheit als auch das Recht auf Reputation und guten Ruf in Betracht ziehen, denn auch bei diesen beiden handelt es sich um grundlegende Menschenrechte. Der Respekt vor der Religion ist außerdem eine Voraussetzung der Religionsfreiheit. Über all das herrscht in den europäischen Staaten weitgehende Übereinstimmung, doch es muß erwähnt werden, daß sich sowohl in den fraglichen skandinavischen Staaten als auch im traditionell laizistischen Frankreich starke Gruppen von Befürwortern in dem oben erwähnten Fall für eine uneingeschränkte Meinungsfreiheit eingesetzt haben.
Der Freiheitsbegriff, der dieser Auffassung, daß man alles und vor allem auch beleidigende Dinge sagen darf, zugrunde liegt, ist notwendigerweise selbst unbegrenzt. Ratzinger sieht in dieser unbegrenzten Freiheit zu Recht das größte Problem der modernen Demokratie. Wenn das Böse ein subjektiver Begriff und das Urteil über den Schaden, den man anderen zufügt, ebenfalls eine Frage des subjektiven Empfindens ist, dann wird die Freiheit nicht einmal mehr dadurch begrenzt, daß man anderen nichts Böses tun darf.
Die fehlende Bereitschaft, diese moderne Freiheit zu begrenzen, liegt letztlich in der Unfähigkeit, den Menschen und das zu definieren, was an der menschlichen Natur gut oder schlecht ist. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 basiert auf einem allerdings impliziten Menschenbild: So muß man beispielsweise, um in Würde leben zu können, bürgerliche und politische Rechte besitzen; man muß religiösen Freiraum haben und die Möglichkeit, eine Familie zu gründen; man muß für seine Familie Unterstützung erhalten usw. Wenn wir genau hinsehen, können wir die Anthropologie, die dieser Erklärung zugrunde liegt, nachzeichnen. Die verschiedenen Menschenrechte bilden ein sorgfältig ausbalanciertes Gebäude, und sobald eines dieser Rechte absolutgesetzt wird, wird das ganze Gebäude einstürzen.
Doch kommen wir noch einmal auf das erwähnte Beispiel zurück, denn daran läßt sich gut veranschaulichen, wie es dazu gekommen ist, daß sich ein Menschenrecht vor die anderen geschoben hat. Muslime sind es nicht gewohnt, daß ihre Religion lächerlich gemacht wird, und sie reagieren daher mit allen möglichen inakzeptablen Mitteln wie Drohungen und gewaltsamen Angriffen. Niemand will diese Methoden gutheißen. Doch wenn wir von diesen inakzeptablen Methoden einmal absehen, sehen wir, daß es zwischen der Verhöhnung der Muslime und der der Christen in bestimmten Teilen der westlichen Presse eine Parallele gibt: Die Christen werden in ihrer eigenen nationalen Presse und vielleicht besonders in den nordischen Staaten regelmäßig attackiert, doch sie haben sich daran gewöhnt. Dennoch zeigt diese Entwicklung, daß das Menschenrecht auf Religionsfreiheit in unseren Gesellschaften nicht respektiert wird – es läßt sich nicht mit der säkularistischen Prämisse vereinbaren, daß alles lächerlich gemacht werden darf und muß und daß nichts heilig und somit davon ausgenommen sein kann. Diejenigen, die an Gott glauben, werden keine Blasphemie dulden und ihr niemals mit Gleichgültigkeit begegnen, auch wenn die Christen im Sinne der christlichen Vergebungsbereitschaft damit ganz anders umgehen als viele Juden und Muslime. Doch darum geht es hier nicht. Der wesentliche logische Punkt ist der, daß Blasphemie nur für den existiert, der das Phänomen des Religiösen respektiert, und das Recht, solchen Respekt einzufordern, ist im Menschenrecht der Religionsfreiheit enthalten. Das Verhältnis zwischen Redefreiheit und Religionsfreiheit muß in einer Gesellschaft entweder ausgewogen sein – und das war sicherlich die Absicht der Verfasser der Menschenrechtserklärung –, oder es kommt zur Konfrontation, bei der das eine Recht versuchen wird, das andere zu verdrängen.
Dieses Beispiel führt uns zu der Schlüsselfrage im Kontext der menschlichen Natur und der Menschenrechte: den religiösen Bedürfnissen und dem Sinn für das Heilige. Nur weil es in der Natur des Menschen liegt, Gott zu brauchen und Gott zu suchen, gibt es ein Recht auf Religionsfreiheit. Als sie dieses Recht niederschrieben, haben die Verfasser der Erklärung es in Kauf genommen, daß sie damit etwas Wesentliches über den Menschen aussagten. Atheisten werden bestreiten, daß der Mensch ein religiöses Bedürfnis hat, und hieran sehen wir, daß die Debatte über die Menschenrechte tatsächlich eine Debatte über die menschliche Natur ist – und genau das hat auch Charles Malik über die Meinungsverschiedenheiten gesagt, die anfangs zwischen den Verfassern der Erklärung bestanden.
Können solche Konflikte anders als mit Macht gelöst werden? Kann Freiheit auf rationale Weise beschrieben werden? Kurz: Gibt es eine Vernunft, die allen Menschen in einer Gesellschaft gemeinsam ist?
Diese Frage hat Professor Ratzinger viele Jahre lang beschäftigt und durchzieht seine Schriften über Demokratie, Menschenrechte und Relativismus. Wenn überhaupt, dann haben nur wenige zeitgenössische Denker dieses Thema mit größerer Präzision und Scharfsichtigkeit durchdacht. Ausgangspunkt ist die Kritik an der Relativität des heutigen rationalistischen Paradigmas. Nur wenige Europäer – das beweist der Fall der Mohammedkarikaturen – sind sich der Tatsache bewußt, daß ihr eigenes Paradigma durchaus auch Schwächen hat.
Eine Vernunft, die die Ethik miteinschließt?
Das gegenwärtige Paradigma der Vernunft basiert auf der Vorstellung, daß die Vernunft sowohl vom Schöpfer als auch vom Menschen unabhängig ist. Dies ist, so unterstreicht Ratzinger, vollkommen zutreffend, solange wir über die Naturwissenschaften sprechen: „Sie beruhen auf einer Selbstbegrenzung der Vernunft, die im technischen Bereich erfolgreich und angemessen ist, aber in ihrer Verallgemeinerung den Menschen amputiert“ (Ratzinger, 2005, S. 74). Wenn wir nur diese begrenzte Form der Vernunft akzeptieren, führt dies dazu, daß der Mensch keine Vorstellung mehr davon hat, wie man das, was richtig, und das, was falsch ist, rational voneinander unterscheidet, und daß er außerhalb seiner selbst keine ethischen Maßstäbe mehr besitzt. Dies hat zur Folge, „daß der Mensch keine moralische Instanz außerhalb seiner Berechnungen mehr kennt“ (ebd.). Das wiederum bedeutet, daß alles, was nicht dem Bereich der empirischen Wissenschaften angehört – also auch alles, was sich auf politische und persönliche Normen und Werte bezieht – als völlig subjektivistisch betrachtet wird.
Warum ist das ein Problem? Der Unterschied zwischen einer pluralistischen und einer relativistischen Gesellschaft liegt in der Existenz einiger gemeinsamer Normen, der Grundrechte, wie wir im Deutschen sagen. Es wird erwartet, daß die Bürger sich in einigen Dingen einig sind – die politischen Philosophen bezeichnen dies üblicherweise als „Sozialvertrag“. So ist Diebstahl beispielsweise falsch und muß bestraft werden, stabile Familien sind gut für die zukünftigen Bürger, die sie großziehen, und damit auch gut für die Gesellschaft, usw. Der moderne Relativismus bestreitet jedoch, daß es außer den Normen der Political Correctness noch weitere gemeinsame Normen gibt. Und das führt zu einem unbegrenzten Freiheitsbegriff, denn es gibt außerhalb des subjektiven Urteils keine Maßstäbe oder Grenzen: Der Freiheitsbegriff scheint „grenzenlos zu wachsen“ (ebd., S. 74).
Der moderne Europäer hat sich selbst von seinen historischen Wurzeln gelöst und glaubt, daß die Geschichte und ihre philosophischen Erkenntnisse für ihn bedeutungslos sind. Der reale Fortschritt in den Naturwissenschaften hat das Mißverständnis hervorgebracht, daß auch in der „Wissenschaft“ vom Menschsein ein ähnlicher Fortschritt stattgefunden hat. Der moderne Mensch ist nicht nur vollkommen unwissend, was seine eigene philosophische und theologische Geschichte angeht, sondern hegt – tragischerweise – auch noch die Überzeugung, daß technischer und wirtschaftlicher Fortschritt auch einen zivilisatorischen Fortschritt beinhaltet. Der technische Wissensstand bestimmt, was man mit dem Menschen und für den Menschen tut, denn: „Was man kann, das darf man auch – ein vom Können abgetrenntes Dürfen gibt es nicht mehr“ (ebd., S. 75). „Dürfen“ – die normative Frage der Ethik – wird nun als etwas betrachtet, das von der Macht der öffentlichen Meinung und der persönlichen Vorlieben entschieden wird.
Zum Abschluß seiner Diagnose stellt Ratzinger die Frage: Reicht eine funktionelle Vernunft aus für den Menschen und für die Politik? Die Antwort ist nein. Ist diese Vernunft sich selbst genug? Nein – nicht dann, wenn sie für Entscheidungen in nichttechnischen, das heißt normativen Fragen herangezogen wird.
Wie läßt sich Vernunft außerhalb des technisch-wissenschaftlichen Bereichs definieren? Lassen sich grundlegende Normen und Werte rational bestimmen? Wenn man diese Frage heute stellen würde, würde man für verrückt erklärt, obwohl das Konzept der Menschenrechte auf dem Postulat einer menschlichen Natur beruht, die ihrerseits wiederum die Ursache der Menschenrechte ist: Wir haben Menschenrechte, weil wir Menschenwürde haben, wie es in der Präambel jeder Menschenrechtskonvention heißt. Und auch die Nürnberger Prozesse gingen von der Existenz eines höheren moralischen Rechts aus, von dem man annahm, daß es allen Menschen gemeinsam und für alle Menschen erkennbar sei. Wenn wir dies aus rein pragmatischen Gründen akzeptieren, das heißt aufgrund der Tatsache, daß das Gebäude der Menschenrechte auf diesem Postulat aufbaut, dann drängt sich unmittelbar die Frage auf, was das für eine Vernunft ist, ob sie existiert und wie sie funktioniert.
Politik als Sphäre des Rationalen
Es ist sehr interessant, aber nicht überraschend, daß Professor Ratzinger sich als Papst Benedikt XVI. dazu entschlossen hat, große Teile seiner ersten Enzyklika der Vernunft zu widmen. Im zweiten Teil von Deus caritas est diskutiert er, wie die rationalen Entscheidungen wieder in die Politik eingeführt werden können [1]. Vernunft bedarf beständiger Korrekturen, so stellt er fest, denn „ihre ethische Erblindung durch das Obsiegen des Interesses und der Macht, die die Vernunft blenden, ist eine nie ganz zu bannende Gefahr“ (Nr. 28). Die Vernunft ist dem Menschen angeboren, kann aber getrübt werden und wird auch tatsächlich oft getrübt. Das ist die alte aristotelische Position, wonach Tugend und Laster in ständigem Streit liegen. Die Kirche steht fest in dieser naturrechtlichen Tradition, die keineswegs spezifisch christlich ist. Die einzige Rolle, die die Kirche im politischen Leben spielen kann, besteht demnach, so der Papst, darin, „von der Vernunft und vom Naturrecht her“ zu argumentieren: Sie soll „zur Reinigung der Vernunft beitragen und dazu helfen, daß das, was recht ist, jetzt und hier erkannt und dann auch durchgeführt werden kann“ (ebd.).
Weil die Kirche „erfahren in der Menschlichkeit“ ist, hat sie in dieser Hinsicht etwas beizutragen und soll „auf dem Weg der Argumentation in das Ringen der Vernunft eintreten“ (ebd). Ziel ist es, in den Menschen wieder einen Sinn für Gerechtigkeit zu wecken, der das Wesen allen rationalen Argumentierens über Politik ist. Gerechtigkeit ist eine der vier Kardinaltugenden und wird in den Schriften der klassischen politischen Philosophie der Politik zugeordnet. Der Papst unterscheidet sehr deutlich zwischen der Rolle der Religion und der Rolle der Politik und stellt fest, „daß der Aufbau gerechter Strukturen nicht unmittelbar Auftrag der Kirche ist, sondern der Ordnung der Politik – dem Bereich der selbstverantwortlichen Vernunft – zugehört“ (Nr. 29).
Die Kirche sollte sich um die Seelen kümmern und darum, die Wahrheit über die menschliche Natur zu verkünden – ihre Tugenden und ihre Schwächen, ihre Fähigkeit, sich zu bessern, kurz: ihr spirituelles Leben. Doch Politik ist etwas anderes, ein autonomer, weder religiöser noch privater Bereich, der seinen eigenen Auftrag und seine eigene Rationalität hat. Der Papst definiert die Politik als den „Bereich der selbstverantwortlichen Vernunft“ – eine Sphäre, die nicht von Macht oder Interessen, sondern von der Vernunft regiert wird. Wie ist das möglich? Was bedeutet das?
Im April 2005, einige Tage vor seiner Wahl zum Papst, unterstrich Kardinal Ratzinger in einer Ansprache im Benediktinerkloster in Subiaco, wo er den Premio San Benedetto entgegengenommen hatte, daß das Christentum die „Religion des Logos“ ist (Ratzinger J., Pera M., Ohne Wurzeln. Der Relativismus und die Krise der europäischen Kultur, Augsburg 2005, S. 78). Logos ist das griechische Wort für Vernunft, lateinisch ratio. Rational sein heißt überraschenderweise, ein Mensch zu sein: die klassische Tradition der aristotelischen und platonischen Philosophie definiert den Menschen als ein „rationales und soziales Wesen“. Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln bereits erörtert haben, ist Vernunft die Fähigkeit, Argumente und Rechtfertigungen für etwas vorzubringen; anders als die Tiere, die auch eine Sprache besitzen und miteinander kommunizieren, ist der Mensch das einzige Lebewesen, das über Dinge nachdenken kann. Wenn Tiere kämpfen, lieben, sich fortpflanzen, jagen, fressen, spielen und in einer Gemeinschaft leben, dann folgen sie ihrem Instinkt – der Mensch aber kann über all diese natürlichen Tätigkeiten nachdenken.
Zudem definiert die Ratio den Menschen selbst; ohne seine Fähigkeit zu rationalem Denken wäre er kein Mensch. Diese Fähigkeit ist dem Menschen angeboren, kann jedoch beispielsweise durch Krankheit oder Behinderung zerstört und sie kann beeinträchtigt werden, wenn Menschen es ablehnen, das Richtige und das Falsche voneinander zu unterscheiden. Wenn man die Fähigkeit zu rationalem Denken besitzt, heißt das nicht automatisch, daß man sie auch einsetzt.
Die Ratio befähigt den Menschen, über Fakten und auch über Werte nachzudenken: Man kann in einer faktischen Aussage, z. B.: „das Haus ist rot“, Wahrheit und Unwahrheit voneinander unterscheiden. Wenn man nicht farbenblind ist und wenn man die Begriffe „rot“ und „Haus“ kennt, ist man in der Lage zu entscheiden, ob diese Aussage der Wahrheit entspricht oder nicht. Dieselbe logische Fähigkeit besitzen wir aber auch bei unseren ethischen oder moralischen Entscheidungen: Ein Mensch, dessen Urteilsfähigkeit nicht in irgendeiner Weise eingeschränkt ist, kann zu der Schlußfolgerung kommen, daß es falsch ist zu stehlen oder zu töten. Die viel später von David Hume geäußerte Kritik geht am Kern der Sache vorbei, weil die aristotelische Definition des Menschen und seiner Vernunft die ethische Urteilsfähigkeit miteinschließt: Das Nachdenken über ethische Fragen ist ebenso natürlich, angeboren und rational wie das Nachdenken über empirisch beobachtbare Sachverhalte. Tiere werden einander ihre Beute höchstwahrscheinlich abnehmen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, und es kann vorkommen und kommt auch tatsächlich oft vor, daß Menschen dasselbe tun, aber wenn sie es tun, dann wissen sie doch, daß es falsch ist. Oder sie denken zumindest nicht, daß es richtig ist.
Die moderne europäische Vernunft ist somit nur eine partielle Vernunft, da sie sich auf technisches, mathematisches oder empirisches Wissen beschränkt. Die gesamte klassische Tradition des Humanismus ist in den Jahrhunderten der Skepsis und der Kritik à la Hume in Vergessenheit geraten oder unterdrückt worden. Man könnte einwenden, daß diese Tradition durch die meisten Maßstäbe der modernen Zeit sowieso überflüssig geworden ist und daß es unmöglich ist, sie wiederzubeleben und für den modernen säkularen Mensch nutzbar zu machen.
Die Wiederbelebung des Naturrechts
Hierzu muß zunächst gesagt werden, daß die Naturrechtstradition keineswegs religiös geprägt ist. Es handelt sich um eine ganz und gar weltliche Tradition, die nur eines voraussetzt: daß es eine erkennbare und konstante menschliche Natur gibt und daß Erkenntnis sich auf rationalem Weg vollzieht. Als der Papst noch Kardinal war, hat er mir in mehreren Gesprächen in den Jahren 2003 bis 2005 erklärt, daß das Naturrecht in einer modernen Sprache neu formuliert werden muß: Seine Voraussetzungen gelten nach wie vor, doch man kann eine Tradition, die so viele Jahrhunderte lang im Abseits gestanden hat, nicht einfach wiederbeleben. Die Anwendung des Naturrechts auf die Naturwissenschaften hat sicherlich ihre Berechtigung verloren.
Im Bereich der Werte oder Normen hat das naturrechtliche Denken jedoch insbesondere in der katholischen Philosophie und in der Kirche selbst überlebt. In den vorangegangenen Kapiteln dieses Buches habe ich viel Platz darauf verwandt, die Absurdität einer vollkommen relativistischen Position deutlich zu machen, und es ist leicht, eine solche Position zu widerlegen. Wie wir gesehen haben, werden sowohl die Menschenrechte als auch die Demokratie von Relativisten für ethisch richtig und gut gehalten, was zu der paradoxen Situation geführt hat, daß der Westen in allen ethischen Fragen außer im Bereich der politischen Kontrolle Relativismus predigt. Es liegt auf der Hand, daß dies im Bereich der Menschenrechte zu einem eindeutigen Widerspruch führt: Auf der Grundlage einer relativistischen Position können die Menschenrechte schon als bloßer Begriff nicht existieren, geschweige denn als Realität.
Das charakteristische Kennzeichen des Menschen ist die Ratio, und das Christentum ist, wie der Papst deutlich macht, die Religion des Logos, der Ratio. Alle Dinge, die die Ethik betreffen, können daher von dem erkannt werden, was häufig als die „rechte“, das heißt die ungetrübte Vernunft bezeichnet wird. Das Naturrecht, wie der heilige Thomas von Aquin die Ethik des gemeinschaftlichen, also des politischen Lebens des Menschen nennt, ist dem menschlichen Verstand vollkommen zugänglich. Selbst der Glaube an sich ist dem Verstand zugänglich, wie seine logischen Beweise für die Existenz Gottes zeigen. Heute sind solche Beweise weniger populär und beliebt, aber ich erwähne sie einfach, um deutlich zu machen, was die katholische Tradition dem menschlichen Verstand alles zutraut.
Der heilige Thomas hatte sein Wissen und seine Inspiration auf dem langen „Umweg“ über die arabische Philosophie direkt aus Aristoteles geschöpft. Wenn wir das aristotelische Menschenbild betrachten, finden wir das Wort ousia, das „Substrat“ bedeutet, also etwas, das in sich und aus sich selbst heraus ist und allen veränderlichen Dingen zugrunde liegt. Die lateinische Übersetzung dieses Begriffs lautet substantia, Substanz. Essentia, Essenz oder Wesenheit, ist ein anderer Ausdruck dafür. Das Geschlecht und andere Kennzeichen sind „zufällig“, akzidentiell, doch das Menschsein ist essentiell, primär und universal.
Die Definition des Menschen an sich besagt also, daß er eine Wesenheit und nicht von etwas anderem abgeleitet ist; er ist genauso wie die anderen natürlichen Geschöpfe, also beispielsweise die Tiere, etwas Zugrundeliegendes, eine Substanz. Aristoteles ist insofern ein Empirist, als er mit der Methode der Beobachtung und anschließenden Klassifizierung arbeitet: Er beobachtet also, daß Menschen und Tiere soziale Wesen sind, daß aber nur der Mensch auch ein rationales Wesen ist, obwohl die Tiere, wie schon erwähnt, auch eine Sprache besitzen.
Dieses klassische Postulat, die Definition des Menschen über seine Vernunftbegabung, wurde von Philosophen und Theologen des frühen Mittelalters übernommen und später, wie schon gesagt, vom heiligen Thomas wiederentdeckt. So stellt zum Beispiel Boethius im 6. Jahrhundert fest, daß der Mensch eine rationalis naturae individua substantia, eine „individuelle Substanz rationaler Natur“ (Contra Eutychen III, 6) ist, und die Vertreter der späten Stoa in Rom sahen das charakteristische Kennzeichen des Menschen in seiner Fähigkeit, über ethische Fragen rational nachzudenken. Diese Fähigkeit, das Richtige zu erkennen und zu tun, wurde Tugend genannt; der entsprechende lateinische Begriff – virtus – leitet sich von vir, Mann, ab und bedeutet Stärke und Männlichkeit. Die Kardinaltugenden waren bekannt und wurden in der gesamten Antike praktiziert – angefangen bei Sokrates’ Suche nach der Gerechtigkeit in den platonischen Dialogen bis hin zu Marc Aurels Kommentaren darüber, wie man das Römische Reich mit Tapferkeit und Besonnenheit regieren kann.
Der Mensch ist also mit Vernunft geschaffen, und diese Eigenschaft ist es, die ihn von den Tieren unterscheidet. Die Tugenden sind diejenigen Kennzeichen der menschlichen Natur, die es dem Menschen erlauben, sich zu entwickeln; und die entsprechenden Laster sind die Mittel, weniger menschlich zu werden, sich selbst zu entmenschlichen. In der aristotelischen Ontologie haben alle Wesen einen Zweck, ein Telos, und der Zweck des Menschen besteht darin, die Tugenden zu vervollkommnen und die Laster zu bekämpfen. Das ist so entscheidend, daß es einen Teil seines Wesens ausmacht und daß sogar das Sein selbst „mehr oder weniger“ wird, je nachdem, wie tugendhaft eine Person ist. Ein lasterhafter Mensch ist weniger wirklich oder hat weniger Sein als ein tugendhafter Mensch, und wir erkennen eine Spur dieses Denkens darin, daß wir einen besonders niederträchtigen Menschen als „unmenschlich“ bezeichnen. Für den Relativisten ergibt diese Ausdrucksweise logischerweise keinen Sinn, da Tugend und Laster lediglich subjektive Vorlieben sind. Doch die Menschen sind sich noch immer darüber im klaren, was Unmenschlichkeit ist – wer unmenschlich ist, ist weniger als ein Mensch.
Das Telos des Menschen ist die eudaimonia, das Glück, aber nicht im Sinne von Vergnügungen und Genuß, sondern im Sinne von Selbstdisziplin, Gerechtigkeit, Klugheit und Mäßigung. Nur wer sich voll und ganz beherrscht, ist glücklich, so die antike Lehre. Es wird erzählt, daß Kaiser Marc Aurel ein asketisches, einfaches, spartanisches Leben geführt habe, um seine Leidenschaften zu zügeln – unter denen die sexuelle Leidenschaft vermutlich noch die unwichtigste ist. Die Bestandteile einer ethischen Lebensweise kannte man sehr genau: Die Tugenden waren alle untereinander verknüpft wie Koordinaten, die dem Menschen halfen, die Untiefen des täglichen Lebens zu umsegeln; und die Laster konnten nur durch Stärke, also durch Tugendhaftigkeit bekämpft werden. Im stoischen Weltbild war es von entscheidender Bedeutung, daß man Distanz gegenüber den Wechselfällen und Versuchungen des Lebens bewahrte und auf den Tod vorbereitet war. „Der Tod befreit die Seele von ihrer Hülle“, sagte Marc Aurel. Den Tod nicht zu fürchten gab dem Menschen Kraft, Lebensperspektive und die Fähigkeit, das Hier und Jetzt in angemessener Weise zu schätzen.
Wenn wir uns die christliche Lehre ansehen, entdecken wir dieselben Elemente, nur daß sie diesmal um den Aspekt des Übernatürlichen – die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe – erweitert sind. Im Christentum erfährt das antike Programm der Charakterbildung eine Fortsetzung: Man muß die natürlichen Tugenden ausbilden, ehe man hoffen kann, die übernatürlichen zu erwerben, oder, um es mit den berühmten Worten des heiligen Thomas zu sagen: „Der Glaube baut auf der Natur auf und vervollkommnet sie.“ Der Versuch, ein guter Christ zu sein, ergibt keinen Sinn, solange man nicht bereit ist, ein guter Mensch zu sein; es ist schlichtweg unmöglich, denn göttliche Tugenden können nicht von einem bösen Menschen erworben werden. Gewiß kann der Herr uns nach seinem Ermessen vergeben, doch Tugend ist wie ein Gebäude, das Stein um Stein aufgebaut werden muß.
Was ist mit diesem klassischen Schema der Charakterbildung geschehen? Warum glauben die Menschen nicht mehr an die objektive Wahrheit von Tugend und Laster und an die menschliche Natur selbst? Gewiß hängt dies mit der Ablehnung der Metaphysik seit der späten Renaissance zusammen, doch handelt es sich auch um eine Entwicklung, die im Hinblick auf die Naturwissenschaften angemessen und fortschrittlich ist, sich aber nicht auf die Ethik übertragen läßt. Wie Professor Ratzinger deutlich macht, sind die alten naturrechtlichen Lehren im Bereich der Naturwissenschaften zu Recht abgelehnt und verworfen worden; doch im Bereich der Ethik geht diese Entwicklung in die Irre. Es hat bei den Fortschritten in der Definition der menschlichen Natur keine kopernikanische Wende gegeben; nur eine lange Reihe von skeptischen Philosophen, die das Konzept insgesamt abgelehnt haben.
Warum glauben wir, daß die menschliche Natur nicht definiert werden kann?
Während die Naturwissenschaften Fortschritte machten, war dies in den Geisteswissenschaften nicht der Fall. Die klassische Definition des Menschen und seiner Natur und die prägende Notwendigkeit, die Tugenden zu pflegen, wurden jedoch viele Jahrhunderte lang als das Wesen der europäischen Bildung aufrechterhalten. Um es mit den Worten des italienischen Philosophieprofessors Enrico Berti zu sagen: „Es blieb die Grundlage der weltweiten, nicht nur christlichen, sondern auch jüdischen und muslimischen Kultur in Antike, Mittelalter und Moderne, also der gesamten von der aristotelischen Tradition beeinflußten Kultur; wir finden es mit unbedeutenden Abweichungen bei Augustinus, Johannes von Damaskus, Richard von St. Victor, Thomas von Aquin, Leibniz, Rosmini, Maritain und mehreren anderen Denkern“ (E. Berti, The Classical Notion of Person in Today’s Philosophical Debate, Vortrag auf der Jahreskonferenz der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften, September 2005).
Doch dann greift die naturwissenschaftliche Entwicklung auf die Metaphysik über. Seit John Locke entwickelt sich ein Personbegriff, aus dem sich – obwohl Locke selbst der Naturrechtstradition verpflichtet war – keine naturrechtlichen Aussagen mehr ableiten lassen. Nach Lockes Ansicht kann der Mensch nicht erkannt oder definiert werden, weil man zu einer solchen Erkenntnis nicht durch direkte sinnliche Erfahrung gelangt. Der Mensch ist mehr als bloßes sinnliches Empfinden, so glaubt Locke, doch weil man das, was den Menschen ausmacht, nicht fühlen oder beobachten kann, muß es unerkannt bleiben. Diese gedankliche Linie wird sodann von Berkeley weiterentwickelt, der das Sein als Wahrgenommenwerden definiert (esse est percipi), und erreicht ihren Höhe- oder besser gesagt: Tiefpunkt mit dem Empirismus von David Hume.
Hume brach nicht nur mit der Metaphysik, sondern auch mit der Physik: Sein Skeptizismus ist so groß, daß er nicht einmal beobachtbare Kausalzusammenhänge als Kausalzusammenhänge anerkennt. Wenn wir sehen, daß ein Ball gegen einen anderen stößt, sehen wir nichts anderes als zwei aufeinanderfolgende Ereignisse, können aus dieser Beobachtung aber nicht schließen, daß der eine Ball die Bewegung des anderen Balles verursacht hat. Humes Ansicht zufolge erwarten wir, daß der erste Ball den zweiten in Bewegung versetzt, weil wir ähnliches schon vorher gesehen haben und folglich daran gewöhnt sind. Da wir den Begriff der Ursache selbst aber nie beobachten können, können wir auch nichts darüber wissen! Diese Ontologie ist keine Ontologie und sagt auch nichts über die menschliche Natur aus – alles, was existiert, ist eine Reihe sinnlicher Erfahrungen. Da wir uns selbst nicht beobachten, sondern lediglich unser eigenes Verhalten zur Kenntnis nehmen können, haben wir keine Substanz oder Identität; alles, was wir über uns selbst wissen können, ist eine Reihe zusammenhangloser Sinneseindrücke. Ich muß fairerweise erwähnen, daß Hume selbst seine Philosophie als vollkommen unbefriedigend empfand, aber erklärte, daß auch die Wissenschaft hier keine Abhilfe schaffen könne.
An diesem Punkt werden die Begriffe der Wissenschaft und auch der Vernunft ausschließlich dem Bereich der Naturwissenschaft zugeordnet. Nur das, was empirisch beobachtet und bewiesen werden kann, kann nach wissenschaftlichen Maßstäben existieren. Dies trifft zwar für die Naturwissenschaften, doch nie und nimmer für die Geisteswissenschaften zu. Wenn man die Wissenschaft auf Naturwissenschaft begrenzt, führt dies zum Tod der Metaphysik, und auch die Philosophie leidet darunter, weil sie dazu verurteilt ist, sich nicht mehr mit so großen Fragen wie der Ontologie oder der Epistemologie auseinanderzusetzen. Es ergibt keinen Sinn mehr, die großen ethischen Fragen zu erforschen, wenn man sich nicht auch mit den Voraussetzungen der Ethik befaßt und fragt, was die menschliche Natur ist und wie sie ihr Ziel erreichen kann.
Immanuel Kant versucht die objektive menschliche Natur zu „retten“, indem er sie a priori postuliert wie ein Axiom in der Mathematik. Der Mensch ist ein rationales, mit Würde ausgestattetes Wesen, so sein Postulat, und sollte daher nicht als Objekt, als Mittel, sondern als ein Ziel um seiner selbst willen behandelt werden. Doch so lobenswert dies auch ist, Kants Postulat bleibt immer nur ein Postulat, da man nichts über die menschliche Natur wissen kann. Ethik oder der moralische Imperativ sind notwendig, weil der Mensch sonst zu einem utilitaristischen Tier werden würde.
Später, im 19. Jahrhundert, fahren Hegel und Fichte mit der Zerstörung der Metaphysik fort, indem sie bestreiten, daß etwas Wesenhaftes existieren und erkannt werden kann: Alles ist Idee, nichts ist real. Und danach sehen wir, wie die menschliche Natur durch die Vorstellung von verschiedenen Kulturen ersetzt wird: Die Person ist im Marxismus und auch in der modernen Anthropologie ein „Produkt“ der Kultur und der Gesellschaft. Die eigentliche Prämisse ist nun der Relativismus.
Die Unmöglichkeit einer objektiven Realität – die zuweilen als Essentialismus bezeichnet wird – wird sodann von der analytischen Sprachphilosophie weiterentwickelt, die den Standpunkt vertritt, daß außerhalb der Sprache keine Realität existieren kann, sondern daß die Realität von der Sprache konstituiert wird. Diese gedankliche Strömung ist heute in dem allgegenwärtigen Konstruktivismus der Geistes- und Sozialwissenschaften präsent: Die politische Realität und insbesondere die Normen sind sozial konstruiert. Und auch die positivistische Wende in der Rechtsphilosophie, die einen Großteil des europäischen Rechtsdenkens prägt, verneint, daß der Begriff der Gerechtigkeit irgendeine Wahrheit für sich beanspruchen kann: Recht ist das, was der Buchstabe des Gesetzes sagt.
Dennoch wenden sich einige wichtige philosophische Schulen heute wieder der Metaphysik zu: So kehren die Sprachphilosophen in Oxford und Cambridge beispielsweise zum klassischen Personbegriff zurück. Der amerikanische Philosoph W. O. Quine schreibt in seinem berühmten Buch Word and Object (1960), daß Sprache sich auf Objekte beziehen muß, die der Sprache im Gegenzug Bedeutung verleihen – das heißt, daß die Objekte unabhängig existieren und die Sprache sie beschreibt und nicht umgekehrt, wie der Konstruktivismus und die analytische Sprachphilosophie es wollen.
Auch auf dem Kontinent finden wir wichtige Stimmen, die sich gegen den Tod der Metaphysik im Personalismus und in der Hermeneutik wenden. Personalistische Philosophen wie Jonas, Mounier, Ricoeur und der verstorbene Papst Johannes Paul II. haben unterstrichen, daß das Wissen über die menschliche Natur und die Ethik auf der Erfahrung des anderen beruht. Mounier selbst stellt fest, daß der klassische Begriff der Person „der beste Kandidat ist, um die rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Kämpfe zur Verteidigung der Menschenrechte zu verteidigen“ (nach Berti, S. 10). Der Grund hierfür ist vollkommen einfach und logisch: Wenn Gleichheit der zentrale Begriff des Rechts und der Politik ist, dann setzt dies voraus, daß man etwas über die menschliche Natur aussagen kann, das überall und immer gültig ist. Und das ist gleichzeitig auch der Kern meines Arguments, daß die Menschenrechte ein naturrechtlicher Begriff sind – sie beruhen auf der Würde und der Gleichheit des Menschen, und hierfür ist eine gemeinsame menschliche Natur die notwendige Voraussetzung.
Naturrecht heute: gibt es Beweise?
Bisher haben wir lediglich gezeigt, daß die philosophische Tradition des Westens viele Jahrhunderte lang am klassischen Begriff der „rationalen und sozialen“ menschlichen Natur festgehalten hat und daß die Metaphysik zuerst durch den britischen Skeptizismus, der die Geisteswissenschaften den Naturwissenschaften gleichsetzte, und später von immer breiteren skeptischen Strömungen ins Abseits gedrängt worden ist. Ein großer Teil dieser problematischen philosophiegeschichtlichen Entwicklung hängt jedoch mit dem enormen Fortschritt in den empirischen und den Naturwissenschaften und dem beklagenswert geringen Fortschritt in den Geisteswissenschaften zusammen. Und es hängt damit zusammen, daß diese beiden oft miteinander verwechselt werden und man davon ausgeht, daß die Geisteswissenschaften die Naturwissenschaften imitieren müssen, um Fortschritte zu erzielen.
Aristoteles ist jedoch durch nichts von alledem widerlegt worden. Die These, daß der Mensch über Ethik ebenso nachdenken kann wie über empirische Sachverhalte, bleibt bestehen. Humes Kritik, daß Aristoteles „Tatsachen und Werte“ verwechselt habe, trifft nicht zu, denn die klassische Vorstellung postuliert, daß die Person ihrem Wesen nach beides ist, Fakt und Wert, und daß rational zu sein auch bedeutet, ethisch zu sein. Das ist der Punkt, mit dem sich der moderne Mensch am schwersten tut, und Humes unglückselige Trennung des Rationalen und des Ethischen hat dazu geführt, daß die Philosophen nach ihm die Möglichkeit des Naturrechts aus den Augen verloren haben.
Nun aber wollen wir dem Naturrecht eine Chance geben. Könnte es sein, daß Aristoteles recht hat?
In einem interessanten Artikel erzählt der schwedische Abgeordnete Per Landgren von einem fiktiven Vorfall (Per Landgren, Det gemensamma basta – Om kristdemokratiens idegrund, Stockholm 2002, Kapitel 5: „Naturretten – en mansklig etikk“): Zwei Personen retten Menschen aus einem brennenden Haus. Anschließend werden sie von der Zeitung interviewt, und der Journalist fragt sie, warum sie ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hätten, um so etwas zu tun. Der eine sagt, er habe gar nicht darüber nachgedacht; er habe einfach gehandelt. Doch der andere sagt, er habe gedacht, daß er vielleicht eine Tapferkeitsmedaille bekommen und reich und berühmt werden würde. Der Journalist ist von dieser Antwort verblüfft. Etwas daran scheint falsch, unwürdig und unnatürlich zu sein.
Dieses Beispiel veranschaulicht die naturrechtliche Sichtweise: Es ist eine natürliche Reaktion, wenn man versucht, Leben zu retten, auch wenn man Angst hat. Unnatürlich ist es dagegen, wenn man etwas Derartiges tut, um Geld damit zu verdienen. Man könnte sogar sagen, daß die zweite Reaktion böse, schlecht und falsch ist – also gibt es in uns eine natürliche Fähigkeit, das Richtige und das Falsche voneinander zu unterscheiden.
Leben zu retten – das eigene und das der anderen – scheint außerdem ein grundlegender Wert zu sein, während das Bedürfnis, Geld zu verdienen, vielerlei sein kann, angefangen bei etwas Lebenswichtigem und Gutem, wenn man eine Familie zu versorgen hat, bis hin zu etwas Schlechtem, wenn ein Lebensretter wie in dem erwähnten Beispiel nur an das Geld denkt, das er auf diese Weise verdienen kann. Ethik ist also nur im Zusammenhang mit einem Telos sinnvoll, wie Aristoteles lehrt.
Landgren macht deutlich, daß es einige grundlegende Werte gibt, die allgemein als solche anerkannt werden: zu leben statt zu sterben, respektiert zu werden, gesund zu sein, zu lernen, die Wahrheit mehr zu lieben als die Lüge usw. Das Gegenteil dieser Werte ist morbide und unnatürlich, und die meisten Menschen würden dem spontan zustimmen. Diese grundlegenden Werte werden „innerlich“ genannt, sie sind „Grundwerte“ oder „Rechtsgüter“.
Das Entscheidende an diesen Werten ist, daß sie angeboren, innerlich und wesentlich sind – sie definieren, was der Mensch ist, genau wie in der Definition des Aristoteles. Das ist so, weil wir sie nicht von irgendwelchen Prinzipien oder logischen Argumenten ableiten können; sie entsprechen einfach dem, was grosso modo die Beschaffenheit des Menschen ist. Natürlich gibt es Massenmörder und Masochisten, doch wir neigen dazu, sie als Abirrungen, Pervertierungen und unnatürliche Erscheinungen zu beschreiben. Wenn wir wirklich Relativisten wären, dann müßten wir sagen, daß ein Massenmörder einfach andere subjektive Vorlieben hat als wir.
Wenn wir daher die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte lesen, sehen wir, daß die darin enthaltenen Rechte zu einem Großteil solche Grundprinzipien sind, über die sich alle vernünftigen Menschen einig sind. Vernünftig, wir erinnern uns, bedeutet, daß jemand aufrichtig und menschlich und nicht niederträchtig und böse ist. Der Urheber dieser menschlichen Natur, Schöpfer oder nicht, muß gar nicht erwähnt werden, doch die Rechte bilden ein Ganzes, das ein für den gesunden Menschenverstand erkennbares Menschenbild widerspiegelt. Wenn aber der Begriff der menschlichen Natur in Abrede gestellt wird, dann gibt es keine Basis für diese Menschenrechte – sie werden zu rein ideologischen und politischen Maßnahmen. Die menschliche Natur bleibt ein Axiom wie bei Aristoteles, eine Wesenheit und ein erster Beweger, wie er es genannt hätte.
Es bleibt jedoch voll und ganz möglich, mit Hilfe der deduktiven und der induktiven Vernunft zu erkennen, worin die Menschenwürde und folglich auch die Menschenrechte bestehen. Der rationale Verstand wird durch asketisches und logisches Training geschärft, und zwar sowohl im Bereich schlüssiger Argumentation – „Wenn alle Menschen gleich sind, kann ein Mensch nicht diskrimiert werden“ – als auch in der Ethik: „Wenn es falsch ist, zu stehlen, dann darf ich es nicht tun, weil sonst mein ethischer Sinn abstumpft.“ Das Problem liegt, glaube ich, nicht so sehr in einem Mangel an Vernunft als vielmehr in einem Mangel an Tugend. Es ist recht leicht, zu wissen, was falsch und was richtig ist, doch es ist ziemlich anstrengend und unbequem, das, was richtig ist, auch zu tun. Wie ein katholisches Sprichwort scherzhaft sagt: „A little virtue does not hurt you, but vice is nice” – eine kleine Tugend tut nicht weh, aber Laster machen Spaß.
Abschließend läßt sich sagen, daß die relativistische Position unhaltbar und die rationalistische Position zumindest möglich ist. Es gibt keinen Grund, die Ontologie des Aristoteles und den klassischen Personbegriff zu verwerfen, und es ist eine rein logische Notwendigkeit, daß das Recht auf der Grundlage von Universalien und nicht auf der Grundlage subjektiver Interessen formuliert wird. Dennoch bleibt es ein schwieriges Unterfangen, der Vernunft in der westlichen Politik wieder den Platz einzuräumen, der ihr zusteht.
Anmerkungen:
[1] Diese Enzyklika wendet sich an Katholiken und nicht an „alle Menschen guten Willens“. Sie ist also ein kircheninternes Dokument, das sich mit der Rolle der Kirche in der Welt befaßt. Es ist überaus bedeutsam, daß die Kirche für Nichtgläubige nur weltliche Beiträge zur politischen Debatte einer Gesellschaft leisten kann und darf, daß also eine klare Unterscheidung zwischen der auf die Gesellschaft der Gläubigen bezogenen internen Logik der Kirche und ihrer externen Rolle in der weltlichen Gesellschaft besteht, in der sie nur auf der Grundlage des Naturrechts handeln und argumentieren kann.
Es handelt sich bei diesem Text um das letzte Kapitel des Buches von Janne Haaland Matláry Veruntreute Menschenrechte. Droht eine Diktatur des Relativismus?, Sankt Ulrich Verlag Augsburg, 2006, ISBN: 978-3-936484-82-3, S. 181-201. Übersetzung aus dem Englischen von Gabriele Stein. Im Buch trägt das Kapitel den Titel Die “Tyrannei der Mehrheit” und ihr rationales Gegenmittel: Papst Benedikt XVI. Die Veröffentlichung auf kath-info erfolgt mit freundlicher Erlaubnis des Verlags.
C. S. Lewis über das Naturrecht
Die Quittung für den Konstruktivismus
Als im US-Präsidentschaftswahlkampf letztes Jahr über “Fake-News”, “alternative Fakten” und das “postfaktische Zeitalter” geredet wurde, konnte ich mir eine gewisse Schadenfreude nicht verkneifen. Denn die tonangebende “kulturwissenschaftliche Linke” (Michael Hampe) bekam hier die Quittung serviert für ihren jahrzehntelang gepredigten Konstruktivismus - für die Auffassung, dass es objektive Fakten gar nicht gibt, dass alles subjektiv ist und dass die Wirklichkeit gar nicht existiert.
Benjamin Hasselhorn in IdeaSpektrum vom 11. Oktober 2017, S. 23.
Die Vernunft und die Schönheit
“Eine Vernunft, die sozusagen das Schöne abstreifen würde, wäre eine halbierte, eine erblindete Vernunft. Nur beides miteinander gibt das Ganze, und grade für den Glauben ist dieses Miteinander wichtig. Er muß sich immer wieder den Herausforderungen des Denkens dieser Zeit stellen, damit er nicht als irgendeine irrationale Geschichte erscheint, die wir halt weiterführen, sondern wirklich Antwort auf die großen Fragen ist; damit er nicht nur Gewohnheit ist, sondern Wahrheit – wie Tertullian einmal gesagt hat.”
Papst Benedikt XVI. am 6. August 2008 in einem Gespräch in Brixen mit Geistlichen der Diözese Bozen-Brixen.
Benedikt XVI. als Anwalt der Vernunft
Sind Wunder möglich?
Meine Predigt zum 11. Sonntag nach Pfingsten: Ich gehe der Frage nach, ob Wunder mit der Vollkommenheit Gottes vereinbar sind.
Recktenwald-Predigten · 11. So. nach Pfingsten: Sind Wunder möglich?
Philosophen
Anselm v. C.
Bacon Francis
Bolzano B.
Ebner F.
Geach P. T.
Geyser J.
Husserl E.
Kant Immanuel
Maritain J.
Müller Max
Nagel Thomas
Nida-Rümelin J.
Pieper Josef
Pinckaers S.
Sartre J.-P.
Spaemann R.
Spaemann II
Tugendhat E.
Wust Peter
Autoren
Bordat J.
Deutinger M.
Hildebrand D. v.
Lewis C. S.
Matlary J. H.
Novak M.
Pieper J.
Pfänder Al.
Recktenwald
Scheler M.
Schwarte J.
Seifert J.
Seubert Harald
Spaemann R.
Spieker M.
Swinburne R.
Switalski W.
Wald Berthold
Wust Peter







