zur katholischen Geisteswelt
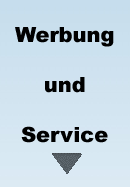
|
Zum
biographischen Bereich |
|
Zum englischen
und polnischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im philosophischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
liturgischen Bereich |
Themen
Atheismus
Atheisten
Atheist. Moral I
Atheist. Moral II
Aufklärung
Autonomie
Autonomiebuch
Biologismus
Entzauberung
Ethik
Euthanasie
Evolutionismus
Existenzphil.
Gender
Gewissen
Gewissen II
Glück
Glück und Wert
Gottesbeweis
Gottesglaube
Gotteshypothese
Handlung
Handlungsmotive
Das Heilige
Kultur
Kulturrelativismus
Langeweile
Liebe
Liebe II
Liebesethik
Menschenwürde
Metaethik
Methodenfrage
Moralillusion
Naturalismus
Naturrecht
Naturrecht II
Naturrecht III
Neurologismus
Opferidee
Philosophie
Proslogion
Relativismus
Sinnparadox
Sittengesetz
Sollen
Theodizee
Tierschutz
Verantwortung
Vernunftphil.
Vernunftrettung
Voluntarismus
Werte
Wirklichkeit
Wert und Motivation
Von Dietrich von Hildebrand
1. Kapitel: Der Begriff der Bedeutsamkeit im allgemeinen
Die Erfahrung zeigt, daß ein Seiendes, das Gegenstand unserer Erkenntnis werden kann, nicht notwendig unseren Willen oder unsere affektiven Antworten, wie Freude, Trauer, Begeisterung, Empörung usw. motiviert.
Wenn wir einen Verzweifelnden nach der Ursache seines Grames fragten und er antworten würde: „Weil zwei mal zwei vier ist“, oder „weil die Summe der Winkel eines Dreiecks gleich zwei rechten Winkeln ist“, so würden wir diese Tatsachen als Erklärung für seine Trauer selbstverständlich zurückweisen. Wir würden vielmehr annehmen, er wolle uns aus irgendeinem Grund ausweichen und weigere sich, uns den wahren Grund seines Schmerzes zu sagen, oder aber er verbinde diese Tatsachen abergläubisch mit etwas Unheilvollem. Vielleicht würden wir auch vermuten, er sei geisteskrank oder zumindest einer Neurose verfallen, in der die wahre Ursache seiner Verzweiflung ins Unterbewußtsein verdrängt wurde. Keineswegs würden wir zugeben, mathematische Feststellungen als solche könnten jemals seine Betrübnis oder Verzweiflung motivieren. Denn sie erscheinen uns derart neutral, daß nichts in ihnen eine affektive Antwort negativ oder positiv motivieren könnte.
Nun bezeichnen die Begriffe gut (bonum) und schlecht (malum) jedoch gerade die Eigenschaft eines Seienden, die es befähigt, unseren Willen zu motivieren oder eine affektive Antwort in uns hervorzurufen. Wir wollen jetzt noch nicht die Frage stellen, ob jedes Seiende als solches den Charakter eines bonum trägt, mit anderen Worten, ob es ein vollständig neutrales Seiendes gibt. Hier muß zunächst geklärt werden, ob Seiendes existiert, das uns als neutral oder indifferent gegeben ist, wenigstens so weit, daß es uns nicht diejenige Eigenschaft enthüllt, durch die es uns bewegen und unseren Willen, unsere Freude, unsere Trauer, unsere Hoffnung oder unsere Furcht motivieren kann.
Das Besondere, wodurch ein Gegenstand eine affektive Antwort hervorrufen oder unseren Willen motivieren kann, wollen wir „Bedeutsamkeit“ nennen. Wir sind uns voll bewußt, daß das Wort „Bedeutsamkeit“ oft in einem anderen Sinne gebraucht wird, wollen es hier aber als Terminus technicus für jene Proprietät des Seienden verwenden, die ihm den Charakter des bonum oder malum verleiht; kurz, „Bedeutsamkeit“ wird hier als Antithese zur Neutralität oder Indifferenz genommen. [1]
Ohne Zweifel ist der Begriff der „Indifferenz“ ein notwendiger und bedeutsamer, selbst wenn die endgültige Analyse ergibt, daß etwas vollständig Indifferentes oder Neutrales nicht existiert. Auch der Begriff der Nichtexistenz ist sinnvoll und notwendig, obgleich es keine „Nicht-Existenz“ gibt und obwohl kein wirklich Seiendes besteht, von dem wir sagen können, es existiere nicht.
Doch abgesehen von der Tatsache, daß der Begriff der Indifferenz, der dem der Bedeutsamkeit entgegengesetzt ist, durchaus nicht leer und sinnlos ist, besteht kein Zweifel, daß diese Unterscheidung zwischen dem Neutralen oder Indifferenten und seinem Gegensatz, der positiven oder negativen Bedeutsamkeit, eine große Rolle in unserem Leben spielt. Viele Tatsachen und Gegenstände haben für uns den Charakter des Neutralen und Indifferenten und können trotzdem sehr wohl Objekt unserer Erkenntnis, keinesfalls aber Objekt unseres Willens, unseres Wünschens oder irgendeiner affektiven Antwort, wie Freude, Trauer, Begeisterung, Empörung usw. werden.
Ein Gegenstand muß mit irgendeiner Art von Bedeutsamkeit ausgestattet, muß der bloßen Neutralität oder Indifferenz enthoben sein, um den Willen oder irgendeine affektive Antwort zu motivieren. Es genügt nicht zu sagen: Nihil volitum nisi cogitatum — Nichts wird gewollt, was nicht zuerst erkannt ist. Wir müssen hinzufügen: Nichts kann gewollt werden, was uns nicht als irgendwie bedeutsam gegeben ist. Solange der Gegenstand vollkommen indifferent oder neutral vor uns steht, ist er seinem Wesen nach außerstande, unseren Willen zu motivieren oder eine affektive Antwort in uns zu erzeugen.
Daher unterscheiden wir im Bereich unserer Erfahrung eindeutig zwischen neutralem und bedeutsamem Seienden. Sollte uns die Metaphysik später lehren, daß diese Indifferenz keine absolute ist, oder uns eine tiefere Analyse enthüllen, daß jedes Seiende eine Bedeutsamkeit in unserem Sinne hat, so können wir die erlebte Indifferenz als eine relative betrachten. Aber diese metaphysische Einsicht würde niemals die in unserer Erfahrung bestehende Verschiedenheit zwischen Indifferentem und dem Bedeutsamen selbst aufheben. Erstens könnte sie nicht den charakteristischen Unterschied zwischen den Gegenständen auslöschen, die sich uns als indifferent und neutral zeigen (und darum als außerstande, uns zu bewegen und zu affizieren), und jenen, die sich uns als bedeutsam darbieten (und daher imstande sind, unseren Willen und unsere affektiven Antworten zu motivieren). Diese Verschiedenheit bleibt eine reale und inhaltsvolle, selbst wenn das indifferent Seiende in einer tieferen Schicht eine verborgene Bedeutsamkeit aufweist.
Überdies würde das primäre Interesse an der Unterscheidung zwischen den Begriffen der Indifferenz und der Bedeutsamkeit in keiner Weise durch die Tatsache verringert, daß selbst das scheinbar indifferente Seiende, letztlich oder metaphysisch gesehen, eine Bedeutsamkeit besitzt. Es ist daher von größter Wichtigkeit, das datum der Bedeutsamkeit und seinen vollen Sinn zu erkennen. Wenn die Metaphysik uns lehrt, jedes Seiende sei tatsächlich bedeutsam in unserem Sinne, so hat diese Feststellung keineswegs einen tautologischen Charakter. Sie würde im Gegenteil eine überraschende Entdeckung enthalten und eine echte veritas aeterna (ewige Wahrheit) im augustinischen Sinn darstellen, oder mit den Worten der scholastischen Philosophie: ein analytisches Urteil des zweiten Modus der Perseität.
Zweifellos ist die Relation zwischen Bedeutsamkeit und unserem Willen oder jeder unserer affektiven Antworten so evident, daß wir sie ungeachtet einer mechanistischen oder einer Assoziations-Psychologie instinktiv voraussetzen, sobald wir es mit der Wirklichkeit, hier also mit der Motivierung in der einzelnen Person zu tun haben.
Das Wissen um diese Tatsachen zeigt sich uns auch als Grundlage fürdie große Freudsche Entdeckung des Phänomens der Verdrängung. Ob wohl sein theoretischer Ausgangspunkt sicherlich keine philosophische Einsicht in diese Tatsache einschließt, baut er nichtsdestoweniger auf ihr auf, wenn er gewisse Motivationen als anomal betrachtet und es in diesen Fällen ablehnt, das vom Bewußtsein angegebene Objekt als das echte anzuerkennen.
Ohne das metaphysische Problem des Ursprungs des Bösen vorwegzunehmen, müssen wir uns hier dem Staunen über die Natur der Bedeutsamkeit und über die Art der Antithetik zwischen positiver und negativer Bedeutsamkeit überlassen. Mit der Feststellung, unser erstes Anliegen solle die Eigenart des unbestreitbaren datum positiver und negativer Bedeutsamkeit sein, beschränken wir uns keineswegs darauf, bloß subjektive Eindrücke, also für den menschlichen Geist relative Seinsgebilde zu analysieren. Im Gegenteil, wir konzentrieren uns auf ein Thema von größtem metaphysischen und gesamtphilosophischen Interesse, von klar umrissener objektiver Bedeutung. Der sinnvolle, innerlich notwendige Charakter der beiden data positiver und negativer Bedeutsamkeit oder Gut und Schlecht schließt von vornherein jede Möglichkeit aus, sie als bloße „Phänomene“ zu interpretieren. [2]
2. Kapitel: Bedeutsamkeit und Motivation
Um die verschiedenen Typen von Bedeutsamkeit herausarbeiten zu können, müssen wir mit der Untersuchung der data anfangen, die imstande sind, unseren Willen zu motivieren, affektive Antworten zu erzeugen oder unsere Seele zu bewegen.
Wenn wir unsere Untersuchung mit jenem Merkmal eines Seienden beginnen, vermöge dessen es unser Begehren motiviert, so bedeutet das keine neue Betrachtungsweise. Eine traditionelle Definition des Guten lautet: Bonum est quod omnes desiderant — Gut ist, was alle begehren. Doch im Unterschied zu dem traditionellen Ausgangspunkt wollen wir den Begriff der Motivation oder des desiderare nicht über die personale Sphäre hinaus erweitern, vielmehr von der Motivation im ursprünglichen Sinne ausgehen, also von einer Relation, die wesenhaft eine Person voraussetzt. Wir wollen bei dem desiderare im Sinne eines personalen Aktes ansetzen, wie er uns in der Erfahrung gegeben ist. Daher möchten wir eine Anwendung dieser Termini auf irgendeine Finalrelation in der Sphäre der Lebewesen wie des unbelebten Seienden ausschließen, dergemäß man z. B. sagen würde: jedes Seiende begehrt nach Selbstvollendung.
Da wir von dem unmittelbar Gegebenen, von den sich unmittelbar in der Erfahrung enthüllenden data ausgehen wollen, werden wir uns jedes analogischen Gebrauches dieser Termini enthalten, der das Erfassen der spezifischen Eigenart der Motivation oder des desiderare gefährdet. Die Gefahr einer solchen Ausweitung besteht darin, daß man diese Termini bei der Analyse des Wirklichen anwendet, jedoch eine apersonale Relation zugrunde legt und so den wesenhaft personalen Sinngehalt dieser Termini übersieht. Viele Philosophen mögen entgegnen, unsere Methöde schließe die metaphysische Sphäre aus und beschränke uns auf die psychologische. [3] Aber das scheint uns ein Vorurteil zu sein. Sollte etwas darum metaphysischer sein, weil es keine Person voraussetzt oder weil es sich auf apersonales Seiendes bezieht? [4]
Dieses Vorurteil beruht offenbar auf einer Verwechslung jener Dinge, die nur für den menschlichen Geist existieren (wie bloßer Schein oder Fiktion) mit personalen Akten (wie Erkenntnis, Wille, Liebe, Freude). Diese letzten sind unverkennbar nicht nur Realitäten für den Geist der Person, sondern zugleich objektive Wirklichkeiten, Aktualisierungen und Manifestationen der Person selbst. Sie sind reale, bewußte Entitäten, von bloß „psychologischer“ Realität so weit entfernt wie irgendein Vorgang in der materiellen Welt oder irgendein physiologischer Prozeß. Und diese Wirklichkeiten sind nicht nur ebenso objektiv vorhanden wie Vorgänge in der materiellen Welt und ebenso verschieden von bloßer Illusion oder Fiktion; sie haben darüber hinaus einen unvergleichlich höheren Rang, denn sie gehören zum Reich des Geistes.
Der personale Charakter des desiderare
Vom metaphysischen Standpunkt aus ist es von höchster Wichtigkeit, uns von jeglicher Denkweise frei zu machen, in der das apersonale Seiende, apersonale Relationen und Prinzipien als Urbild (causa exemplaris) der höheren Sphäre fungieren. Wenn wir diese Betrachtungsweise nicht überwinden, sind wir in Gefahr, das spezifische Wesen dieser Akte zu übersehen oder es zu verfälschen, indem wir sie auf eine Art bloßer Bewegungen oder Spannungen reduzieren, die nur in der nicht personalen Welt vorhanden sind.
Eine andere Gefahr ist, daß man ihre Fülle, ihre ontologische Überlegenheit übersieht, die zutiefst mit ihrem Charakter als bewußte Entitäten zusammenhängt. Diese Gefahr steht in Analogie zu dem Freudschen Irrtum, die Liebe als bloße Sublimierung des Geschlechtstriebes zu sehen. In beiden Fällen wird etwas metaphysisch tiefer Stehendes zur causa exemplaris eines Höheren gemacht. Beide Male wird das uns in einem bewußten Erlebnis als Ganzes Gegebene außer acht gelassen und in einem ausschließlich psychologischen Zusammenhang gesehen. Der Bewußtseinsbereich wird als verdächtig und ungültig behandelt. Eine solche Betrachtungsweise mag für Dinge, die nur als Bewußtseinsinhalte Existenz haben, tunlich sein, auf reale Akte der Person, wie Erkenntnis, Wille und Liebe angewandt, die keineswegs bloße Bewußtseinsinhalte, sondern bewußte objektive Wirklichkeiten sind, kann sie nicht angewandt werden. Ihr Charakter als ein bewußtes Seiendes, ihre ontologische Überlegenheit Vorgängen oder Spannungen in der apersonalen Welt gegenüber schmälert ihre Gültigkeit als objektive Realitäten nicht um ein Gran [5].
Wenn wir hier also gewisse Ausdehnungen der Termini „Motivation“ und desiderare ausschließen, so muß der Begriff der Motivation nach einer anderen Richtung hin erweitert werden. Das bonum kann nämlich nicht auf den Gegenstand eines möglichen Begehrens beschränkt werden. Im Gegenteil, wir müssen auch die Objekte in unsere Untersuchung einbeziehen, die imstande sind, Freude, Begeisterung, Verehrung oder Achtung in uns zu erzeugen, ebenso jene, die uns tief zu ergreifen vermögen. Diese Erlebnisse und Akte können offenbar nicht unter den Terminus desiderare, selbst nicht im weitesten Wortverstande, zusammengefaßt werden.
Nun ist aber sogar der Ausdruck desiderare als solcher noch nicht eindeutig. Da ist zuerst der buchstäbliche Sinn, in dem desiderare das Besitzenwollen eines Gutes bedeutet. Wir begehren, eine Speise zu essen, einen Wein zu trinken, ein Land zu sehen, schöne Musik zu hören, mit einer geliebten Person vereinigt zu sein. In all diesen Fällen richtet sich das desiderare auf bona, die man besitzen kann, die ein Genießen im strikten Sinn zulassen; hier geht es nicht nur um die Frage nach der Existenz eines Gutes, sondern es ist auch eine spezifische Aneignung, ein Meinwerden möglich. Wir können sagen: Dieses typische Begehren ist auf den Besitz eines Gutes gerichtet; sein Formalobjekt ist das Besitzen oder das Genießen eines Gutes. Wie wir später sehen werden, kann man von manchen Gütern Besitz ergreifen, während andere diese Möglichkeit ausschließen. Folglich ist es unmöglich, den Begriff des bonum auf diesen einen Typus des desiderare zu beschränken, dem gemäß wir ein Gut zu besitzen und uns an ihm als unserem Eigentum zu freuen trachten.
Desiderare kann auch in dem weiteren Sinn jedes positiven Interesses an der Existenz eines Gutes verstanden werden. Dann erstreckt es sich nicht allein auf unser Trachten nach dem Besitz des Gutes, sondern auch auf unser Streben nach seiner Existenz. Sein Formalobjekt ist das Realwerden eines noch nicht existierenden Gutes. Ein solches Verlangen ist in jedem echten Wollen wie in jedem Wünschen enthalten. In diesem Sinne verlangen wir danach, daß unser Freund gesund sei, daß die Gerechtigkeit triumphiere, daß ein Sünder sich bekehre usw. Diese Akte sind auf die Zukunft gerichtet: entweder auf das Entstehen eines Etwas oder auf die Fortdauer seiner Existenz.
Doch selbst in dieser weiteren Bedeutung deckt sich Begehren nicht vollauf mit unseren positiven Haltungen einem Gut gegenüber. Freude, Begeisterung, Verehrung können weder im engeren noch im weiteren Sinne des Wortes als ein desiderare gedeutet werden. Es ist z. B. klar, daß Freude über die Bekehrung eines Sünders kein desiderare im strikten Sinn des Wortes ist; denn die Bekehrung ist kein Gut, das man besitzen, das man sich aneignen könnte. Diese Freude bezieht sich vielmehr auf die Tatsache der Bekehrung selbst und nicht auf irgendein Besitzverhältnis zu ihr, das hier gar nicht in Frage kommt.
Aber diese Freude ist auch kein Begehren im weiteren Sinn. Ihr Formalobjekt ist nicht das Wirklichwerden eines Etwas. Sie ist eine Antwort auf etwas schon Existierendes, etwas bereits Geschehenes.
Daher müssen wir in unsere Untersuchung der verschiedenen Bedeutsamkeitstypen auch die Frage einbeziehen: Welcher Sinn von bonum ist auf der Objektseite gegeben, wenn wir uns über die Bekehrung eines Sünders freuen oder den Genius Platos bewundern?
Notwendigkeit und Intelligibilität der Bedeutsamkeitskategorien
Ein Studium der Bedeutsamkeitskategorien, die unseren Willen oder unsere affektiven Antworten motivieren können, d. h. eine Untersuchung der Gesichtspunkte, nach denen etwas den Charakter des Bedeutsamen annimmt, ist von größtem philosophischem Interesse. Wir werden uns später darüber hinaus fragen müssen: Welche Arten der Bedeutsamkeit erweisen sich als Proprietäten des Seienden selbst, unabhängig von dem Gesichtspunkt, nach dem wir uns ihnen zuwenden können? Dies ist offenbar eine neue, andersartige Frage. Nichtsdestoweniger ist die Analyse der möglichen Gesichtspunkte, nach denen Etwas als ein Gut betrachtet werden kann, keineswegs ein Problem aus dem Bereich der empirischen Psychologie. Diese beschäftigt sich mit Phänomenen wie der Verdrängung, dem Prozeß des Erlernens, den Assoziationsgesetzen usw. Dagegen befaßt sich eine Untersuchung der verschiedenen Gesichtspunkte, nach denen einem Gegenstand Bedeutsamkeit zukommt, mit notwendigen, im höchsten Maß intelligiblen data, analog den aristotelischen Kategorien der Prädikation.
Selbst als Gesichtspunkte der Erkenntnislehre überschreiten die Kategorien auf Grund ihrer Intelligibilität und ihrer letztlichen Sinnträchtigkeit den Rahmen rein empirischer Psychologie. Das gilt auch für die Bedeutsamkeitskategorien. Sogar als mögliche Gesichtspunkte einer Motivation betrachtet, erweisen sie sich als ebenso klar umrissene und intelligible Begriffe wie die der logischen Sphäre. Ihre Einsichtigkeit und ihr dichter Sinngehalt verleihen ihnen eine hohe philosophische Bedeutung. Hier stehen wir nicht psychologischen Phänomenen gegenüber, die nur empirischer Beobachtung zugänglich sind. Es ist nicht unsere Absicht, das Vorhandensein gewisser Bedeutsamkeitstypen in unserer Motivation nur als nacktes empirisches Faktum festzustellen. Wir wollen vielmehr die apriorische [6] Einsicht gewinnen, daß bestimmte Typen von Bedeutsamkeit wirklich existieren. Diese Einsicht kann als Analogon zu jener Erkenntnis betrachtet werden, in der wir ein Urteil als kategorisch, hypothetisch oder alternativ bezeichnen oder in der wir sagen, ein Urteil könne entweder positiv oder negativ sein.
Doch ihre innere Notwendigkeit und Intelligibilität, die sie prägt, schließt sie nur von dem Gebiet der empirischen Psychologie aus, und nicht unbedingt von dem der rationalen Psychologie, die Wesensforschung ist. Denn diese, d. h. die philosophische Anthropologie, befaßt sich gleichfalls mit notwendigen, intelligiblen Seinsgebilden und zielt auf apriorische Einsichten. Gleichwohl können die Bedeutsamkeitskategorien aus einem anderen Grund nicht als Gegenstand der Philosophie vom Menschen angesehen werden. Diese beschäftigt sich ausschließlich mit Seinsgebilden, die ein realer Bestandteil der menschlichen Person sind. Offenbar sind die Kategorien der Prädikation, obwohl sie eine denkende Person voraussetzen, nicht selbst ein realer Teil des menschlichen Geistes. Darum sind sie nicht Gegenstand der philosophischen Anthropologie, sondern der Logik. Analog dazu sind die Bedeutsamkeitskategorien, d. h. die Gesichtspunkte, nach denen etwas den Charakter der Bedeutsamkeit annimmt, kein realer Teil der menschlichen Seele; darum können sie nicht als Gegenstand der rationalen Psychologie gelten. Auf der anderen Seite bestreiten wir nicht, daß sich aus diesen Phänomenen auch für die Philosophie vom Menschen viele interessante Probleme ergeben.
Nach der Erörterung der Bedeutsamkeitskategorien als grundlegender Gesichtspunkte der Motivation werden wir jetzt nach den Arten der Bedeutsamkeit fragen, die das Seiende selbst, unabhängig von jeder Zuwendung zu ihm besitzen kann.
Wir müssen hier betonen: Eine Analyse der verschiedenen Bedeutsamkeitstypen ist nicht nur unerläßlich für die Erforschung des metaphysischen Problems, welche Art der Bedeutsamkeit das Sein und das Seiende in sich besitzen; sie ist auch von höchstem Interesse für das Subjekt der Ethik. Nicht nur das Wesen des Objektes unseres Willens ist in der Ethik von überragender Wichtigkeit, sondern auch der Gesichtspunkt, unter dem sich eine Person diesem Objekt zuwendet. Denn der Gesichtspunkt, nach dem wir etwas wählen, ist durchaus nicht mit der objektiven Bedeutsamkeit des Gegenstandes selbst identisch, wie das klassische Beispiel einer sittlich bösen Haltung zeigt.
3. Kapitel: Die Kategorien der Bedeutsamkeit
Das in sich Bedeutsame und das bloß subjektiv Befriedigende
Wir wollen unsere Analyse der verschiedenen Kategorien von Bedeutsamkeit, die unseren Willen und unsere affektiven Antworten motivieren können, mit einem Vergleich der beiden folgenden Erlebnisse beginnen:
Nehmen wir erstens an, jemand mache uns ein Kompliment. Wir merken vielleicht, daß wir es nicht ganz verdienen, aber es ist uns dennoch angenehm, es gefällt uns. Es ist nichts Neutrales und Indifferentes für uns, wie wenn uns jemand erklärt, sein Name beginne mit einem T. Vielleicht werden uns viele andere Dinge vor diesem Kompliment gesagt, Dinge von neutralem und indifferentem Charakter, aber jetzt tritt das Kompliment gegenüber allen anderen Feststellungen in den Vordergrund. Es stellt sich uns als angenehm dar, ausgestattet mit den Merkmalen eines bonum, kurz als etwas Bedeutsames.
Nehmen wir ferner an, wir seien Zeugen einer großmütigen Tat geworden, jemand habe ein schweres Unrecht verziehen. Auch hier fällt uns ein Unterschied zu neutralen Tätigkeiten auf, z. B. zum Sichankleiden oder Eine-Zigarette-Anzünden. Der Akt des großmütigen Verzeihens leuchtet in der Tat als etwas Edles und Kostbares auf; er trägt das Merkmal des Bedeutungsvollen. Er bewegt uns und erweckt unsere Bewunderung. Wir erkennen nicht nur, daß diese Tat sich ereignet, sondern daß es besser ist, daß sie sich ereignet, besser, dieser Mann handelt so und nicht anders. Wir sind uns bewußt, dieser Akt ist bedeutsam, er ist etwas, was sein soll.
Vergleichen wir diese beiden Typen des Bedeutsamen, so entdecken wir sogleich die wesenhafte Verschiedenheit zwischen ihnen. Der erste — das Kompliment — ist nur subjektiv bedeutsam, der andere dagegen — der Akt des Verzeihens — in sich bedeutsam. Es ist uns ganz klar, das Kompliment trägt nur, soweit es uns Freude macht, den Charakter des Bedeutsamen. Seine Bedeutsamkeit zehrt ausschließlich von seiner Relation auf unsere Befriedigung; sobald es von dieser geschieden wird, sinkt es zurück in die Anonymität des Neutralen und Indifferenten.
Im Gegensatz dazu erweist sich der großmütige Akt des Verzeihens als etwas in sich Bedeutsames. Wir sind uns deutlich bewußt, daß seine Bedeutsamkeit in keiner Weise von irgendeiner Wirkung abhängt, die er in uns hervorruft. Seine besondere Bedeutsamkeit zehrt nicht von irgendwelcher Beziehung zu unserem Vergnügen und unserer Befriedigung. Er steht vor uns als etwas wesenhaft und autonom Bedeutsames, das in keiner Weise von unserer Reaktion abhängig ist.Auch unsere Sprache bringt diese grundlegende Unterscheidung zum Ausdruck. Die Bedeutsamkeit des Angenehmen oder Befriedigenden wird immer durch die Präposition „für“ ausgedrückt: Etwas ist angenehm für oder befriedigend für jemanden. Die Termini „angenehm“ und „befriedigend“ können als solche nicht auf einen Gegenstand angewandt werden, sondern nur, insoweit sie eine Person oder analog ein Tier betreffen. Andererseits verlangen die Ausdrücke „heroisch“, „schön“, „edel“, „erhaben“ durchaus nicht die Präposition „für“; sie widersprechen ihr vielmehr. Ein Akt der Liebe ist nicht erhaben für jemanden, sowenig wie die Neunte Symphonie Beethovens oder ein herrlicher Sonnenuntergang schön für jemanden ist.
Die innere Bedeutsamkeit eines großmütigen Aktes des Verzeihens bezeichnen wir als „Wert«, zum Unterschied von der Bedeutsamkeit aller jener Güter, die unser Interesse nur darum erregen, weil sie angenehm oder befriedigend für uns sind.
Aber sind sich diese beiden wesenhaft verschiedenen Typen der Bedeutsamkeit nicht doch in einer anderen Hinsicht ähnlich? Ist es nicht wahr, daß das Gute, Schöne, Edle, Erhabene uns tief ergreift, uns mit Freude und Entzücken erfüllt? Gewiß lassen sie uns nicht indifferent. Spendet uns jedes volle Erlebnis der Schönheit nicht notwendig Beglückung? Freuen wir uns nicht, wenn die Liebe oder Großmut eines Menschen unser Herz berührt? Solche Wonne, solches Entzücken sind tatsächlich wesenhaft verschieden von dem Vergnügen, das ein Kompliment hervorruft. Doch hebt dieser Unterschied wirklich die Tatsache auf, daß in beiden Fällen eine ähnliche Beziehung auf ein freudevolles Erlebnis zu finden ist?
Sicherlich haben die Dinge, die wir in sich selbst bedeutsam nennen, die werttragenden Dinge, die Fähigkeit, Freude zu spenden. Doch wird eine Analyse des spezifischen Charakters der Freude noch deutlicher die wesenhafte Verschiedenheit dieser beiden Arten der Bedeutsamkeit erweisen. Sie wird zeigen, daß der Wert seine Bedeutsamkeit unabhängig von seiner Wirkung auf uns besitzt.
Das Entzücken, die Ergriffenheit, die wir als Zeuge einer edlen sittlichen Tat oder beim Anblick der Schönheit eines sternenbesäten Himmels erleben, setzt wesenhaft das Bewußtsein voraus, daß die Bedeutsamkeit des Gegenstandes in keiner Weise von der Freude, die er uns schenkt, abhängt. Denn diese Seligkeit erwächst gerade aus unserer Konfrontation mit einem in sich selbst bedeutsamen Gegenstand, der majestätisch und autonom in seiner Erhabenheit und Hoheit vor uns steht. Es gehört gerade zu unserer Seligkeit, daß wir hier einen Gegenstand finden, der vollkommen unabhängig von unserer Reaktion auf ihn ist, dessen Bedeutsamkeit wir nicht verändern, weder erhöhen noch verringern können; denn sie erwächst ihm nicht aus seinem Verhältnis zu uns, sondern aus seiner eigenen Ranghöhe. Er steht gleichsam als eine Botschaft von oben vor uns; er trägt uns über uns selbst hinaus.
Deshalb ist der Unterschied zwischen dem Glück, das der bloßen Existenz eines Wertes entströmt, und dem Vergnügen an etwas subjektiv Befriedigendem kein Unterschied des Grades, sondern der Art: eine Wesensverschiedenheit. Ein Leben, das in einem ununterbrochenen Strom von Vergnügungen bestünde, die nur subjektiv Befriedigendes zur Ursache haben, könnte uns niemals einen Augenblick jenes seligen Glückes gewähren, das echt werthaltige Wirklichkeiten erzeugen.
Darum ist der Unterschied zwischen der egozentrischeri Lust, die Aristippos als das einzig wahre Gut hinstellte, und dem Glück, nach dem Sokrates und Platon rangen, kein bloßer Gradunterschied, sondern einer des Wesens (vgl. Augustinus, Sermo 179, 6). Egozentrisches Glück zehrt sich auf die Dauer selbst auf und endet in Langeweile und Leere. Das beständige Genießen des bloß subjektiv Befriedigenden wirft uns schließlich in unsere eigene Begrenztheit zurück und kerkert uns in uns selbst ein. Unsere Zuwendung zu einem Wert erhebt uns dagegen, befreit uns vom Kreisen um uns selbst und trägt uns in eine von uns selbst, unseren Stimmungen, unserer jeweiligen Verfassung unabhängige transzendente Ordnung. Dieses beglückende Erlebnis setzt eine Teilhabe an dem in sich Bedeutsamen voraus; ihm wohnt eine Harmonie inne, die allein das in sich Gute, das wesenhaft Edle ausstrahlen. Es entfaltet eine Leuchtkraft vor uns, die mit der inneren Schönheit und Herrlichkeit des Wertes „konsubstantial“ (kongenial) ist. In dieser einzigartigen Berührung mit dem wahrhaft und autonom in sich Bedeutsamen ist es der Gegenstand, der unseren Geist birgt und umfängt.
Im Prolog zu Wagners Oper Tannhäuser, in der Venusbergszene, sehen wir Tannhäusers Verlangen, den Bannkreis eines Lebens zu durchbrechen, das Lust um Lust verlangt. Er würde sogar edles Leiden dieser Einkerkerung im eigenen Ich vorziehen. Hier begegnen wir einigen Elementen dieser Sehnsucht nach etwas in sich Bedeutsamem, dem allein wir uns im wahren Sinn des Wortes hingeben können. Diese Sehnsucht, einer alle Egozentrik überragenden Wirklichkeit gegenüberzustehen, die uns verpflichtet und uns befähigt, die Grenzen unserer ausschließlich in unserer Natur [7] wurzelnden subjektiven Neigungen, Strebungen und Triebe zu übersteigen, gehört wahrhaft zum tiefsten Wesen des Menschen.
Wir können also sagen: Beide, der Wert und das subjektiv Befriedigende, vermögen uns zu erfreuen. Aber gerade die Natur dieser Freude zeigt klar die wesenhafte Verschiedenheit der beiden Arten von Bedeutsamkeit. Das echte, tiefe Glück, das der Wert in uns bewirkt, schließt notwendig ein Wissen um die innere Bedeutsamkeit des Gegenstandes ein. Dieses Glück ist wesenhaft ein Begleitphänomen, denn es ist in keiner Weise die Wurzel dieser Bedeutsamkeit, sondern strömt als Überfluß aus ihr hervor. Das Bewußtsein, daß ein großmütiger Akt des Verzeihens seine Bedeutsamkeit unabhängig davon besitzt, ob ich von seiner Existenz weiß oder nicht, ob ich mich über ihn freue oder nicht, ist geradezu die Wurzel des Glückes, das wir erleben, wenn wir ihm gegenüberstehen. Darum ist dieses Glück etwas Sekundäres, ungeachtet der Tatsache, daß die Fähigkeit, uns Freude zu spenden, ein wesentliches Merkmal der Werte ist. Wir sollen uns sogar an ihnen freuen. Der Wert ist hier das principium (das Bestimmende) und unser Glück das principiatum (das Bestimmte).
Im Falle des subjektiv Befriedigenden dagegen ist unser Vergnügen das principium und die am Gegenstand haftende Bedeutsamkeit des Angenehmen oder Befriedigenden das principiatum.
Werte fordern adäquate Antworten
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal finden wir in der Weise, in der jeder Bedeutsamkeitstypus sich an uns wendet. Jedes werttragende Gut legt uns gleichsam die Verpflichtung auf, ihm eine adäquate Antwort zu geben. Wir sprechen hier noch nicht von der einzigartigen Verpflichtung, die wir die sittliche nennen und die an unser Gewissen appelliert. Sie geht nur von bestimmten Werten aus. Wir denken jetzt an den Eindruck, den wir empfangen, sobald wir mit etwas in sich Bedeutsamem konfrontiert werden, etwa mit der Schönheit in Natur und Kunst, mit der Erhabenheit einer großen Wahrheit, mit der Herrlichkeit sittlicher Werte. In all diesen Fällen sind wir uns deutlich bewußt, daß der Gegenstand eine adäquate Antwort von uns fordert. Wir begreifen, daß es weder unserer willkürlichen Entscheidung noch unserer zufälligen Stimmung überlassen ist, ob wir antworten oder nicht und wie wir antworten. Andererseits stellen bloß subjektiv befriedigende Gegenstände keine Forderung dieser Art an uns. Sie ziehen uns an, laden uns ein; aber es ist uns ganz klar, daß wir ihnen keine Antwort schulden und es uns freisteht, ihrer Einladung zu folgen oder nicht. Wenn uns ein köstliches Gericht lockt, spüren wir deutlich, daß es ganz in unserem Belieben steht, ob wir dieser Verlockung nachgeben oder nicht. Wir alle wissen, wie lächerlich es wäre, wollte jemand sagen, er unterwerfe sich der Verpflichtung, Bridge zu spielen und überwinde die Versuchung, einem Kranken zu helfen.
Die Forderung eines echten Wertes nach adäquater Antwort ergeht an uns in souveräner, aber unaufdringlicher, soberer Weise. Sie appelliert an unser freies Personenzentrum [8]. Die Anziehungskraft des subjektiv Befriedigenden lullt uns dagegen ein und versetzt uns in einen Zustand, in dem wir dem Instinkt nachgeben; sie hat die Tendenz, unser freies Personenzentrum zu entthronen. Diese Aufforderung ist hartnäckig, nimmt häufig den Charakter einer Versuchung an, will unser Gewissen ablenken und zum Schweigen bringen und sich unser aufdringlich bemächtigen. Ganz anders ist der Anruf der Werte: er hat keinen aufdringlichen Charakter; er spricht zu uns von oben her, in soberer Distanz; er spricht mit der Kraft der Objektivität, einen majestätischen Anspruch erhebend, den wir mit unseren Wünschen nicht zu ändern vermögen [9].
Schließlich spiegelt sich die wesenhafte Verschiedenheit beider Bedeutsamkeitskategorien deutlich in der Art, in der wir auf sie antworten. Betrachten wir die Begeisterung, mit der wir auf eine heroische sittliche Tat reagieren, und vergleichen wir diese Antwort mit unserem Interesse an etwas subjektiv Befriedigendem, z. B. einer vorteilhaften geschäftlichen Spekulation. Wir sehen klar, daß unsere Antwort im ersten Falle den Charakter einer Hingabe unserer selbst, eines Hinaus-gehens über die Grenzen unserer Ichbezogenheit, einer gewissen Unterwerfung hat.
Das Interesse an dem subjektiv Befriedigenden offenbart dagegen eine Ichbefangenheit, ein Beziehen des Objektes auf uns selbst, auf die egozentrische Befriedigung, für die wir es benützen. Hier konformieren wir uns nicht dem Gut und seiner in sich ruhenden Bedeutsamkeit, wie im Fall der Bewunderung einer heroischen sittlichen Tat. Das Interesse an der geschäftlichen Spekulation besteht vielmehr darin, daß wir das Objekt uns selbst anpassen. Wir sind vielleicht völlig von ihm eingenommen, investieren große Energie in dieses Unternehmen, versagen uns seinetwegen viele Vergnügungen. Doch im dynamischen Gehabtsein von einem subjektiv Befriedigenden liegt noch nichts von dem Wesen wahrer Hingabe, nichts von diesem Sichausliefern an etwas wahrhaft und um seiner selbst willen Bedeutsames [10].
Wir haben also vier Merkmale genannt, die den fundamentalen Unterschied zwischen dem in sich Bedeutsamen oder Wert und dem bloß subjektiv Befriedigenden aufzeigen.
Kein Grad-, sondern Wesensunterschied von Wert und subjektiv Befriedigendem
Die Verschiedenheit von Wert und nur subjektiv Befriedigendem ist zuweilen als bloßer Gradunterschied interpretiert worden. Man hat angenommen, der Unterschied zwischen der inneren Bedeutsamkeit der Gerechtigkeit und der nur subjektiven Bedeutsamkeit des Angenehmen (z. B. die angenehme Qualität eines warmen Bades oder einer vergnüglichen Bridgepartie) bestehe nur in der Tatsache, daß das erste einen höheren Rang als das zweite einnimmt. Tatsächlich war dies die Meinung Max Schelers [11]. Es ist sehr erstaunlich, daß Scheler, dem wir so viele Einsichten in die Welt der Werte und in andere grundlegende ethische Probleme verdanken, diesen fundamentalen Unterschied nicht erfaßt hat.
Nun ist jeder Versuch, die wesenhafte Verschiedenheit der beiden Bedeutsamkeitstypen auf eine bloßen Gradunterschied zu reduzieren, vergeblich. Gradunterschiede setzen immer einen gemeinsamen Nenner voraus. Aber für diese Bedeutsamkeitsarten gibt es keinen gemeinsamen Nenner. Wir stehen hier vor zwei völlig verschiedenen Gesichtspunkten: Bedeutsamkeit meint in jedem Fall etwas anderes.
Selbstverständlich gibt es sowohl im Bereich des Angenehmen wie im Reich der Werte eine Stufenfolge. Wenn wir die angenehme Qualität eines warmen Bades mit der Anziehungskraft und der Befriedigung vergleichen, die einer einflußreichen Stellung eigen sind, geben wir natürlich zu, daß diese beiden Arten subjektiver Bedeutsamkeit nach Gewicht und Tiefe sehr verschieden sind. Oder vergleichen wir die Befriedigung eines sehr durstigen Menschen, der bei einer Hitzewelle Wasser trinkt, mit der Befriedigung dessen, der unter normalen Umständen Wasser trinkt, so zeigt sich gewiß ein Unterschied der Intensität. Wir sprechen von größerer oder geringerer Lust, von oberflächlicherer, vorübergehender und von gehaltvollerer und tieferer Befriedigung.
Aber selbst die Art der Gradunterschiede im Bereich des subjektiv Befriedigenden bezeugt die wesenhafte Verschiedenheit zwischen ihm und dem der Werte. Wir können von größerem oder geringerem Vergnügen sprechen, aber das nur subjektiv Befriedigende gestattet uns nicht, hier den Begriff von niedriger und höher wie in der Wertsphäre anzuwenden. Die charakteristische Struktur einer Hierarchie, die wir im Reich der Werte finden, hat hier keinen Raum.
Sobald wir die Attribute "niedriger" und "höher" auf zwei erfreuliche Erlebnisse anwenden, beurteilen wir sie schon vom Gesichtspunkt des Wertes und nicht mehr von dem des bloß subjektiv Befriedigenden. Wir können also sagen: Die Freude, die wir beim Hören einer Haydn-Symphonie empfinden, ist etwas Höheres als das Vergnügen, das uns eine gute Speise machen kann. Höher bedeutet hier edler und ist offenbar ein Urteil über zwei Erlebnisse vom Wertgesichtspunkt aus.
Es kommt darauf an zu verstehen: Die Eigenart der Wert-Bedeutsamkeit ist von der des subjektiv Befriedigenden so grundlegend verschieden, daß die Möglichkeit eines Vergleiches nach Graden von vornherein ausgeschlossen ist. Ein Vergleich würde ja einen gemeinsamen Nenner voraussetzen. Würde uns jemand fragen, ob wir ein bestimmtes Rot intensiver finden als das Kopfweh, das wir haben, wäre unsere Antwort: Vom Standpunkt der Intensität können wir nur eine Farbe mit einer anderen oder einen Schmerz mit einem anderen vergleichen, aber nicht eine Farbe mit einem Schmerz. Der für jeden Gradunterschied notwendige gemeinsame Nenner fehlt zwischen Farbe und Schmerz.Die Verschiedenheit der beiden Bedeutsamkeitskategorien ist noch viel größer als die zwischen einer Farbe und einem Schmerz. Der Gehalt der Bedeutsamkeit ist in beiden Fällen ein so vollkommen anderer, daß wir vergeblich nach einem gemeinsamen Nenner suchen, der uns einen Vergleich nach dem Gradgesichtspunkt ermöglichte.
Im Durchschreiten der verschiedenen Stufen des bloß subjektiv Befriedigenden, angefangen vom schwächsten, flüchtigsten und oberflächlichsten bis zum intensivsten und gewichtigsten, nähern wir uns dem Reich der Werte in keiner Weise. Die Anziehungskraft der Krone auf Macbeth, die tiefe Befriedigung seines Hochmutes und Ehrgeizes, die das Königtum ihm verschafft, ist dem in sich Bedeutsamen keinesfalls näher als die angenehme Qualität eines warmen Bades. Diese ist dem bescheidenen Wert einer geistreichen Bemerkung ebenso fern wie dem hohen Wert eines großmütigen Verzeihensaktes. Die Sphäre des nur subjektiv Befriedigenden hat also ihre Skala, das Reich der Werte aber hat seine Hierarchie; in beiden finden wir Gradunterschiede, wenn auch in einem vollkommen verschiedenen Sinn. Doch gerade die Betrachtung der jeweiligen Gradunterschiede zeigt klar, daß die Verschiedenheit der beiden Bedeutsamkeitskategorien keinesfalls nur auf graduelle Differenzen zurückgeführt werden kann.[12]
Die Tatsache, daß der Unterschied zwischen Wert und subjektiv Befriedigendem ein wesenhafter ist, dem zwei verschiedene Sinngehalte von Bedeutsamkeit entsprechen, tritt vor allem im Fall eines Konfliktes zwischen der Verlockung eines Angenehmen und der Forderung eines Wertes zutage. In einer solchen Situation wird uns deutlich bewußt, daß zwei disparate Gesichtspunkte an unsere Entscheidung appellieren. Jemand ist in großer sittlicher Gefahr, und wir können ihm helfen. Der auf dem Spiel stehende objektive Wert steht klar vor unserem geistigen Auge, wir vernehmen die Forderung, diesem Menschen beizustehen. Aber da ist eine amüsante gesellschaftliche Veranstaltung, auf die wir verzichten müßten, wenn wir ihm zur Hilfe eilen. In diesem Konflikt wird uns voll bewußt: diese beiden Bedeutsamkeitsgesichtspunkte sind gar nicht vergleichbar; dieser Konflikt ist gänzlich verschieden von den Fällen, in denen wir zwischen zwei Werten zu wählen haben — z. B. ob wir eine wichtige Arbeit beenden oder einem kranken Freund beistehen sollen. Im letzten Fall vergleichen wir die beiden Werte und entscheiden uns für den höheren. Hier besteht ein Konflikt zwischen zwei Möglichkeiten, die einander nur ausschließen, weil sie nicht gleichzeitig verwirklicht werden können. Beide zeigen sich unter demselben Gesichtspunkt, beide appellieren an dasselbe Zentrum in uns. Dagegen handelt es sich im ersten Fall um einen Kampf zwischen zwei gänzlich verschiedenen Gesichtspunkten; hier prallen zwei Welten aufeinander, deren jede sich an eine ganz andere Schicht in uns wendet. Beschließen wir, dem schwer gefährdeten Menschen zu helfen und uns damit dem Wert und seiner Forderung zu konformieren, dann wenden wir uns von der Verlockung der Festlichkeit ab. Wir überwinden unsere auf das subjektiv Befriedigende gerichtete Neigung. Wir sind uns bewußt, daß das bloß subjektiv Bedeutsame als solches, gemessen an der Forderung eines Wertes, nicht ins Gewicht fällt. Entschließen wir uns statt dessen, zu der vielversprechenden gesellschaftlichen Veranstaltung zu gehen, so scheiden wir den Wertgesichtspunkt aus. In diesem Widerstreit ist der jeweilige Sieg der Sieg eines generellen Bedeutsamkeitstypus und nicht allein der einer einzelnen konkreten Möglichkeit.
Wir sehen also: Der Unterschied zwischen dem bloß subjektiv Befriedigenden und dem Wert ist ein wesenhafter und kein gradueller. Vielleicht beschäftigt uns ein und dieselbe Sache von beiden Gesichtspunkten aus. Vielleicht ist ein und derselbe Gegenstand zugleich angenehm und in sich bedeutsam. Aber dieses Zusammentreffen schwächt keineswegs die prinzipielle Verschiedenheit beider ab.
Der Grund, warum Scheler den Wesensunterschied zwischen Wert und subjektiv Befriedigendem übersah, liegt darin, daß er die Frage nach den verschiedenen Gesichtspunkten der Bedeutsamkeit in unserer Motivation nicht klar von der Frage nach der Bedeutsamkeit des Objektes in sich, unabhängig von jeglicher Motivation, trennte. Die Tatsache, daß kein Seiendes bar jeglichen Wertes ist, mag uns von der Einsicht in die wesenhafte Verschiedenheit beider Gesichtspunkte ablenken. Doch die Kategorie des subjektiv Befriedigenden ist nicht auf gewisse Gegenstände gerichtet, die in sich selbst keine andere Bedeutsamkeit besäßen, sondern auf den Gesichtspunkt, unter dem wir uns diesen Dingen zuwenden. Daher ist der Einwand, die amüsante Festlichkeit habe auch einen Wert — nur einen niedrigeren — nicht treffend. In einem Fall, in dem ich zu wählen habe zwischen dem Besuch einer amüsanten Festlichkeit und der Hilfeleistung für einen Menschen in großer sittlicher Gefahr, besteht der Konflikt nicht zwischen dem Wert der Hilfeleistung für diesen Menschen und dem Wert des Besuches dieser Geselligkeit, sondern vielmehr zwischen zwei heterogenen Gesichtspunkten. Die Wahl, das amüsante Fest zu besuchen, ist eindeutig unter dem Gesichtspunkt des nur subjektiv Befriedigenden getroffen. Wenn ich mich dagegen entscheide, einem Kranken beizustehen, ist zweifellos der Wert mein bestimmender Gesichtspunkt.
Ein gewöhnlicher Dieb hält die Tatsache, daß er zu Geld kommt, nicht für einen höheren Wert als das Eigentum seines Mitmenschen. Die Frage, ob etwas in sich bedeutsam ist oder nicht, interessiert ihn gar nicht. Er geht ausschließlich vom Standpunkt des subjektiv Befriedigenden an die Dinge heran.
Das VorziehenJeder Versuch, ein sittlich falsches Verhalten als das Vorziehen eines niedrigeren Gutes vor einem höheren zu erklären, ist zum Scheitern verurteilt. Erstens kann man unmöglich behaupten, jede Handlung entspringe einem Akt des Vorziehens. Es gibt viele Fälle, in denen ein Ziel unter Mißachtung eines Wertes, ohne jede Rücksicht auf die Frage, was den Vorzug haben soll, gewählt wird. Jemand rächt sich z. B., indem er seinen Feind tötet; in dieser Tat mißachtet er den hohen Wert des menschlichen Lebens. Offenbar wäre es eine ganz und gar künstliche und falsche Auslegung, zu sagen, dieser Mann ziehe die Befriedigung seiner Rache dem Leben seines Feindes vor. Für ihn handelt es sich gar nicht um ein bewußtes Vergleichen, ein bewußtes Abwägen zweier Güter. Vielmehr faßt er den einfachen Entschluß, seine Rachgier zu stillen, ohne sich irgendwie um den Wert eines Menschenlebens zu kümmern. Sollte jemand behaupten, mit der Entscheidung, seinen Feind zu töten, habe dieser Mann implicite die Befriedigung seiner Rachsucht dem Leben seines Opfers vorgezogen, so müßten wir antworten, daß der Terminus „Vorziehen“ dann doppeldeutig gebraucht würde. Im ersten Fall wird er als bewußter Akt verstanden, in dem wir zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten wählen, sie in ihrer Bedeutsamkeit abwägen und einer von ihnen auf Grund ihrer höheren Bedeutsamkeit den Vorzug geben. Von diesem echten Sinn des Vorziehens findet sich in unserem Beispiel nichts. In dem anderen Fall meint man mit „Vorziehen“, daß jede Entscheidung faktisch viele andere Möglichkeiten ausschließt, ob wir sie kennen oder nicht, ob wir uns ihrer bewußt sind oder nicht. „Vorziehen“ wird hier in dem nur analogen Sinn gebraucht, in dem mein Verstand zwischen unbegrenzten Möglichkeiten wählt und ich durch die Versicherung, etwas sei ein Tisch, die Möglichkeit ausschalte, es sei ein Esel, ein Haus, ein Mensch usw. Dieser Gebrauch der Ausdrücke „wählen“ oder „vorziehen“ ist offenbar unkorrekt. Beschränken wir uns auf den authentischen Sinn von Vorziehen, so müssen wir zugeben, daß man den Ursprung einer Handlung, Entscheidung oder Antwort unmöglich in einem Akt des Vorziehens, wie wir ihn eben darlegten, suchen kann. Bei einem gewöhnlichen Diebstahl wird der Wert des Geldbesitzes nicht den geheiligten Eigentumsrechten vorgezogen, vielmehr beruht er auf einer Gleichgültigkeit gegenüber dem Wertgesichtspunkt als solchem; diese bedingt eine Indifferenz für den Wert des Eigentums, gekoppelt mit hemmungslosem Trachten nach dem subjektiv Befriedigenden. Im Konfliktfall, in dem ein Mensch zwischen der Versuchung zum Diebstahl und der Stimme des Gewissens schwankt, die ihn mahnt, das Eigentum seiner Mitmenschen zu achten, und ihn vor dem Unrecht des Stehlens warnt, kann es kein Abwägen beider Möglichkeiten vom selben Gesichtspunkt aus, kein Vergleichen auf Grund eines gemeinsamen Nenners geben, sondern nur einen ausgesprochenen Zusammenprall zweier verschiedener Gesichtspunkte: der beiden Richtungen des Lebens, von denen der hl. Augustinus spricht (De civitate Dei, XIV, 4).
Wäre es überdies wahr, daß im Vorziehen des niedrigeren Gutes vor einem höheren die Wahl auf einem gemeinsamen Nenner beruhte, nämlich auf dem Gesichtspunkt ihres Wertes, so könnte man unmöglich erklären, warum man sich für den niederen statt für den höheren entscheiden kann. Solange es sich wirklich um denselben Gesichtspunkt handelt, muß ein Grund da sein, warum das nach diesem Maßstab Mindere dennoch vorgezogen wird.
Sooft sich jemand von ein und demselben Gesichtspunkt zwei Möglichkeiten zuwendet (z. B. wenn er für die gleiche Arbeitsart und -menge verschiedene Bezahlungen angeboten bekommt und die geringere davon wählt), suchen wir herauszufinden, welcher andere Beweggrund diese Wahl erklären könnte. Es scheint uns selbstverständlich, daß niemand sich aus demselben Gesichtspunkt heraus und nach dem gleichen Maßstab für das Geringere entschiede, bestände nicht die Möglichkeit, dieses Geringere von einem anderen Blickpunkt aus zu betrachten, oder — wie wir auch sagen können — wäre nicht ein anderer Gesichtspunkt für das Umschlagen der Waage maßgebend.
Vorziehen auf Grund von Verwechslungen
Man mag einwenden, das Vorziehen des niederen Gutes beruhe auf einem Irrtum. Aus diesem Grund betrachtete Sokrates den Irrtum als Wurzel jedes moralischen Übels. Dagegen ist zu sagen, daß Irrtum in diesem Zusammenhang zwei verschiedene Bedeutungen haben kann. Der erste Irrtumstyp besteht im Verwechseln eines Objektes mit einem anderen oder im Nichterkennen seines wirklichen Wesens. Wir vertrauen einem Mann ein Kind an in der Annahme, er sei ein Heiliger, während er in Wirklichkeit ein Tartuffe ist (die Figur des Heuchlers in Molières gleichnamigem Schauspiel). Wir bieten einem Freund giftige Pilze an, weil wir nicht wissen, daß sie giftig sind. Dieser Irrtumstyp ist jene Art Unwissenheit, die Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik mit Recht als eine Ursache unfreiwilliger Handlungen anführt (3. Buch, 1110a, u. f.). Doch diese Form des Irrens läßt uns etwas tun, was in Wirklichkeit von dem, was wir zu tun glauben und zu tun beabsichtigen, vollständig verschieden ist. Daher hebt sie die Verantwortung für unsere Handlung auf oder ändert sie entscheidend, falls der Irrtum eine Folge unserer Gedankenlosigkeit ist.
Ein solcher Irrtum kann sogar die Wahl eines Übels statt eines Gutes in den Fällen begründen, in denen wir das Übel für ein höheres Gut halten; etwa wenn wir ein Kind einem Erzieher anvertrauen, den wir als Heiligen betrachten, obwohl er in Wirklichkeit ein Tartuffe ist, anstatt es einem zuverlässigen ehrlichen Mann zu geben, der allerdings kein Heiliger ist. Diese Art des Irrens ist aber offensichtlich nicht die Wurzel des sittlich Bösen; denn ein Mensch, der etwas objektiv Schlechtes infolge eines solchen Irrtums tut, handelt sittlich recht, soweit es seine Intention betrifft. Mit anderen Worten: Gemäß der Vorstellung von der Wirklichkeit, die er hat, wählte er in der richtigen Weise.
Vorziehen aus Wertblindheit
Der zweite Irrtumstypus ist ganz anderer Natur. Er ist das Ergebnis dessen, was wir „Wertblindheit“ nennen können; sie liegt z. B. vor, wenn jemand erklärt: “Ich verstehe nicht, warum Unreinheit moralisch schlecht ist” oder wenn einer für die Würde des menschlichen Lebens blind ist wie Raskolnikow in Dostojewskijs Schuld und Sühne. Diese Wertblindheit [13] spielt tatsachlich als Ursache des sittlich Schlechten eine große Rolle und ist häufig der wirkliche Grund, warum ein niedrigeres Gut einem höheren vorgezogen wird. Ein typisches Beispiel dieser Wertblindheit ist Patricius, der Vater des hl. Augustinus, der seinen Sohn in eine intellektuell hervorragende, aber sittlich gefährdende Schule sandte, weil er eine glänzende geistige Ausbildung fur ein höheres Gut hielt als sittliche Reinheit. Aber wie können wir für solche Wertblindheit verantwortlich sein? Wäre sie ein Unvermögen wie Farbenblindheit, die Folge einer bloßen Naturanlage, niemand wäre für sie und sein sittlich verkehrtes Handeln verantwortlich. Aber es handelt sich hier nicht um jene Art der Unwissenheit, die eine Tat zu einer unfreiwilligen Tat macht [14].
Wertblindheit ist keineswegs die Folge einer bloßen Temperamentsanlage, sondern eine Auswirkung von Hochmut und Begehrlichkeit. Denn hier beherrscht ein anderer als der Wertgesichtspunkt das Verhalten zur Wirklichkeit, nämlich der: Was befriedigt Hochmut und Begehrlichkeit? Dieser macht uns für bestimmte Werte blind.
Die Dualität der beiden Bedeutsamkeitsgesichtspunkte ist also tatsächlich notwendige Voraussetzung, um zu erklären, wie ein irriges Vorziehen gerade eines niederen Gutes vor einem höheren möglich ist. Das Problem der Wertblindheit wird uns später noch eingehender beschäftigen. Hier genügt seine bloße Erwähnung, um die Unhaltbarkeit jeder Theorie zu beweisen, die nur einen Bedeutsamkeitsnenner oder -gesichtspunkt anerkennt, also das subjektiv Befriedigende einfach als niedrigeren Wert interpretiert, oder die Verschiedenheit von Wert und nur subjektiv Befriedigendem zu einem bloßen Gradunterschjed macht.
Wenn wir auch sagten, Scheler habe versucht, die Divergenz beider Kategorien auf einen Rangunterschied zu beschränken, müssen wir doch hinzufügen, daß er wenigstens nie versucht hat, das in sich Bedeutsame zu einem verfeinerten Typ des subjektiv Befriedigenden herabzudrücken, obwohl er das Angenehme als einen niedrigeren Werttyp deuten wollte. [15]
Schelers und Aristipps entgegengesetzte und ungleichartige Irrtümer
Scheler versuchte, jede Bedeutsamkeit auf eine Bedeutsamkeit in sich, d. h. einen Wert zurückzuführen. Er übersah das nur subjektiv Befriedigende als selbständige Kategorie mit eigener ratio und erblickte den Ursprung jeglicher Motivation in einem Wert des Gegenstandes. In dieser Hinsicht vertritt er den genau entgegengesetzten Standpunkt wie Aristipp, der jede Art von Bedeutsamkeit außer der subjektiv befriedigenden leugnete und das in sich Bedeutsame für eine bloße Illusion erklärte.
Dennoch kann man Schelers und Aristipps Irrtum nicht auf dieselbe Stufe stellen, obwohl beide versuchten, auf eine Kategorie zu reduzieren, was in Wirklichkeit zwei grundverschiedene Formen von Bedeutsamkeit sind. Ein Philosoph, der außer dem nur subjektiv Befriedigenden keine andere Bedeutsamkeitskategorie anerkennt, hat ein äußerst entstelltes Weltbild; er beraubt den Kosmos einer wesentlichen Substanz. Die entgegengesetzte Position Schelers, in der nur der Wert gesehen wird, entzieht dem Kosmos durchaus keine Substanz. Scheler verblieb trotz seines Irrtums in tiefer Konformität mit dem Bereich des Seienden, auf den es letztlich ankommt.
Der Wert ist das Wahre, das Gültige, das objektiv Bedeutsame selbst. Er hat einen ganz anderen Platz in der Ordnung der fundamentalen Begriffe als das subjektiv Befriedigende. Wie wir noch im einzelnen sehen werden, gehört er zu jenen letzten Gegebenheiten und Begriffen wie: Sein, Wahrheit, Erkenntnis, die man weder definieren noch leugnen kann, ohne sie stillschweigend wieder einzuführen. Aus diesem Grund ist der Versuch Aristipps, jeden objektiven Maßstab zu beseitigen und nur eine subjektive Bedeutsamkeit anzuerkennen, in Wirklichkeit immer erfolglos. Nachdem er mit seltener Konsequenz alle anderen Maßstäbe außer den Graden der Lust ausgemerzt hat, warnt er davor, unseren Instinkten tierisch zu folgen, und rät uns, ein Ding zu prüfen, bevor wir es wählen, um zu sehen, ob es uns das intensivste und andauerndste Vergnügen sichert. Hier stellt er dem vernünftigen Trachten nach Lust stillschweigend ein unvernünftiges Sichausliefern an jede Verlockung oder Versuchung entgegen und behauptet, dies vernünftige Streben sei die weisere Haltung, die wir haben sollten.
Warum sollen wir aber weise sein? Wenn das bloß subjektiv Befriedigende die Norm ist, warum sollte man dann einem Menschen widersprechen, der behauptet, er wolle lieber jedem Instinkt nachgeben, ohne sich darum zu kümmern, ob ihm etwas anderes mehr Vergnügen machen könnte? Offensichtlich setzt Aristippus außer der Lust stillschweigend noch eine andere, eine objektive Norm voraus: den Wert der Weisheit im Sinne eines vernunftgemäßen systematischen Strebens nach Lust, im Gegensatz zu dem tierischen und unvernünftigen triebhaften Jagen nach ihr. Diese Norm ist unabhängig von der Frage, ob sie mehr oder weniger subjektiv befriedigend sei. Also ist der Begriff des Wertes in einer ganz und gar allgemeinen, formalen Weise vorausgesetzt. Natürlich ist keine Rede von sittlichen Werten. Aber indem er das systematische, vernünftige Streben nach Lust als Ideal, als etwas, nach dem wir trachten sollten, empfiehlt, behauptet er implicite, es sei objektiv vorzuziehen, es sollte so und nicht anders sein; damit ist der Begriff des Wertes oder des in sich Bedeutsamen stillschweigend vorausgesetzt.
Es ist von höchstem Interesse für die Ethik, den Wesensunterschied zwischen den beiden Bedeutsamkeitskategorien zu erfassen. Wenn auch der Wert der Inbegriff des letztlich objektiv Bedeutsamen ist, so muß auch die andere Kategorie, das subjektiv Bedeutsame, deutlich gesehen werden. Denn selbst das wahre Wesen des Wertes kann ohne ein klares Erkennen dieser anderen Kategorie nicht voll verstanden werden.
Das subjektiv Befriedigende in unserer Motivation
Ferner gilt es zu sehen, daß die Kategorie des subjektiv Befriedigenden tatsächlich eine entscheidende Rolle in unserer Motivation spielt. Man kann unmöglich behaupten, immer wenn das Verhalten einer Person offensichtlich von einem subjektiv Befriedigenden motiviert wird, gehe die Motivation in Wirklichkeit von einem Wert aus. Unbestreitbar wird die Haltung der Person in vielen konkreten Situationen nicht vom Wertgesichtspunkt motiviert. Es gibt sogar gewisse Typen von Personen, die nur jene Art von Bedeutsamkeit kennen, die wir die bloß subjektiv befriedigende nannten. Der gänzlich von Hochmut und Begehrlichkeit beherrschte Mensch kennt keine andere Motivationsquelle, keinen Gesichtspunkt, nach dem etwas für ihn den Charakter des Bedeutsamen annehmen könnte, als allein das bloß subjektiv Befriedigende. Kain wie Jago, Richard III. wie Don Giovanni, jeder von ihnen betrachtet alles ausschließlich unter dem Gesichtspunkt, ob es seinen Hochmut oder seine Begehrlichkeit befriedigen könne oder nicht. Die Frage, ob etwas einen Wert habe, ob es in sich bedeutsam sei oder nicht, interessiert sie nicht im geringsten. Sogar die Überlegung, ob etwas objektiv ein echtes Gut für sie sei, ob es ihrem wahren Interesse entspreche, beschäftigt sie nicht. Ihr Verhalten orientiert sich nicht einmal an dem objektiven Maßstab eines Gutes für sie selbst, sondern ausschließlich an ihrer subjektiven Befriedigung. Von einer objektiven Norm wird ihr Wille niemals motiviert, ihr Interesse nie entfacht. Es ist mir angenehm; es befriedigt meinen Hochmut, meine Begehrlichkeit; es sättigt meine Triebe und Gelüste, seien sie legitim oder nicht: dies ist die einzige Form von Bedeutsamkeit, die solche Menschen anerkennen. Wenn wir das Fehlen jeglicher objektiven Norm bei diesen Menschen betonen und sagen, sie kümmerten sich nicht einmal darum, ob etwas mit ihrem wahren Interesse übereinstimmt oder nicht, stoßen wir auf einen dritten fundamentalen Typ des bonum; und dieser muß sowohl von dem Wert als vom bloß subjektiv Befriedigenden abgegrenzt werden. Das Herausarbeiten dieses dritten Bedeutsamkeitstypus, der schon in sich von größter Wichtigkeit ist, wird die eben erörterte Frage noch weiter beleuchten.
Beim Nachdenken über die Dankbarkeit und ihr wirkliches Objekt entdecken wir, daß die Wohltat, die uns jemand erwiesen hat, für die wir dankbar sind, weder zum Gesichtspunkt des nur subjektiv Befriedigenden noch zu dem des in sich Bedeutsamen gehört. Die Wohltat zeigt sich als ein objektives Gut für mich, als etwas, was objektiv in meinem wahren Interesse liegt, was einen wohltuenden Charakter für meine Person hat und in der Richtung auf „mein Gut“ liegt. Meine Dankbarkeit gilt auch der sittlich edlen Haltung meines Wohltäters, die sich im Spenden seiner Wohltat an mich kundtut. Meine Bewunderung oder Verehrung wird im Unterschied zur Dankbarkeit ausschließlich von etwas in sich Bedeutsamem motiviert: von dem sittlichen Wert der Tat des Spenders, von seiner Großmut und Güte. Bei der Dankbarkeit ist der sittliche Wert jedoch mehr eine notwendige Voraussetzung als ihr Formalobjekt. Ich kann die sittliche Gutheit eines Menschen, der einem anderen hilft, genauso bewundern, wie wenn seine Tat mir selbst zugute käme. Aber Dankbarkeit setzt voraus, daß die Hilfe mir oder jemandem zuteil wird, mit dem ich mich so tief solidarisch fühle, daß ich alles, was ihm geschieht, als meine eigene Angelegenheit betrachte. In diesem Fall handelt es sich um eine neue, eine dritte Kategorie von Bedeutsamkeit, die wir „objektives Gut für die Person“ nennen wollen.
Wird jemand aus Lebensgefahr gerettet oder aus Gefangenschaft befreit, so beziehen sich seine Freude, seine Dankbarkeit gegen Gott eindeutig auf diese Bedeutsamkeitsart, die wir als objektives Gut für die Person bezeichneten. Was ihn bewegt, was sein Herz mit Dankbarkeit erfüllt, ist das Geschenk seines Lebens oder seiner Freiheit; und dies hat den Charakter eines objektiven Gutes für ihn. Es unterscheidet sich deutlich von dem in sich Bedeutsamen, dem Wert einerseits und dem nur subjektiv Befriedigenden andererseits.
Das empfangene Geschenk, z. B. meine Freiheit, sehe ich nicht als etwas bloß subjektiv Befriedigendes, wie es einem Verbrecher erscheinen mag, dem es gelingt zu fliehen. Ich betrachte es im Gegenteil als etwas für mich objektiv Kostbares, seiner Natur nach Positives, was mein wahres Interesse fördert. Es hat den Charakter einer Manifestation der Güte und Liebe Gottes.
Andererseits unterscheidet es sich auch klar von dem in sich Bedeutsamen. Leben und Freiheit werden hier nicht nur in ihrem inneren Wert, sondern ebenso als große Geschenke für mich gesehen. Wenn ich Gottes unendliche Güte und Barmherzigkeit anbete, die mir diese Güter verliehen, so antworte ich ohne Zweifel auf etwas in sich Bedeutsames, auf einen unendlichen Wert. Ähnliches geschieht, wenn mich die sittliche Güte eines menschlichen Wohltäters rührt. In diesen Fällen wende ich mich nicht einer subjektbezogenen, sondern der reinen Bedeutsamkeit in sich zu. In der Bedeutung, die mein Leben, meine Freiheit, meine Gesundheit für mich haben, liegt dagegen eine wesenhafte Relation auf meine eigene Person: sie sind objektiv bedeutsam für mich.
Das objektive Übel für die Person
Die Eigenart dieses bonum mihi (für mich Guten) als einer sowohl von dem Wert wie von dem subjektiv Befriedigenden verschiedenen Bedeutsamkeitskategorje zeigt sich auch, wenn wir ihr negatives Gegenstück betrachten: das objektive Übel für die Person, z. B. das Formalobjekt des menschlichen Verzeihens.
Jemand tat mir Unrecht, ein Freund betrog mich. Im Verzeihen ist mir klar bewußt, daß dieses sich nur auf das Unrecht bezieht, das er mir angetan hat. Es gilt dem objektiven Übel, das er mir zufügte, nicht dem sittlichen Unwert, der in seiner Haltung gleichsam verkörpert ist. Der sittliche Unwert, durch den er Gott beleidigte, ist niemals Gegenstand menschlichen Verzeihens. Ich kann nie den Unwert aufheben, sondern nur das mir zugefügte Unrecht. Ich sage vielleicht: „Ich verzeihe dir; möge Gott dir vergeben.“ Das Vergeben Gottes gilt der Schuld, die in dem sittlichen Unwert wurzelt. Mein Verzeihen richtet sich dagegen auf die Haltung des Beleidigers, sofern sie ein objektives Übel für mich ist. Dies zeigt sich auch darin, daß ich nur ein Unrecht verzeihen kann, das direkt oder indirekt mir angetan wurde; indirekt, wenn jemand einer Person Unrecht tut, die ich als in besonderer Weise mir verbunden betrachte. Ich kann nicht das Unrecht verzeihen, das einem anderen zugefügt wurde. Ich kann nicht Judas seinen Verrat an dem Herrn noch Kain die Ermordung Abels verzeihen.
Wir empören uns vielleicht ebenso über das Unrecht, das unserem Nächsten angetan wird, wie über das uns selbst geschehene; denn die Empörung antwortet auf den sittlichen Unwert der Ungerechtigkeit. Aber unser Verzeihen ist nur möglich im Hinblick auf das uns zugefügte Unrecht, weil es sich auf die Ungerechtigkeit bezieht, sofern sie ein objektives Übel für uns ist.
Verzeihen und Vergeben
Gegenstand menschlichen Verzeihens ist die uns zugefügte Unbill, das objektive Übel für uns; der sittliche Unwert der Ungerechtigkeit kann dagegen nur von Gott oder seinen Stellvertretern vergeben werden, denen Christus die Binde- und Lösegewalt verlieh. So betete der hl. Stephanus, den Märtyrertod sterbend, daß Gott seinen Mördern vergebe.
Man mag einwenden, wir könnten einem anderen nur verzeihen, wenn er schuld daran ist, daß er uns Unrecht tat. Fügt er uns unfreiwillig ein objektives Übel zu, so haben wir nichts zu verzeihen. Er muß für das uns geschehene objektive Übel verantwortlich und seine Haltung muß also auch sittlich schlecht sein. Darum sei es falsch zu sagen, wir bezögen uns im Verzeihen nicht auf den sittlichen Unwert; denn dieser ist gerade vorausgesetzt, wenn das uns geschehene objektive Übel Gegenstand unseres Verzeihens werden soll.
Gewiß setzt das Verzeihen Verantwortlichkeit der Person, die uns ein objektives Übel antat, voraus. Immer ist eine freiwillige und bewußte Haltung unseres Nächsten Gegenstand unseres Verzeihens; das ist so, unabhängig davon, ob das uns zugefügte Böse ausschließlich in einer unfreundlichen, feindlichen oder ungerechten Haltung oder in einer Handlung besteht, die ein greifbareres objektives Übel für uns im Gefolge hat.
Aber dies ändert nichts an der Tatsache, daß unser Verzeihen der Haltung unseres Beleidigers nur insofern gilt, als sie die negative Bedeutsamkeit eines objektiven Übels für uns hat, nicht aber, so fern sie eine negative Bedeutsamkeit als sittlicher Unwert hat, den Gott allein vergeben kann. Offensichtlich bezieht sich die Tilgung der Feindseligkeit oder Disharmonie, die unser Verzeihen bewirkt, nur auf die negative Bedeutsamkeit eines objektiven Übels für uns und nicht auf den sittlichen Unwert. Die in ihm enthaltene Disharmonie und Beleidigung Gottes ist dadurch, daß wir dem Übeltäter verzeihen, in keiner Weise hinweggenommen; seine Reue und die darauf folgende Vergebung Gottes dagegen bewirken zugleich eine Auflösung dieser Disharmonie.
Die Tatsache, daß ein und dieselbe Haltung objektiv beide Bedeutsamkeiten besitzt — im Falle eines feindseligen Aktes einen Unwert und den Charakter des objektiven Übels für die Person —‚ hebt weder die Verschiedenheit zwischen beiden Bedeutsamkeitsdimensionen auf, noch ändert sie etwas daran, daß mein Akt des Verzeihens nur einer Art negativer Bedeutsamkeit gilt: dem objektiven Übel für mich. Die Verwirrung entsteht durch die notwendige Wechselbeziehung zwischen beiden Bedeutsamkeitsbereichen; denn diese Beziehung gründet in der Tatsache, daß Gegenstand unseres Verzeihens eine menschliche Tat ist. An diesem feindlichen, unfreundlichen, ungerechten Akt, der sich gegen das objektive Gut für einen Mitmenschen richtet, es mißachtet oder sogar zu verletzten oder zu zerstören sucht, haftet immer ein sittlicher Unwert. Im Verstehen seiner Ungerechtigkeit erfassen wir auch notwendig seinen sittlichen Unwert. Der Gegenstand unseres Verzeihens besitzt also nicht nur wesenhaft einen moralischen Unwert, wir sind uns seiner auch unbedingt bewußt. Dennoch betrifft unser Verzeihen die ungerechte Tat nur insofern, als sie uns zugefügt wurde und die Bedeutsamkeit eines objektiven Übels für uns hat, aber nicht, soweit sie einen sittlichen Unwert besitzt. Die vorausgegangenen Untersuchungen erhellen den wesenhaften Unterschied dieser beiden Bedeutsamkeitstypen.
Verknüpfung von Wert und objektivem Gut
Die Analyse, die wir vom Objekt des Verzeihens gegeben haben, hat die Verschiedenheit des objektiven Gutes für die Person von der inneren Bedeutsamkeit des Wertes oder Unwertes klar zutage treten lassen. Sie ändert sich weder durch die Tatsache, daß beide an ein und demselben Akt auftreten, noch durch die tiefe und notwendige Verknüpfung, die zwischen ihnen besteht. [16]
Diese Koinzidenz ist jedoch nicht nur derart, daß ein und dasselbe Objekt zufällig Träger beider Bedeutsamkeitskategorien wird. Sie bestehen nicht unverbunden und unabhängig voneinander. Aber damit ist der Unterschied zwischen ihnen in keiner Weise ausgelöscht, er wird nicht einmal in seinem wesentlichen Sinn beeinträchtigt. [17]
Die traditionelle Auffassung des bonum kreiste meistens um die Bedeutsamkeitskategorie, die wir das „objektive Gut für die Person“ nannten, wenigstens soweit es sich um die Motivation handelt. Wenn Sokrates lehrte, daß es besser ist, Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun (Diese These legt Platon dem Sokrates im Dialog Gorgias (469c) und in den beiden ersten Büchern des Staates in den Mund), so meinte er offenbar, daß Unrecht leiden besser für den Menschen sei. Er meinte nicht nur: das eine ist moralisch besser als das andere, denn das wäre eine Binsenwahrheit. Selbstverständlich ist Unrecht begehen sittlich böse, während Unrecht leiden in keiner Weise sittlich schlecht ist. Vorn Gesichtspunkt des sittlichen Wertes ist das eine nicht etwa besser, vielmehr ist das eine schlecht, das andere keinesfalls schlecht. Der Komparativ, der einen gemeinsamen Nenner voraussetzt, um eines als ein größeres Übel ansehen zu können, schließt aber gerade den sittlichen Wert als möglichen gemeinsamen Nenner aus; denn Unrecht tun ist ein augenscheinliches sittliches Übel, während Unrecht leiden an sich außerhalb der sittlichen Sphäre liegt. Gewiß kann es gleichfalls Gegenstand der Ethik werden, wenn wir fragen, in welcher Weise wir das uns zugefügte Unrecht dulden. Aber dies ist nicht das Sokrates‘ These zugrunde liegende Problem.
Der Sinn seiner Lehre beruht in der Einsicht: Es ist für den Menschen ein größeres Übel, sittlich schuldig zu werden als zu leiden. Der Maßstab für diesen komparativischen Grad „besser“ ist nicht der sittliche Wert, sondern die objektive Bedeutsamkeit eines Gegenstandes für den Menschen; wir nannten sie „das objektive Gut für die Person“. Sie besagt hier: Vom Standpunkt des letzten, wahren Interesses des Menschen ist es besser, Unrecht zu leiden als es zu begehen. Da wir erkannten, daß Sokrates‘ Feststellung nicht als ein Hinweis auf den Wert gedeutet werden kann — weder auf einen sittlichen Wert noch auf irgendeinen anderen Typus von Bedeutsamkeit in sich — ist jetzt leicht zu sehen, daß sie sich auch nicht auf das nur subjektiv Befriedigende bezieht.
Wesensunterschied zwischen objektivem Gut und bloß subjektiv Befriedigendem
Aristippus würde Sokrates‘ Erklärung sicher nicht anerkennen. Er läßt als einzigen Maßstab das subjektiv Befriedigende oder die Lust gelten; das Erleiden einer Ungerechtigkeit würde er als Übel betrachten, während Unrecht tun kein Übel wäre, solange wir der Strafe entgehen könnten. Nach seiner Ansicht ist Unrecht dulden kein Übel der Ungerechtigkeit wegen, sondern ausschließlich, weil es mit Leiden verbunden ist. Zu Recht leiden, Schmerzen ertragen oder Lust entbehren wäre ein ebenso großes Übel. Für ihn ist es gleich, ob ein Leiden durch Ungerechtigkeit entsteht oder wohlverdiente Strafe ist. Das objektive Element im sokratischen Begriff des bonum fehlt in der hedonistischen Auffassung vollkommen. Für Aristippus ist es gleichbedeutend mit dem subjektiv Angenehmen oder Befriedigenden. Nur ein einziges Mal neigt er sich einer objektiven Ordnung zu: bei der Frage, ob man eine Lust in vernünftiger oder in unvernünftiger Weise sucht. Der Tor ergibt sich jeder Lust auf tierische, instinkthafte Art; der Weise dagegen wählt das subjektiv befriedigende Objekt gemäß den eben genannten Prinzipien der Intensität, Dauer usw.
Nach sokratischer Auffassung kann der Begriff des bonum also nicht mit dem des bloß subjektiv Befriedigenden inhaltsgleich sein. Seine These wäre absurd, wenn Aristippus mit seiner Behauptung, es gäbe keine andere Art von Bedeutung als das Angenehme oder subjektiv Befriedigende, recht hätte. Der sokratische Begriff des Guten enthält, ungeachtet seiner Bezogenheit auf die Person, ein Element der Orientierung am Objektiven, das die Bestimmung des wirklichen Ranges eines Übels gestattet, unabhängig von der Frage, ob es Mißbehagen verursacht oder nicht. Ohne diesen objektiven, über das nur subjektiv Befriedigende hinausgehenden Maßstab würde Sokrates‘ These zusammenbrechen.
Der Unterschied zwischen Aristipps Begriff des bonum und dem des Sokrates darf jedoch nicht mit der Verschiedenheit zwischen einem echten und einem nur scheinbaren Gut verwechselt werden. Bei jedem Seienden können wir zwischen seiner objektiven Realität und seiner bloß subjektiven Erscheinung unterscheiden. „Objektiv“ heißt, daß etwas in Wirklichkeit das ist, was es zu sein scheint; wir stellen diese objektive Realität einer bloßen Illusion entgegen, die nicht der Wirklichkeit entspricht.
Diese Unterscheidung gilt sowohl für das bloß subjektiv Befriedigende als für die objektiven Güter für die Person. Jemand meint vielleicht, eine Flasche Essig sei mit Wein gefüllt und betrachtet sie als etwas subjektiv Befriedigendes. Nur wenn er davon trinkt, wird er entdecken, daß dem nicht so ist. Es gibt Dinge, die uns wirklich Lust bereiten können, und andere, die es nur scheinbar vermögen, denn objektiv spenden sie keine Freude. Dieser Anschein kann durch einen Irrtum über das betreffende Seiende oder durch eine Illusion über die wirkliche Natur eines Seienden bedingt sein. Ein Kind hält Rauchen für etwas Angenehmes, doch beim Versuchen wird es krank und erlebt Unlust. Hier bezieht sich die Unterscheidung zwischen objektiv und subjektiv nicht auf die Art der Bedeutsamkeit, sondern nur auf die Frage, ob ein Gegenstand tatsächlich einen bestimmten Bedeutsamkeitstyp besitzt oder ob es nur so scheint. Wir können zwischen Dingen unterscheiden, die wirklich ein objektives Gut für uns sind, und solchen, die es nur scheinbar sind. Wenn es uns nicht gelingt, zu erreichen, was wir erstreben, meinen wir oft, dieser Fehlschlag sei ein großes objektives Übel für uns. Später werden wir vielleicht sehen, daß er in Wirklichkeit ein großes Gut für uns war. Ein Mensch wird von einem Freund getrennt, der großen Einfluß auf ihn hatte; er glaubt, dieser Verlust sei ein großes Unglück, ein objektives Übel für ihn. Später wird ihm klar, daß der Freund einen schlechten Einfluß auf ihn hatte und die Trennung von ihm tatsächlich ein objektives Gut für ihn war.
Weil er das Wesen der Bedeutsamkeit selbst betrifft, fällt also der Unterschied zwischen bloß subjektiv Befriedigendem und objektivem Gut für die Person nicht mit der Verschiedenheit zwischen einem Objekt, das die eine oder andere Art der Bedeutsamkeit wirklich besitzt, und einem, das sie nur scheinbar hat, zusammen. Obwohl die von uns „objektives Gut für die Person“ genannte Bedeutsamkeit historisch im Begriff des bonum überwiegt, ist sie in Wirklichkeit hinsichtlich des datum des Wertes sekundär. Mit dem Wort „sekundär“ wollen wir nicht etwa andeuten, sie könne auf das in sich Bedeutsame zurückgeführt oder von ihm abgeleitet werden, sondern nur sagen: sie setzt schon den Wert voraus, und die Bedeutsamkeit in sich hat in jeder Hinsicht den absoluten Primat. Dies letztere zeigt sich auch darin, daß jedes objektive Gut für die Person notwendig das in sich Bedeutsame, den Wert, voraussetzt.
Um festzustellen, daß eine sittliche Verfehlung ein größeres Übel für den Menschen ist als Unrecht dulden, muß der sittliche Wert schon erfaßt sein. Wie hätte Sokrates erklären können, eine sittliche Schuld zu tragen sei für den Menschen schlimmer als leiden, hätte er nicht schon die in sich ruhende Bedeutsamkeit des sittlichen Wertes gesehen? Hätte Sokrates argumentiert: Unrecht tun bringe uns in Schwierigkeiten, es würde vielleicht den Mann, dem wir es zufügten, zu unserem Feind machen oder könnte uns mit den Staatsgesetzen in Konflikt bringen, dann hätte er nicht der Einsicht in den sittlichen Unwert des Unrechts bedurft, um es für ein großes Übel für den Menschen zu halten.
Aber Sokrates argumentiert nicht so. Nicht die utilitaristische Betrachtungsweise, die sich in dem Sprichwort: „Ehrlichkeit ist die beste Politik“, ausdrückt, liegt der sokratischen These zugrunde“ (siehe vor allem die Beweisführung im Gorgias, 506, c. 59). Nicht die möglichen Folgen unseres ungerechten Tuns, sondern die Unsittlichkeit der dahinterstehenden Haltung macht es für ihn zu einem größeren Übel.
Das objektive Gut setzt Wert voraus
Weil Ungerechtigkeit als solche ein sittlicher Unwert ist, ist sie zugleich ein objektives Übel für die Person; nicht weil sie ein objektives Übel für die Person ist, wird sie auch sittlich schlecht. Um zu verstehen, daß Ungerechtigkeit etwas Negatives oder Schlechtes ist, brauchen wir uns nicht erst zu fragen, ob sie ein Übel für die Person ist oder nicht. Wir können dies unmittelbar erfassen, wenn wir das Wesen der Ungerechtigkeit erkennen. Aber um einzusehen, daß sie ein objektives Übel für die Person ist und sogar ein größeres als das offenkundige des Unrechtleidens, müssen wir schon den inneren Unwert der Ungerechtigkeit erfaßt haben.
Die große Einsicht und der Erkenntnisbeitrag des Sokrates — eine Vorausahnung der Worte unseres Herrn: „Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, an seiner Seele aber Schaden leidet“ (Mt 16, 26) — ist gerade, gesehen zu haben, daß sittliche Integrität auf Grund ihres Wertes ein höheres Gut für die Person ist als der Besitz irgendeines anderen Lust oder Glück spendenden Gutes; oder, um in unmittelbarer Nähe der sokratischen These zu bleiben: sittlich schuldig sein ist ein größeres objektives Übel für die Person als jedes Leiden.
Sokrates brennt darauf zu zeigen: Unrecht ist zu seinem inneren Unwert auch das größte objektive Übel für den Menschen und dies wegen seines inneren Unwertes (Das ist Grundthema des Mythos am Ende des Gorgias). Wenn uns unser Gewissen nötigt, uns einer Ungerechtigkeit zu enthalten, so legt uns die in sich negative Bedeutsamkeit der Ungerechtigkeit und nicht das uns aus der Ungerechtigkeit erwachsende objektive Übel diese Verpflichtung auf. Mehr noch: Ungerechtigkeit ist ursprünglich und in sich böse; sie ist allein wegen ihres Unwertes ein objektives Übel für uns.
Der Unwert des Unrechts ist das principium. Sollen wir verstehen, daß es ein objektives Übel für uns ist, so müssen wir zuerst seinen inneren Unwert erfassen. Die wesenhafte Verknüpfung zwischen dem inneren Unwert des Unrechts und seinem Charakter als objektives Übel für die Person ist das wahre Thema der sokratischen These und stellt seinen wirklichen philosophischen Beitrag dar.
So sehen wir: Im Mittelpunkt der Erklärung des Sokrates steht ein Begriff des agathon, der sich bei genauer Analyse als unser Bedeutsamkeitstypus “das objektive Gut für die Person” erweist [18]. Wie sich zeigte, weicht er von Aristipps bonum-Begriff, dem bloß subjektiv Befriedigenden, ab. Ebenso unterscheidet er sich von jenem Grundbegriff des bonum, den wir das Bedeutsame in sich oder den Wert nannten. Weil Sokrates diese drei wesenhaft verschiedenen Begriffstypen nicht voneinander abgrenzt, gelingt es ihm nicht, die spezifische Eigenart des bonum-Begriffs herauszuarbeiten, der tatsächlich für ihn im Mittelpunkt steht, nämlich den des objektiven Gutes für die Person [19].
Die Bedeutsamkeitskategorie, die wir “das objektive Gut für die Person” nannten, spielt in unserer Motivation eine besondere Rolle, sobald es um das Gut für eine andere Person geht. Wenn wir von der Bekehrung eines Sünders hören, sind wir in doppelter Weise beglückt. Wir freuen uns zuerst über die innere Gutheit der Bekehrung, über ihre Bedeutsamkeit in sich oder ihren Wert, der Gott verherrlicht; zweitens sind wir glücklich für den Menschen selbst, weil er tat, was in der Richtung auf sein wahres Gut liegt, und weil er in seiner Bekehrung ein unschätzbares Geschenk empfing. Wir könnten diese zweifache Richtung unserer Freude auch wie folgt ausdrücken: an erster Stelle eine Wertantwort; an zweiter eine Antwort auf ein objektives Gut für ihn. Daher geht unsere Freude auf der einen Seite aus unserer Liebe zu Gott und auf der anderen aus unserer Liebe zum Nächsten hervor. Tatsächlich besitzt also ein und derselbe Gegenstand die beiden Bedeutsamkeitsarten [20].
Die Rolle des objektiven Gutes für die Person tritt in unserer intentio benevolentiae [21] gegenüber geliebten Personen evident hervor. Wir sehnen uns, den Geliebten glücklich zu machen, wir wollen ihn mit Wohltaten überhäufen und alles für sein Bestes tun. Wir fragen nicht, was ihn subjektiv befriedigen mag, sondern vielmehr, was objektiv gut für ihn ist. Hat er etwa einen unkontrollierbaren Hang zu alkoholischen Getränken, so werden wir ihm nicht Gelegenheit und Mittel verschaffen, diesem nachzugeben, obwohl es ihn subjektiv befriedigen würde. Es wäre eine falsche Liebe, die alles begünstigte, was für den Geliebten subjektiv befriedigend ist, ohne zu bedenken, ob es objektiv gut für ihn ist. Wahre Liebe wird immer diesen objektiven Maßstab des echten Gutes für den Geliebten vor Augen haben. Wenn der Geliebte eine Neigung zum Stolz hat, wenn er billige Schmeicheleien genießt, wird der wahrhaft Liebende diese Tendenz nicht unterstützen, seinen Stolz nicht befriedigen. Ist der Geliebte etwa rauschgiftsüchtig und muß sich einer Entziehungskur unterziehen, wird der Liebende ihm nicht heimlich die Injektionsnadel verschaffen, obwohl diese ihm eine subjektive Befriedigung brächte.Der Begriff des objektiven Gutes für die Person muß also nicht nur von dem Begriff des Wertes, sondern auch von dem nur subjektiv Befriedigenden unterschieden werden. Der Fall des Verzeihens, der uns früher half, das objektive Gut oder Übel für die Person von dem Wert oder Unwert abzugrenzen, zeigt ebenfalls klar die Verschiedenheit zwischen dieser Kategorie und dem bloß subjektiv Befriedigenden oder Unbefriedigenden.
Solange die Haltung eines anderen Menschen ausschließlich den Charakter des Unangenehmen und Unbefriedigenden für uns hat, besteht weder die Notwendigkeit noch die Möglichkeit für uns, ihm zu verzeihen. Ein Freund macht uns einen gerechtfertigten Vorwurf, der objektiv hilfreich für uns ist; aber unser Stolz nimmt ihn übel, da er unangenehm und demütigend ist. Wir deuten ihn falsch und grollen unserem Freund. Wenn wir nachher unseren ichbezogenen Krampf überwinden, wird uns ganz klar, daß wir keinen wirklichen Anlaß für einen Akt des Verzeihens haben, obwohl unser Freund etwas uns subjektiv Unangenehmes tat. Im Gegenteil, wir sind uns vielmehr bewußt, daß wir selbst Verzeihung brauchen, weil wir so verkehrt auf einen Vorwurf reagierten. Sobald etwas eine nur subjektiv negative Bedeutsamkeit hat, ohne gleichzeitig ein objektives Übel für uns zu sein, liegt keine Verpflichtung zu einem Verzeihensakt vor. Verzeihen setzt die Erkenntnis voraus, daß die Haltung eines anderen uns gegenüber die negative Bedeutsamkeit von etwas objektiv Ungerechtem oder Lieblosem hat.
Gewiß sind viele für uns unangenehme Haltungen oder uns Unrecht zufügende Handlungen zugleich ein objektives Übel für uns. Die Intention, uns Schmerzen oder Unrecht um ihrer selbst willen zuzufügen, hat, außer daß sie unangenehm ist, immer die negative Bedeutsamkeit eines objektiven Übels für uns. Diese beiden Formen der Bedeutsamkeit hängen tief zusammen; denn objektives Übel-für-uns-Sein setzt hier voraus, daß es etwas Schmerzliches und Unangenehmes ist. Aber dies widerspricht nicht der Tatsache, daß die beiden Bedeutsamkeitstypen wesenhaft verschieden sind und daß wir eine Haltung nach dem einen Gesichtspunkt beurteilen, wenn wir nur feststellen, sie sei unangenehm, und nach dem anderen, wenn wir sie als objektives Übel für uns betrachten. Dasselbe gilt für die entsprechenden positiven Fälle: weder ist jedes subjektiv Befriedigende ein objektives Gut für uns, noch ist jedes objektive Gut für uns subjektiv befriedigend.
Die Bedeutsamkeit des objektiven Gutes für die Person besitzt ein Element von Objektivität, die dem subjektiv Befriedigenden vollständig fehlt. Vom extremen Standpunkt des bloß subjektiv Befriedigenden besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen dem Anblick eines leidenden Feindes, den ein Rachsüchtiger als befriedigend erlebt, und der legitimen Befriedigung beim Geldverdienen; kein Unterschied zwischen der sadistischen Lust, einen anderen zu quälen, und dem Vergnügen, einen guten Wein zu kosten; kein Unterschied zwischen dem Geldgewinn durch Lotteriespiel oder durch Diebstahl.
Zusammenfassend können wir sagen: In unserer Motivation finden sich drei fundamental verschiedene Bedeutsamkeitskategorien. Sie sind nicht nur empirische Realitäten, die de facto in menschlichen Motivationen auftauchen; sie sind drei mögliche rationes, die die Bedeutsamkeit eines Objektes begründen können, drei wesentliche Gesichtspunkte für jede mögliche Motivation, sei sie die von Menschen oder die von Engeln. Es ist unerläßlich für uns, den fundamentalen und notwendigen Charakter dieser drei Bedeutsamkeitskategorien und ebenso ihre wesenhafte Verschiedenheit voll zu erfassen. So verschieden auch ihr Rang sein mag, so besitzen sie doch ohne jeden Zweifel alle drei ihr eidos, ihre intelligible Wesenheit. Darum ist ihre Entdeckung nicht das Ergebnis empirischer Beobachtung, sei sie psychologischer oder sonstiger Art, sondern einer philosophischen Einsicht, analog derjenigen, die die verschiedenen Kategorien der Prädikation voneinander abgrenzt.
Wir sehen, besonders vom ethischen Gesichtspunkt aus wissen wir nur wenig, solange wir nur sagen, jeder Wille ist auf ein Gut gerichtet. Es kommt eben gerade darauf an, ob die motivierende Bedeutsamkeitskategorie der Wert, das objektive Gut für die Person oder das bloß subjektiv Befriedigende ist.
Diese Einsicht wird sich später als außerordentlich bedeutungsvoll erweisen, denn sie wird auch die Unrichtigkeit der aristotelischen These aufdecken, nach der unsere Freiheit auf die Mittel und nicht auf die Ziele beschränkt ist. Der große und entscheidende Unterschied im sittlichen Leben eines Menschen liegt gerade darin, ob er die Welt vom Gesichtspunkt des Wertes oder des bloß subjektiv Befriedigenden betrachtet. Es ist die berühmte Unterscheidung, die der hl. Augustinus in De civitate Dei in die Worte faßt: „Doch es gibt nicht mehr als zwei Arten von menschlichen Gesellschaften, die wir gemäß der Schrift die beiden Staaten nennen können. Den einen bilden die Menschen, die nach dem Fleische, den anderen, die nach dem Geist leben« (XIV, 1).
Direkte und indirekte Bedeutsamkeit
Aber dieses Thema werden wir später besprechen. Bevor wir jedoch die Sphäre der Motivation verlassen, müssen wir noch eine andere Unterscheidung im Bereich der Bedeutsamkeit erwähnen. Obwohl sie keine neue Bedeutsamkeitskategorje ist, spielt sie doch eine große Rolle, die im Lauf der Philosophiegeschichte oft hervorgehoben wurde. Es ist die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter oder primärer und sekundärer Bedeutsamkeit. Tatsächlich ist es ein entscheidender Unterschied in der Bedeutsamkeit eines Objektes für unsere Motivation, ob es um seiner selbst oder um etwas anderen willen erstrebt wird. Diese Verschiedenheit spielt in Aristoteles‘ Nikomachischer Ethik eine überragende Rolle; sie ist für ihn sogar das bestimmende Merkmal des höchsten Gutes. Ein Gut wird um seiner selbst willen erstrebt, während alles übrige um dieses Gutes willen gewählt wird. Diese Distinktion entspricht der zwischen Mittel und Zweck. Wir interessieren uns für ein Medikament nicht um seiner selbst willen, sondern nur soweit es zur Wiederherstellung unserer Gesundheit oder Stillung eines Schmerzes dient. Ein guter Wein dagegen zieht uns um seiner selbst willen an. Das Medikament ist bloß ein Mittel, der gute Wein oder vielmehr sein Genuß ein Zweck. Ein Mensch ist in Lebensgefahr. Unser Zweck ist, ihn zu retten; er beschäftigt uns um seiner selbst willen. Das Seil, mit dem wir ihn aus dem Wasser ziehen, hat nur als Mittel zu diesem Zweck eine Bedeutung. Dieser Unterschied zwischen Mittel und Zweck durchzieht unser ganzes Leben. Wir unterscheiden beständig zwischen Dingen, die um ihrer selbst, und solchen, die nur um etwas anderen willen erstrebt werden. Im zweiten Fall nehmen die Dinge den Charakter bloßer Mittel an; denn sie werden, abgesehen von jedem Wert, den sie in sich besitzen mögen, betrachtet. Es ist von großer Wichtigkeit zu verstehen, daß die in sich ruhende Bedeutsamkeit des Wertes nicht mit der Bedeutsamkeit inhaltsgleich ist, die alle ihrer selbst wegen erstrebten Dinge charakterisiert. Mit anderen Worten: ein Wert ist nicht dasselbe wie ein Zweck oder ein Objekt von direkter Bedeutsamkeit. Die in sich ruhende Bedeutsamkeit des Wertes bezieht sich auf die Natur der Bedeutsamkeit als solcher, während das Erstrebtwerden um seiner selbst willen — wir wollen es „direkte Bedeutsamkeit“ nennen — die Art bezeichnet, in der die Bedeutsamkeit einem Seienden anhaftet oder ihm eigen ist. Das seiner selbst wegen Begehrte ist direkt bedeutsam. Seine Bedeutsamkeit hängt nicht von einer finalen Verknüpfung mit etwas anderem ab. Bloße Mittel sind dagegen nur indirekt bedeutsam; sie borgen ihre Bedeutsamkeit gleichsam von der des Endzweckes, dem sie dienen. Ihre Eignung, der Verwirklichung eines wichtigen Zweckes zu dienen, verleiht ihnen eine sekundäre oder auxiliäre Bedeutsamkeit.
Der Unterschied zwischen direkter und indirekter oder primärer und sekundärer Bedeutsamkeit findet sich sowohl bei den Werte tragenden Gütern, wie auch bei den objektiven Gütern für die Person und dem nur subjektiv Befriedigenden. Gesundheit ist ein objektives Gut für die Person. Penicillin hat eine indirekte oder sekundäre Bedeutsamkeit als ein Mittel, unsere Gesundheit wiederherzustellen [22]. Weil es ein Mittel für ein objektives Gut der Person ist, nimmt es an dieser Bedeutsamkeit teil und ist so ein sekundäres objektives Gut für die Person. Penicillin ist tatsächlich ein großes objektives Gut für die Menschheit, jedoch offensichtlich ein indirektes.
Wir sehen also: Der Wert, das objektive Gut für die Person und das bloß subjektiv Befriedigende stellen drei wesenhaft verschiedene Bedeutsamkeitstypen in unserer Motivation dar; der Unterschied zwischen direkter und indirekter Bedeutsamkeit betrifft dagegen ausschließlich die Frage, wie die Bedeutsamkeit einem Seienden zugehört. Offenbar überschneidet also eine Unterscheidung die andere.
Die Verschiedenheit zwischen der Bedeutsamkeit des Zweckes und der der Mittel wurde oft gesehen und hervorgehoben. Aber sie führt nicht zu irgendeiner neuen Motivationskategorie, die als vierter Bedeutsamkeitstyp aufgezählt werden könnte. Sie geht vielmehr in eine gänzlich andere Richtung und durchschneidet die drei fundamentalen Bedeutsamkeitstypen, wie wir oben sagten. Es wäre darum ein vollendeter Irrtum, den Zweck mit einem Wert gleichzusetzen, also mit dem Charakter eines Seienden, das um seiner selbst willen erstrebt wird, weil man beide, Wert und Zweck, in sich selbst bedeutsam nennen kann. Dieser Terminus hat, wie wir sahen, in jedem Fall einen völlig verschiedenen Sinn.
4. Kapitel: Das Nützliche
Aristoteles unterscheidet in seiner Nikomachischen Ethik drei verschiedene Typen von Gütern: das agathon (bonum honestum), das hedy (bonum delectabile) und das chresimon (bonum utile).Man könnte fragen: Ist das Nützliche wirklich eine neue Bedeutsamkeitskategorie, die man den drei obengenannten hinzufügen sollte, oder kann es mit der indirekten Bedeutsamkeit gleichgesetzt werden? Wir wollen hier keine vollständige Darstellung des klassischen Begriffes „nützlich“ geben; doch eine kurze Analyse seiner Natur und seiner verschiedenen möglichen Inhalte wird uns die Beantwortung dieser Frage ermöglichen.
Die Rangordnung der Mittel
Wir haben schon gesehen, daß ein Mittel, weil es einem bestimmten Zweck dient, damit auch die Bedeutsamkeitsart teilt, die der Zweck besitzt. Aber außer dieser indirekten Bedeutsamkeit, die je nach der des Zweckes wechselt, gibt es noch jene Art von Perfektion, die einem Mittel als solchem zukommt: d. h. seine Fähigkeit, einem Zweck wirklich zu dienen, seine Eignung für diesen. Diese Perfektion kommt dem Mittel nicht sekundär, sondern primär zu. Die Tauglichkeit zu schneiden ist eine direkte Eigenschaft des Messers. Gewiß ist sie wesenhaft auf den Zweck bezogen und darum die Voraussetzung dafür, daß das Messer die Bedeutsamkeit des Zweckes teilt. Aber die Eignung zum Schneiden kommt dem Messer selbst zu. Über dieser steht jedoch die Bedeutsamkeit des Zweckes, die das Motiv für mein Gebrauchen des Messers ist. Ich will z. B. einen geknebelten und gefesselten Mann befreien. In diesem Zusammenhang bekommt das Messer auf Grund des besonderen Zweckes eine große Bedeutung. Offensichtlich ist die indirekte Bedeutsamkeit des Messers — in diesem Fall ein hoher Wert — nicht mit seiner Eignung zum Schneiden identisch.
Vielleicht erhebt sich die Frage: Ist diese Geeignetheit nicht ein neuer Bedeutsamkeitstyp? Darauf müssen wir antworten: Vom Gesichtspunkt der möglichen motivierenden Kraft, die Gegenstände annehmen mögen, kann das Nützliche nicht als neue Bedeutsamkeitskategorie angesehen werden. Denn niemals würden wir ein Mittel wählen, wenn wir nicht einen bestimmten Zweck anstrebten und nicht tatsächlich dieser unsere Handlung motivierte. Ebensowenig konstituiert die Geeignetheit in sich eine unabhängige Bedeutsamkeitskategorie. Sie verleiht einem Seienden keine Qualität, vermöge deren es uns motivierte, obwohl wir vielleicht ein Ding statt eines anderen als Mittel für einen Zweck wählen (der uns wirklich motiviert), weil es für ihn besser geeignet ist.
Innerhalb der Mittel gibt es daher eine Skala, die sich nicht nur auf den Rang des Zweckes, sondern in erster Linie auf diese Geeignetheit für einen Zweck bezieht. In diesem Sinne können wir sagen: Penicillin ist brauchbarer als Sulfonamide. Die einzelnen Mittel besitzen größere oder geringere Eignung für ein und denselben Zweck, und was wir Fortschritt nennen, besteht hauptsächlich darin, ein Instrument durch ein wirksameres zu ersetzen. Viele Gesichtspunkte kommen bei der Aufstellung solch einer Skala der Wirksamkeit von Mitteln zusammen. Nicht nur größere Sicherheit, Genauigkeit, Schnelligkeit und Leichtigkeit im Erreichen eines gegebenen Zweckes machen ein Mittel geeigneter als ein anderes, auch der Gesichtspunkt, ob dem Zweck mit oder ohne negative Begleitumstände gedient wird, ist einbezogen. Z. B. kann ein bestimmtes Medikament, trotz seiner Überlegenheit in der Bekämpfung einer gegebenen Krankheit, nur wegen möglicher nachteiliger Nebenwirkungen auf einer niedrigeren Stufe stehen als ein weniger wirksames. Schließlich kann ein Mittel, das sich leichter beschaffen läßt als ein anderes, von dem reichlicherer Vorrat da ist, den Vorzug vor anderen haben, die nicht weniger wirkungsvoll und ebenso gefahrlos sind.
Wir sehen also, es gibt eine Stufung in der Tauglichkeit von Mitteln, die innerhalb des Rahmens eines gegebenen Zweckes einem Mittel Überlegenheit über ein anderes gibt. Das Wort „nützlich« bezieht sich oft einfach auf diese Brauchbarkeit. Je größer die Geeignetheit, für um so nützlicher erklären wir etwas. Wir können auch etwas nutzlos nennen, weil ihm die Eignung für einen bestimmten Zweck fehlt.
Vielfältige Nützlichkeit
Aber das ist nicht der einzig mögliche Sinn von „nützlich“. Es ist noch nicht die gesamte Gegebenheit, die wir meinen, wenn wir von etwas sagen, es sei nützlich. Wir können etwas mehr oder weniger nützlich nennen, ohne uns auf ein und denselben Zweck zu beziehen. Wir können die Dinge vom Gesichtspunkt ihrer möglichen Wirksamkeit betrachten, d. h. ihrer Potenz, als Mittel für eine große Vielfalt von Zwecken zu dienen. Nützlichkeit bedeutet dann eine potentielle „Fruchtbarkeit“ [23], wobei man nicht vergleicht, in welchem Grad etwas für ein und denselben Zweck geeignet ist. Ist die Fähigkeit eines Dinges, als wirksames Mittel zu dienen, nicht auf einen bestimmten Zweck beschränkt, dann konstituiert sich eine Perfektion, die ihm den spezifischen Charakter der Nützlichkeit gibt.
Wenn wir sagen, Elektrizität ist sehr nützlich, oder Wasser ist eines der nützlichsten Dinge, so heben wir die Vielseitigkeit ihrer potentiellen Eignungen hervor. Wir meinen, sie können als Mittel für viele Zwecke verwendet werden und sind in allen diesen verschiedenen Fällen kraftvoll wirksam. Diese Doppelwertigkeit ihrer Eigenschaft als Mittel betonen wir, wenn wir von ihrer Nützlichkeit als solcher sprechen, ohne uns auf einen besonderen Zweck zu beziehen.
Das Nutzlose als Gegensatz zum Nützlichen bezeichnet dann die Ungeeignetheit, irgendeinem Zweck zu dienen.
Das treffendste Beispiel für Nützlichkeit in diesem allgemeinen Sinne ist vielleicht das Geld. Hier überschattet der Charakter des Mittels nicht nur jeden anderen Gesichtspunkt (denn Geld ist wesenhaft nichts anderes als ein Mittel), sondern es zeigt sich zugleich die auffallende Tatsache einer vollständigen Neutralität gegenüber jeder Verwendung. Wir haben hier ein höchst wirksames Mittel, weil es die größte Freiheit bezüglich des Zweckes läßt, für den es verwendbar ist.
Die Elementargüter
Doch selbst diese potentielle Wirksamkeit, Stärke und Fruchtbarkeit, diese nach allen Seiten ausstrahlende Verwendbarkeit schöpft noch nicht den vollen Gehalt des Terminus „nützlich“ aus. Obwohl wir nicht unbedingt nur einen gegebenen Zweck im Auge haben, wenn wir etwas nützlich nennen, denken wir doch im allgemeinen an einen spezifischen Zweckbereich. In seiner legitimsten Bedeutung bezeichnet das „Nützliche“ einen besonderen Typus innerhalb der Dinge, die wir „objektive Güter für die Person” nannten. Wir können sie die „Elementargüter für die Person“ nennen. Sie umfassen die für unser Leben unentbehrlichen Dinge und alles, was mit unserem körperlichen und geistigen Wohl und unserer Sicherheit, soweit wir Individuen und Glieder der menschlichen Gesellschaft sind, zusammenhängt Nahrung, Kleidung und Wohnung; Gesundheit, Freiheit, Friede und Ordnung sind solche Elementargüter In dieser Hinsicht stellen wir das Nützliche allem Überflüssigen gegenüber, allem, was dem bloßen Vergnügen, dem Luxus und Zeitvertreib dient, und fordern für dieses, daß man es ernster nimmt und ihm einen gültigeren Sinn zuerkennt. Aristoteles und der hl. Thomas scheinen Nützlichkeit in diesem Sinne zum Ausgangspunkt genommen zu haben, um das bonum utile von dem bonum honestum und beide von dem bonum delectabile zu unterscheiden. So verstanden müssen wir das Nützliche als zur Kategorie des indirekten objektiven Gutes für die Person gehörig betrachten. Demnach ist es eindeutig kein neuer Bedeutsamkeitstyp, den wir den obengenannten hinzufügen könnten.
“Unentbehrlichkeit“ jedoch ist kein eindeutiger Begriff. Was man zu Recht für unerläßlich hält, wechselt mit der Organisation der Gesellschaft. Innerhalb einer Zivilisation wie der unserigen können z. B. die Transportmittel wie Autos, Flugzeuge usw. den Charakter von Elementargütern annehmen. Dasselbe gilt für Aufzüge in einem vielstöckigen Gebäude. Elektrisches Licht, gepflasterte Straßen und Telefon kann man als nützlich in dem Sinne ansehen, daß sie integrierende Bestandteile eines ganzen, jetzt vorherrschenden und uns unter den gegebenen historischen Bedingungen irgendwie auferlegten Lebensstiles bilden. Oft mögen diese Dinge nur dazu dienen, das Leben leichter und bequemer zu machen, aber sie können auch den Charakter von Elementargütern annehmen, auf die Nützlichkeit in diesem Sinne wesentlich gerichtet ist. So ist ein Aufzug kein Luxus für einen Menschen, der hoch in einem Gebäude wohnt oder wegen Krankheit oder hohen Alters die Treppen zu seiner Wohnung nicht emporsteigen kann. Ebenso ist das Telefon, mit dem wir den Arzt im Notfall herbeirufen, zweifellos Mittel für ein elementares Gut.
Selbstverständlich kann das, was man als unbedingt nötig erachtet, oft willkürlich ausgedehnt werden. Ein Mann mit bescheidenen Mitteln mag zwei Anzüge für unerläßlich halten, und ein Reicher zwanzig. Wiederum erfordert die Frage, was für jemanden, der eine besondere Verpflichtung oder Aufgabe hat, unentbehrlich ist, einen neuen und andersartigen Gesichtspunkt für den Sinngehalt dieses Terminus. All dies zeigt uns, daß der Begriff der Nützlichkeit schwankt, soweit er sich an der Unentbehrlichkeit der Zwecke, für die etwas als Mittel dient, orientiert; wir müssen ihn als relativ ansehen, denn er hängt von Umständen und Bedingungen ab.
Dieser klassische Begriff von Nützlichkeit verdient noch von einer anderen Perspektive aus Beachtung. Wir nennen eine Arbeit nicht nur nützlich, weil sie unmittelbar zur Produktion unerläßlicher Güter beiträgt — z. B. ein Haus zu bauen oder Kleider zu nähen —‚ sondern auch als Mittel, Geld zu verdienen, das seinerseits wieder ein Mittel für elementare Güter ist, jedoch nicht auf sie beschränkt bleibt. Gelderwerb betrachtet man als nützlich, selbst im Falle eines Millionärs, der das Geld gewiß nicht in erster Linie für Elementargüter verwendet. Die Arbeit, die ein Mittel zum Geldverdienen ist, teilt hier irgendwie den “neutralen“ Charakter des Geldes. Das gilt unabhängig von der Art der Arbeit, die wir verrichten, d. h. unabhängig von der Frage, ob das Ergebnis der Arbeit in sich nützlich ist. Obwohl Bridgespielen nicht nützlich, sondern ein typischer Zeitvertreib ist, ist die Herstellung von Bridgekarten als ein Weg, Geld zu verdienen, nützlich.
Die Geeignetheit der Mittel
Abgesehen von der Beziehung zum Geld hat dieses Paradox noch einen anderen Sinn: Obwohl man den Zweck, dem schließlich gedient wird, für typisch überflüssig hält, betrachtet man doch die Mittel, ihn zu erreichen oder zu fördern, als nützlich. Hier geht es einfach um die Angemessenheit des Mittels für den Zweck, die mit dem teleologischen Charakter des Mittels als solchen zusammenhängt. Zigarettenrauchen kann man nicht als elementares oder unentbehrliches Gut betrachten, aber einen Zigarettenanzünder nennt man nichtsdestoweniger mit Recht nützlich. Hier sieht man auf die Geeignetheit des Mittels in ihrer immanenten Logik. Das Mittel erfüllt seine Aufgabe, wenn es den Zweck verwirklicht; dies allein gibt einem Instrument, ganz unabhängig von dem Charakter des verwirklichten Zweckes, etwas nüchtern Klares, Rationales im Gegensatz zu allen schlecht konstruierten Dingen, die ihre Aufgabe mangelhaft oder überhaupt nicht erfüllen. Daher das Paradoxon, daß ein Mittel eine Würde zu haben scheint, die dem Zweck nicht eigen ist. Selbst wenn der Zweck nicht spezifisch genug ist, um einen bestimmten Bedeutsamkeitstyp beanspruchen zu können, hat das Mittel doch an einer gewissen Würde teil, insofern ihm primär unser Augenmerk gilt und wir es für geeignet halten, etwas Seriösem und gültig Bedeutsamem zu dienen. Aber das ist noch nicht alles: selbst wenn der Zweck bestimmt keinen seriösen Charakter hat, z. B. im Fall, wo es sich um bloßes Vergnügen und reinen Luxus handelt, ist dem Mittel noch eine Würde eigen, denn es wird als zuverlässiges und wirksames Instrument gewertet.
Abgrenzung vom Nutzlosen
Wenn wir zur Grundbedeutung des Nützlichen zurückkehren, sehen wir, daß sie sich primär auf die Fähigkeit der Dinge bezieht, als Mittel für elementare objektive Güter der Person zu dienen; zugleich schließt sie die Würde ein, welche Dinge durch ihre Tauglichkeit zur Erfüllung gewisser teleologischer Funktionen erhalten. Den Gegensatz dazu bilden alle jene Dinge, denen ein solches Vermögen, den Elementargütern für die Person wirksam zu dienen, fehlt. Die nützlichen Dinge sind darum sowohl dem Nutzlosen wie dem nur Angenehmen entgegengesetzt. Obwohl sie zu den hohen objektiven Gütern für die Person und den Werten nicht im Gegensatz stehen, sind sie doch auch von ihnen scharf geschieden.In diesem letztgenannten Sinn sind Physik, Chemie und Medizin nützliche Wissenschaften; Philosophie ist keine nützliche Wissenschaft. Technik ist nützlich, nicht die Kunst. Zivilisation ist nützlich, Kultur ist es nicht. Eine Sprache lernen ist nützlich, Musik hören nicht. Selbst ein Kloster, das eine Schule oder ein Krankenhaus hat, würde man nützlich nennen; nicht aber einen kontemplativen Orden oder das liturgische Gotteslob. Solange wir diese Unterscheidung als bloße Klassifizierung verwenden, ohne sie mit irgendeiner Würdigung der Merkmale des Nützlichen und Nutzlosen zu verbinden, ist nichts gegen dieses Vorgehen und Benennen zu sagen.
Aber nur zu oft setzt an diesem Punkt eine verhängnisvolle Verzerrung ein. Für die utilitaristische Mentalität wird das bonum utile der ausschließliche Maßstab zur Beurteilung der Dinge. Was nicht nützlich ist, wird für nutz- und sinnlos erklärt und hat keine Daseinsberechtjgung. Es gilt als Zeitverschwendung, als etwas Überflüssiges, völlig Unseriöses. Güter von hohem Wert, wie das liturgische Gotteslob, alle Bande der Liebe zu anderen Menschen, jede Schönheit, die ganze Sphäre der Kunst, die Philosophie, kurz, alle Dinge, die nicht praktisch unentbehrlich sind, werden mit dem Überflüssigen auf gleiche Stufe gestellt und als nutzlos abgestempelt. Die ganze Sphäre des echten frui — die Freude an hohen, Werte tragenden Gütern, die uns ein wahres und edles Glück spenden, wird in dieselbe Kategorie mit den Dingen eingeordnet, die man als Luxus und Zeitverschwendung betrachtet. In einer gewaltsamen und falschen Alternative wird die mehr oder weniger willkürlich erweiterte Sphäre der Elementargüter und alles, was ihrer Verwirklichung dient, ausschließlich als werthaft, würdevoll und der Mühe wert angesehen, während alles übrige als wertlos, unnütz oder nur romantisch gilt. Eine graue, neutrale Vernünftigkeit wird zum Ideal; eine Froschperspektive dominiert, in der die Sublimität der Werte verblaßt, in der das Verkosten großer und edler Güter stillschweigend ignoriert wird.
Die analoge biblische Bedeutung des Nützlichen
Aber es gibt auch eine analoge Bedeutung von „nützlich“, die ganz genuin und sinnvoll ist. Hier wird das Nützliche generell allen leeren und nutzlosen Dingen entgegengestellt. Der Ausdruck umfaßt dann alles in sich Gehaltvolle, die objektiven Güter für die Person ebenso wie die Werte. Auf der einen Seite stehen Klatsch, geistige Trägheit, sinnloses Gerede, das Laufen von einer Geselligkeit zur anderen, Träumereien, oberflächlicher Zeitvertreib usw. und auf der anderen Seite das Edle, Ernste, Sinnvolle und Notwendige — gleichgültig, ob die Dinge diesen Charakter auf Grund ihres Wertes oder ihrer Unentbehrlichkeit besitzen. In diesem Sinne sollten wir die Zeit mit sinnvollen und nicht mit eitlen Dingen „nützen“ (Eph 5, 16). Nützlichkeit in diesem biblischen Sinne ist der Gegensatz zu Eitelkeit und offenbar nicht mehr Kennzeichen einer bestimmten Sphäre von Gütern oder eines spezifischen Typs sekundärer Bedeutsamkeit, der sich von dem delectabile und honestum der aristotelischen und thomistischen Philosophie abgrenzen ließe. In diesem gänzlich analogen Sinn ist sie nicht auf die Mittel beschränkt, noch hat sie etwas mit der ersten Bedeutung von utile gemeinsam, außer daß sie die Antithese von Zeitvergeudung und Nutzlosigkeit ist.
Im Licht der Heiligen Schrift oder der übernatürlichen Bestimmung des Menschen gibt es noch einen anderen Begriff des „Nützlichen“, demgemäß das bonum utile mehr oder weniger nutzlos ist. Es ist jene in dem Ausspruch des hl. Aloisius enthaltene Bedeutung: Quid hoc ad aeternitatem? — (Was bedeutet das für die Ewigkeit?) — oder in den Worten unseres Herrn: „Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganz Welt gewinnt, an seiner Seele aber Schaden leidet“ (Mt 16, 26).
Das Nützliche im Sinn des unum necessarium „des einen, das not tut“, wird im Evangelium immer wieder dem bonum utile gegenübergestellt, etwa in den Worten: „Seid darum nicht ängstlich besorgt und fragt nicht: was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder womit sollen wir uns kleiden?“ (Matth 6, 31).
Vor allem aber zeigt sich die Antithese des unum necessarium zu dem bonum utile in den an Martha gerichteten Worten Christi, als sie Maria anklagte, das Nützliche (im Sinn des bonum utile) zu vernachlässigen: „Martha, Martha, du mühst und sorgst dich um viele Dinge! Eines nur ist notwendig. Maria hat den besten Teil erwählt, der nicht von ihr wird genommen werden“ (Luk 10, 41 — 42).
5. Kapitel: Der Primat der WerteBevor wir uns der Analyse der Bedeutsanikeitsarten zuwenden, die das Seiende unabhängig von den möglichen Gesichtspunkten der Motivation besitzt, müssen wir zuerst die noch entscheidendere Frage aufwerfen: Welche Art der Bedeutsamkeit ist nun die objektiv gültige, wahre, welche hat das letzte Wort? Damit kommen wir zu einer Themenstellung, die sich eindeutig abhebt von der Untersuchung der verschiedenen Gesichtspunkte von Bedeutsamkeit.
Haben wir einmal erfaßt, was Bedeutsamkeit ist, dann verstehen wir, daß diese elementare Frage unabhängig von unserer Motivation besteht. Denn bei der Betrachtung eines Seienden stellt sich das Problem seiner Bedeutsamkeit nicht bloß vom Gesichtspunkt einer möglichen Motivation aus. Die Frage nach der Bedeutsamkeit hat einen ebenso ursprünglichen und objektiven Sinn wie die nach Wahrheit und Existenz. Es ist offensichtlich absurd, anzunehmen, das Problem des Seienden und der Existenz erhebe sich nur für unsere Erkenntnis und vom Gesichtspunkt der Befriedigung unseres Wissensdranges aus. Dasselbe gilt von der Frage der Bedeutsamkeit. Der Kontrast zwischen der grauen, faden Leere des Indifferenten und der farbigen, sinnträchtigen Fülle des Bedeutsamen enthüllt uns die letzte Tragweite dieser Frage. Die Fiktion einer absolut neutralen und indifferenten Welt könnten wir keinen Augenblick lang ertragen. Bedeutsamkeit ist so fundamental wie das Sein. Die Annahme, es gäbe keine Bedeutsamkeit, alles sei in Wirklichkeit neutral, jede Bedeutsamkeit ein bloß relationaler Aspekt, würde einem vollständigen Zusammenbruch des Kosmos gleichkommen. Wir verstehen jetzt die elementare — ich möchte sogar sagen unvermeidbare — Wichtigkeit der Frage: Was ist der Sinn, die Bedeutsamkeit eines Seienden?
Hier liegen letzte, an die Wurzeln unseres Daseins gehende, im wahrsten Sinne des Wortes existentielle Probleme. Aber sie transzendieren den Bereich unseres eigenen Seins; denn sie beziehen sich auf etwas, was seine von uns unabhängige innere Notwendigkeit hat und die letzte metaphysische Schicht berührt. Solcherart ist die Frage nach dem Sinn und der Bedeutsamkeit des einzelnen Seienden und vor allem des ganzen Universums. Wenn wir nur wissen, daß etwas ist oder existiert, sind wir noch nicht zu der vollen Antwort durchgedrungen, die sich objektiv aufdrängt und nach der unser Geist wesenhaft dürstet. Die Existenz eines Dinges ruft notwendig die Frage nach seinem Sinn, seiner Bedeutsamkeit hervor. Die metaphysische Unbefriedigtheit, die wir erfahren, solange wir keine Antwort auf diese letzte Frage über das Universum haben, ist in der natürlichen Sphäre ein Präludium zu jener “Unruhe”, die nach dem hl. Augustinus unser Herz erfüllt, bis wir Gott gefunden haben.
Auch im Begriff der raison d'être ist die Vorstellung von Bedeutsamkeit letztlich enthalten. Denn dieselbe Frage würde hinsichtlich jeder Finalursache auftauchen, die uns die raison d'être ihrer Mittel erst aufzeigt; und nur die Bedeutsamkeit des Objektes könnte eine zufriedenstellende Antwort geben. Überdies führt die Frage nach ihrer raison d'être bei vielen Arten des Seienden durchaus nicht in die Richtung einer Finalursache. Wir müssen uns klarmachen, daß uns die Frage der Bedeutsamkeit beständig gegenwärtig ist: tatsächlich ist sie so selbstverständlich, daß sie darum nicht zum Gegenstand unseres philosophischen Staunens wird.
Ist uns diese Frage aber einmal ganz bewußt geworden, so verstehen wir auch, daß diese Bedeutsamkeit mit dem in sich Bedeutsamen, dem Wert, inhaltsgleich ist. Keine andere Art der Bedeutsamkeit könnte je diese letzte Antwort geben. Mit der Feststellung, etwas sei subjektiv befriedigend oder selbst ein objektives Gut für die Person, bleibt die fundamentale Frage seiner endgültigen Bedeutsamkeit unbeantwortet.
Die wahre Gehaltfülle von Sinn und Bedeutsamkeit kann nur im Wert gegeben sein. Wie nur die Autonomie des Seins (d. h. seine Vorgegebenheit gegenüber dem Bewußtsein und seine Unabhängigkeit von unserem Geist) die letzte Erfüllung unseres Suchens nach Wahrheit zu spenden vermag, ebenso kann die unabweisbare metaphysische Frage der Bedeutsamkeit nur von dem autonom in sich Bedeutsamen, dem Wert beantwortet werden.
Es gibt in der Philosophie Probleme, nach denen man nur zu fragen braucht, um die Antwort sogleich zu erfassen. In diesen Fällen besteht die vornehmliche philosophische Tat darin, die Frage zu stellen, die so leicht übersehen wird, gerade weil die Antwort so offenbar ist. Von dieser Art ist die Frage: Welches ist die wahre, gültige Bedeutsamkeit? Es kann nur der Wert sein.
6. Kapitel: Die Rolle des Wertes im Leben des Menschen
Das datum des Wertes wird überall vorausgesetzt. Wir brauchen gar nicht erst zu betonen, wie viele Aussagen den Begriff des Wertes enthalten. Ob wir einen Menschen als gerecht oder zuverlässig rühmen, ob wir jemanden von der Richtigkeit der Naturwissenschaften überzeugen wollen, ob wir ein Gedicht, das wir lesen, schön finden, ob wir eine Symphonie als bedeutend und sublim preisen, ob wir uns im Frühling iiber die knospenden Bäume freuen, ob die Großmut eines anderen uns rührt, ob wir für die Freiheit kämpfen, ob unser Gewissen uns verbietet, von der Schädigung eines anderen zu profitieren — immer ist der Begriff von etwas in sich Bedeutsamem vorausgesetzt. Sobald wir versuchen, von der Bedeutsamkeit zu abstrahieren und alles als völlig neutral und bloß faktisch anzusehen, verlieren alle diese Aussagen, alle diese Antworten ihren Sinn. Sie werden tatsächlich unmöglich. Immer, wenn wir eine Handlung vom sittlichen Gesichtspunkt aus erwägen, setzen wir die Gegebenheit eines Wertes, eines in sich Bedeutsamen voraus. In jeder Entrüstung über etwas Gemeines und Niedriges, in jedem Ausruf, ein Ereignis sei ein großes Unglück, in jeder Erklärung, dieser Philosoph stehe höher als jener, ein Maler sei ein größeres Genie als ein anderer, überall setzen wir beständig das datum des Wertes voraus.
Versuchen wir, uns eine vollkommen neutrale Welt vorzustellen — eine wesenhaft unmögliche Fiktion —‚ so wird uns klar, daß alles seinen Sinn verlieren würde: unser Leben wäre zu einem absurden circulus vitiosus herabgedrückt; es würde sogar unter das Niveau des tierischen Lebens absinken. Selbst in einer Welt, in der nur die Bedeutsamkeit des subjektiv Befriedigenden existierte, würde unser Leben zusammenbrechen. Eingekerkert in unsere Egozentrik, ohne den „archimedischen Punkt“ objektiver Bedeutsamkeit, wären wir vom wahren Glück wie von jeder Selbsthingabe, von aller Liebe, aller Begeisterung und Bewunderung ausgeschlossen. Wir könnten nicht einmal behaupten, daß Weisheit der Torheit vorzuziehen ist. Es gäbe für uns keinen objektiven Grund, diese Richtung statt jener einzuschlagen, außer wir wären entweder von unseren Instinkten oder unserem Verlangen nach dem subjektiv Befriedigenden dazu getrieben, oder die neutralen Naturgesetze zwingen uns, ihnen zu folgen. [24]
Mit der Betonung dieser Tatsachen führen wir den Wert keineswegs als ein Postulat ein. Eine solche Interpretation würde vollständig mißverstehen, was wir meinen: wir müssen den Begriff des Wertes voraussetzen, um unser Leben tragbar oder sinnvoll zu machen. Unser Ziel ist ausschließlich, die Konsequenzen aus einer Leugnung des Wertbegriffes zu ziehen und zu zeigen, in welchem Ausmaß er beständig vorausgesetzt wird. Wir möchten dem Leser die Gelegenheit zur prise de conscience einer Realität geben, die ihm in einer tieferen Schicht stets gegenwärtig ist, auf die er sich beständig bezieht und mit der er dauernd rechnet, weil er ihrer implicite inne ist. Unser Ziel ist hier, jedermann an das zu erinnern, was er in einer tieferen Schicht besitzt, ihn in diese tiefere Schicht zu ziehen, in der er das datum des Wertes erfaßt und die gerade den Angelpunkt des Daseins und des Lebens bildet.
Wir wollen nur dem Leser helfen sich klarzumachen: Trotz der Trennungswand, die philosophische Theorien und Erklärungen zwischen seinen unmittelbaren Kontakt mit dem Seienden und seinem philosophischen Erfassen aufgerichtet haben, ist der Wert nichts Absonderliches. Er ist nicht irgendein seltsames, merkwürdiges, von einer neuen philosophischen Theorie eingeführtes Ding, sondern im Gegenteil etwas uns beständig Gegenwärtiges. Wir möchten dem Leser bewußt machen: Der Wert ist eine so selbstverständliche Gegebenheit, daß wir ihn jeden Augenblick voraussetzen. Haben wir uns erst einmal von allen verfälschenden Interpretationen und Theorien freigemacht, dann sehen wir die Realität der Werte in so überwältigender Klarheit, daß wir gar nicht mehr verstehen können — selbst theoretisch nicht —‚ wie es uns überhaupt möglich war, sie zu übersehen oder nicht anzuerkennen.
In jedem Satz der Liturgie lebt das Bewußtsein von der Wirklichkeit der Werte. Der beständige liturgische Lobpreis würde jeden Sinn verlieren, wollten wir die Existenz der Werte leugnen. Was bedeutet das Wort gloria in dem Satz: „Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam“ - Wir danken dir für deine große Herrlichkeit — wenn es keine andere Bedeutsamkeit gäbe als das subjektiv Befriedigende? Diesen Satz auf ein objektives Gut für die Person beziehen zu wollen, wäre offenbar verkehrt, denn es ist gerade sein charakteristischer Sinn, daß hier — ungleich vielen anderen, wie “fortitudo mea” (meine Stärke) oder “spes mea” (meine Hoffnung) — Gottes eigene, unendliche Güte und Schönheit im Mittelpunkt steht. Aber abgesehen davon, müssen wir uns klarmachen, daß wir den Wertbegriff schon notwendig voraussetzen, sobald wir den Begriff eines hohen objektiven Gutes für die Person einführen. Die unendliche, wesenhafte Güte Gottes ist notwendig mit ausgesagt, sooft die Liturgie von Gott als dem höchsten Gut für uns spricht. Er ist unsere Hoffnung, unser Friede, unsere Freude, weil er die absolute Güte und Heiligkeit ist.
Das hierarchische Prinzip, das so klar im Confiteor und an vielen anderen Stellen zum Ausdruck kommt und sich auch in der Rangordnung der Feste manifestiert, weist unmißverständlich auf den Wert oder das in sich selbst Bedeutsame hin. Es ist ebenso sicher wie offenbar, daß diese Hierarchie zusammenbräche, sobald wir einer vollständig neutralen Welt gegenüberstünden oder einer, für die die Aristippsche “Weltanschauung” zuträfe. Jeder Versuch, diese Hierarchie so zu interpretieren, als beziehe sie sich auf objektive Güter für die Person, ist völlig unmöglich; denn diese setzen, wie gesagt, den Wert schon notwendig voraus. Der Rang eines Heiligen richtet sich nicht nach seiner objektiven Bedeutsamkeit für uns, sondern vielmehr nach seiner Bedeutung in den Augen Gottes.
Der innere Rhythmus der Verherrlichung, der seinen Ausdruck im Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto am Ende jedes Psalmes findet, wendet sich offenbar an Gottes unendliche, wesenhafte, in sich ruhende Güte, Schönheit und Herrlichkeit. Er empfängt seinen tiefsten Sinn als eine Antwort auf das Sein Gottes und alle seine erhabenen Vollkommenheiten. Die Tatsache, daß wir Gott preisen sollen, enthält schon den Begriff des Wertes in sich, so im „dignum et justum est“ der Präfation; entweder bezieht sich das „dignum et justum est“ auf Werte oder diese Worte haben überhaupt keinen Sinn.
Ganz unverkennbar findet sich die in der Liturgie implizierte Gegenwart des Wertbegriffes in jeder Religion wieder. Das Wesen der religio als Bindung an Gott schließt den Begriff des in sich Bedeutsamen ein. So primitiv auch die Gottesidee eines Menschen sein mag, der Wertbegriff ist immer in ihr enthalten. Die Vorstellung totaler physischer Abhängigkeit von einem allmächtigen Wesen würde noch nicht direkt an einen Wert anknüpfen. Aber jedes Bewußtsein, sittlich an Gott gebunden zu sein, ihm Gehorsam und Ehrfurcht zu schulden, setzt eindeutig den Begriff des Wertes in der Gottesidee und in unserem Verhalten zu ihm voraus.
Was wir in vager Form in jeder Religion finden, erstrahlt in einzigartiger Klarheit aus der christlichen Offenbarung. Wenn wir nur an die beiden Hauptgebote Christi: die Gottesliebe und die Nächstenliebe denken, können wir gar nicht anders als sehen, daß solche Liebe die Gegebenheit des Wertes in der unendlichen Güte und Schönheit Gottes voraussetzt, auf die unsere Liebe antwortet. Darüber hinaus schließt die innere Gutheit dieser Liebe unabweislich den Wert ein.
Nichts kann einem Neutralismus, der nur indifferentes Sein anerkennt, das aller Werte und jeder in sich ruhenden Bedeutsamkeit beraubt ist, radikaler entgegengesetzt sein als die christliche Offenbarung. Das “Deus caritas est” ebenso wie die Idee der Glückseligkeit sind das genaue Gegenteil der Abwesenheit der Werte. Die Offenbarung der unendlichen Heiligkeit Gottes in Christus, die Idee der Heiligung, zu der wir selbst berufen sind, der beständige Aufruf zu danken, zu frohlocken, zu lobpreisen und zu lieben, alles das enthüllt klar: die Fülle der Werte ist die wahre, volle Wirklichkeit. Es wird uns gelehrt und wir verstehen: Der innere Gestus des Wertes in seinem Glanz und seiner Gesolltheit ist in Wahrheit das Herz und die Seele des Seins — ganz im Gegensatz zu jedem bloß neutralen Sein und dessen immanenter Logik. Nicht die nackte neutrale Tatsächlichkeit, die aus der innewohnenden Logik des Seienden hervorgehende Unentbehrlichkeit und Notwendigkeit, sondern das innere Feuer der Werte, ihre immerwährende Glorie und Herrlichkeit: dies ist das letzte Wort.
Anmerkungen:
[2] Vergleiche unsere Darlegungen über das Wesen der Objektivität dieser intelligiblen data in den ‚Prolegomena‘.
[3] “Das Psychologische gehört selbst zum ontologischen und metaphysischen Bereich”. (Pius XII. in seiner Ansprache an den 5. Internationalen Kongreß für Psychotherapie und klinische Psychiatrie).
[4] Dieselben Metaphysiker, die gegenüber der personalen Sphäre derart vorsichtig, in die apersonale dagegen so verliebt sind, werden trotzdem zugeben, daß die Person einen höheren ontologischen Rang besitzt als irgendein apersonales Seiendes und daß Gott die absolute Person ist.
[5] Dies steht in keiner Weise im Widerspruch zu der Tatsache, daß es in der menschlichen Person eine Schicht objektiver Realität gibt, die von der bewußt erlebten Sphäre unterschieden werden muß.
[6] Der Terminus „a priori“ muß hier im Sinne einer Erkenntnis von veritates aeternae verstanden werden, und nicht im Sinne Kants. Vgl. ‚Prolegomena‘ S. 13 Anm. 1.
[7] Der hl. Thomas unterscheidet deutlich zwischen dem von einem Wert ausgehenden und dem von dem bloß subjektiv Befriedigenden stammenden delectabile, obwohl er den Begriff Wert nicht gebraucht: „Honesta sunt etiam delectabilia ... dicunter tamen illa proprie delectabilia, quae nullam habent aliam rationem appetibilitatis, nisi delectationem, cum aliquando sint et noxia, et inhonesta ... Honesta vero dicuntur, quae in seipsis habent, unde desiderentur.“ Summa Theologica, I, q. 5, a. 6 ad 2. (,‚Das Edle ist auch angenehm ... Denn im strengen Sinn wird das als angenehm bezeichnet, was aus keinem anderen Grunde begehrenswert ist als einzig wegen der damit verbundenen Lust, so daß diese Dinge zuweilen sogar schädlich und unedel sein können ... Edle Güter aber sind jene Dinge, die in sich selbst haben, was sie begehrenswert macht.“ Die deutsche Thomas-Ausgabe, Bd. 1, S. 110, 112 u. 113, Salzburg 1933).
[8] Vgl. Augustinus, Confessiones, VIII, 11, 27: „Mir erschien die reine Würde der Keuschheit: heiter, doch nicht ausgelassen, lud sie mich ehrenhaft und liebreich ein, zu ihr zu kommen.“
[9] Die neutrale Notwendigkeit, unsere Handlungen um des Erfolges willen der inneren Logik der Dinge anzupassen, mit denen wir es zu tun haben, darf nicht mit der Verpflichtung verwechselt werden, uns selbst der Forderung der Werte zu konformieren. Dieser Unterschied wird später eingehend besprochen werden.
[10] Der Unterschied zwischen dem Absorbiertsein von einer Spekulation und der Hingabe an einen Wert wird offensichtlich nicht durch die Tatsache aufgehoben, daß in beiden Fällen die oben erwähnte Anpassung an die neutrale, immanente Logik eines Seienden vorliegt.
[11] In dem Kapitel ‚Höhere und niedrigere Werte‘ seines großen ethischen Werkes Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, 4. Aufl., Franke Verlag, Bern 1954, S. 115, tritt besonders klar hervor, daß Scheler diese Unterscheidung nicht machte. Er spricht dort ausdrücklich von der „Größe der Werte ‚Angenehm‘, die ein Wesen fühlt“ und stellt sie höher als den Wert “Nützlich“.
[12] Sehr folgerichtig und korrekt gebraucht Aristipp, der ausschließlich das Angenehme als das Nicht-Indifferente anerkennt, niemals die Begriffe „niedrig“ und „hoch“. Als einzige Maßstäbe für das Vorziehen einer Lust vor einer anderen gibt er an: 1. die Intensität, 2. die Dauer, 3. die Frage, ob eine Lust Mißbehagen zur Folge habe oder nicht, 4. ob sie leichter zu erreichen sei als eine andere. Alle diese Gesichtspunkte bleiben vollständig im Bereich des nur Angenehmen. Sie setzen keine andere Art von Bedeutsamkeit voraus.[13] Nik. Ethik 3. Buch, 1110b, 25—35. Vgl. auch meine Schrift: Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, 2. Aufl., Darmstadt 1969.
[14] Der hl. Thomas unterscheidet diese beiden Irrtumsformen deutlich mit den Worten: „Wenn z.B. seine irrende Vernunft einen Mann veranlaßt, mit der Frau eines anderen zu schlafen, ist diese Tat böse, falls sie aus Unkenntnis eines göttlichen Gesetzes geschieht, von dem er wissen müßte; wenn er aber darin irrt, daß er meint, diese Frau sei wirklich seine eigene, sie begehre ihn und er sie, dann ist sein Wille schuldlos“. S. Th. Ia-IIae, q. 19, a. 6 resp.
[15] Wenn auch der Irrtum einer falschen Identifikation begangen wurde, so kommt es immer noch sehr darauf an, welche Realitätsebene geopfert wird: Wenn z. B. jemand die Ungleichartigkeit zwischen apriorischer und empirischer Wahrheit leugnet, bleibt es immer noch von großer Wichtigkeit, ob er jeden kontingenten Sachverhalt für ebenso notwendig und intelligibel wie eine veritas aeterna hält oder ob er erklärt, jede Wahrheit gehöre der empirischen Ordnung an. Zwischen einem extremen Rationalismus und einem radikalen Empirismus ist noch ein großer Unterschied, obwohl beiden gemeinsam ist, daß sie die wesenhafte Ungleichheit dieser beiden Erkenntnisformen übersehen.
[16] Den Unterschied zwischen dem objektiven Übel für die Person und dem Unwert hat der hl. Augustinus in seinen Bekenntnissen V, 12, deutlich gekennzeichnet: “Mein Herz haßte sie, aber nicht mit dem Haß der Vollkommenen (Ps 138, 22). Denn was ich von ihnen leiden sollte, haßte ich vielleicht mehr als das Unrecht, das sie jedem taten... Damals aber sträubte ich mich mehr meinetwillen, die Bösen zu ertragen, als daß ich Deinetwillen wollte, sie würden gut.“
[17] Auch in vielen anderen Fällen finden wir eine so enge Verwandtschaft, daß wir sie nicht mit Identität verwechseln dürfen. Die Tatsache z. B., daß jeder Willensakt Erkenntnis voraussetzt, tilgt nicht die wesenhafte Verschiedenheit beider; und dies gilt in erhöhtem Maß von dem Unterschied zwischen den beiden Bedeutsamkeitstypen. Existenz setzt in jedem kontingenten Seienden die Wesenheit voraus, aber dies hebt keineswegs die Verschiedenheit beider auf. Ebensowenig wird der Unterschied von Akt und Potenz ausgelöscht, weil wir tatsächlich in allen kontingenten Dingen Akt und Potenz vorfinden und weil jede Potenz einen vor ihr bestehenden Akt voraussetzt.
[18] Aristoteles’ Begriff des Guten orientiert sich in ähnlicher Weise an dem objektiven Gut für die Person. Das zeigt sich deutlich in seiner Antwort auf die Frage, welches das höchste Gut sei. Da er die Glückseligkeit für das höchste Gut hält, geht es ihm offensichtlich um den Gesichtspunkt des objektiven Gutes für die Person.
[19] In den ‘Prolegomena’ zeigten wir, dass in der Geschichte oftmals ein datum implicite vorausgesetzt wurde, ohne dass eine philosophische prise de conscience stattfand.
[20] Diese Relation zwischen Wert und objektivem Gut für die Person besteht jedoch nicht in derselben Weise für jeden Typ von objektiven Gütern für die Person. Es gibt viele objektive Güter, in denen der Charakter des objektiven Gutes aus diesem selbst stammt und nicht daher, dass es mit einem Wert ausgestattet ist, wie wir später sehen werden.
[21] In meinem Buch Reinheit und Jungfräulichkeit, 3. Aufl., Einsiedeln 1950, 1. Teil, wurde dieser Terminus eingeführt und erörtert. Vgl. auch meine Metaphysik der Gemeinschaft 2. Aufl., Regensburg 1955.
[22] Platon weist auf die Eigenart der indirekten Bedeutsamkeit hin, wenn er sagt: »Doch kenne ich vieles, was für Menschen nachteilig ist, Speisen, Getränke, Arzneien und anderes mehr in Unzahl, und Dinge, die vorteilhaft sind. Es gibt aber auch Dinge, die für die Menschen weder die eine noch die andere Bedeutung haben.“ Protagoras 334.
[23] In diesem Sinne charakterisiert Kardinal Newman die Nützlichkeit. Er zitiert in The Idea of a University, Disc. V, 4 (Longmans, Greesi & Co., New York, 1902, p. 109), die Worte des Aristoteles: „Nützlich ist das, was Früchte bringt; eines Freien würdig, was dem Genusse dient. Fruchtbringend nenne ich, was Ertrag abwirft; genußreich das, woraus über den Gebrauch hinaus nichts weiter erwächst“ (Rhet. 1, 5).
[24] Selbst die Fiktion einer Welt, in der der einzige objektive Maßstab das objektive Gut für die Person wäre, hielte den Menschen in sich selbst gefangen. Wäre — außer dem subjektiv Befriedigenden — sein einziges Motiv das seines objektiv größten Vorteils, so wäre er von jeder echten Hingabe, von aller Transzendenz abgeschnitten. Aber diese Fiktion ist in sich unmöglich, weil das objektive Gut notwendig das datum des Wertes voraussetzt, wie wir schon sahen und später noch näher sehen werden.
Engelbert Recktenwald: Die Liebe - Wahrheit oder Schein?
Zwischen Heuchelei und Marketing
Dieser Podcast widmet sich zwar keinem spektakulären, aber doch sehr interessanten Thema, das an einem konkreten Beispiel zeigt, wie nützlich die Wertethik sein kann, die Dietrich von Hildebrand gelehrt hat.
Philosophen
Anselm v. C.
Bacon Francis
Bolzano B.
Ebner F.
Geach P. T.
Geyser J.
Husserl E.
Kant Immanuel
Maritain J.
Müller Max
Nagel Thomas
Nida-Rümelin J.
Pieper Josef
Pinckaers S.
Sartre J.-P.
Spaemann R.
Spaemann II
Tugendhat E.
Wust Peter
Autoren
Bordat J.
Deutinger M.
Hildebrand D. v.
Lewis C. S.
Matlary J. H.
Novak M.
Pieper J.
Pfänder Al.
Recktenwald
Scheler M.
Schwarte J.
Seifert J.
Seubert Harald
Spaemann R.
Spieker M.
Swinburne R.
Switalski W.
Wald Berthold
Wust Peter







