zur katholischen Geisteswelt
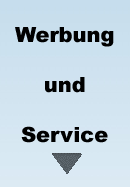
|
Zum
Inhalts- verzeichnis |
|
Zum
biographischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Sie befinden sich im Rezensionsbereich
Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite|
Zum philosophischen Bereich
|
|
Zum
liturgischen Bereich |
Bücher
Allah Mahabba
Atheismus
Benedikt XVI.
Benson R. H.
Chesterton
Chesterton II
Domin Regina
Donner der N.
Eichendorff
Erwachen
Exorzisten
Exzess
Felapton
Feminismus
Freie Liebe
Gamber K.
Gen. Benedikt
Gender
Gewissen
Goldene Stadt
Grabtuch
Hartung T.
Hitler´s Pope
Houghton Bryan
Hymnen a.d.K.
Indianermission
Islam
Jesus
Juden
Keuschheit
Kirchenkampf
Kirchenlehrer
Kuby Gabriele
Lebensschutz
Liguoribücher
Man and Woman
Medienkonsum
Mittelalter
Mord im Vatikan
Opferung
Only you
Pantaleon
Pater Pio
Pinckaers S.
Die Kunst, die Wahrheit auszuloten
In Du selbst bist die Antwort übersetzt C. S. Lewis den Mythos in die konkrete Lebenswelt
Eine Rezension von Anna Diouf
Eine umfassende Rezension zu C.S. Lewis letztem Roman „Du selbst bist die Antwort“ (Till we have faces), die den Umfang des Werkes selbst unterschreitet, ist kaum zu bewerkstelligen. Zu dicht, zu facettenreich, zu weltumspannend – und in diesem Sinne auch wahrhaft „katholisch“ - ist diese Adaption der Geschichte von Amor und Psyche.
Lewis verarbeitet die Vorlage, um in der Tiefe des menschlichen Wesens zu schürfen und den schmerzhaften Weg zu Gottes- und Selbsterkenntnis freizulegen. Dabei verwebt er Mythos und Psychologie, Realismus und Vision derart komplex und kunstvoll, dass dieses Werk den Leser lange begleiten kann und mit jeder Lektüre neue Aspekte offenbart.
Der Roman ist in der Antike angesiedelt, in dem fiktiven Stadtstaat Glome im kleinasiatischen bzw. südosteuropäischen Raum. Ausgangspunkt ist das Vorhaben der dem Tode nahen Königin Orual, die Götter anzuklagen. Zu diesem Zweck ist sie entschlossen, ihr Leben, dessen Unglück sie den Göttern anlastet, aufzuzeichnen. So erfahren wir aus ihrer Perspektive von ihrem Schicksal.
Als ihr Vater nach dem Tod der Mutter erneut heiratet, wird die Halbschwester Psyche für Orual zum Zentrum ihres Lebens und ihrer Zuneigung. Neben Psyche liebt sie ihren Lehrmeister, der „Fuchs“ genannt wird, ein Grieche, der als Sklave am Hof dient und die Königstöchter in die hellenistische Gedankenwelt einführt. Um die Macht im Stadtstaat ringen der König als weltlicher Herrscher und der Priester der Göttin Ungit, einer furchterregenden Fruchtbarkeitsgöttin.
Die wunderschöne Psyche erregt Bewunderung, aber auch Angst und Neid. Auf Drängen des Priesters soll sie als Menschenopfer dargebracht werden, um Unheil vom Volk abzuwenden. Orual macht sich auf die Suche nach Psyches sterblichen Überresten, findet sie aber unverletzt und glücklich: Der Gott, der sie hätte töten sollen, hat sich in sie verliebt und sie in einen unsichtbaren Palast entführt. Orual will das nicht glauben und nötigt Psyche, das strenge Verbot des Gottes zu missachten und ein Licht auf ihn zu richten, um sein wahres Aussehen offenbar zu machen. Psyche gibt nach und muss ihren Geliebten verlassen. Orual bleibt, von Gewissensbissen erfüllt, zurück.
Bald darauf wird sie Königin: Sie herrscht weise, klug und verwegen, verschafft sich in einer Männerwelt Respekt und führt ihr Reich zur Blüte, doch um den Preis ihrer Weiblichkeit: Ihr Gesicht verhüllt sie wegen ihrer erschreckenden Hässlichkeit stets mit einem dichten Schleier, und die Liebe zu einem ihrer Soldaten bleibt unerfüllt. Während einer Reise erblickt sie in einem Nachbarland einen Schrein für Psyche, die als Göttin verehrt wird, und erfährt, wie ihre Geschichte in den Augen anderer gesehen wird: Die Schwester habe aus Eifersucht und Neid Psyches Glück zerstört, so heißt es. Diese in ihren Augen lügnerische Version ihrer Lebensgeschichte bringt das Fass zum Überlaufen und sie beschließt, die Anklage in Form des Buches niederzuschreiben.
Doch noch während sie schreibt, wandelt sich die Anklage zur Lebensbeichte: Orual erkennt, dass ihre Motive nie so rein gewesen waren, wie sie es sich vorgegaukelt hat. In einer großen Vision wird sie vor das Gericht der Götter gestellt: Ihr Schleier fällt, sie wird in ihrem innersten Selbst enthüllt. In dieser Erkenntnis der eigenen Sünde und Schuld wird ihr zugleich das Erbarmen Gottes zuteil und sie erfasst eine Ahnung der wahren Bedeutung des (scheinbaren) Schweigens der Götter. Versöhnt stirbt Orual.
Der Weg zur Selbsterkenntnis führt über das Eingeständnis, dass man sich nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst „verhüllt“, so dass das eigene Handeln in seiner wahren Qualität nicht erkannt werden kann: Als Orual die Schwester überredet und geradezu zwingt, gegen den Willen des Geliebten zu handeln, sagt sie sich, dass sie das aus „Liebe“ tue. Als der „Fuchs“ freigelassen wird und nach Griechenland zurückkehren will, ist es ihre „Liebe“, die ihn festhält, obgleich dies für ihn ein großes Opfer ist. Und „liebend“ nimmt sie den Dienst ihres treuen Soldaten an, der ausgezehrt von seiner Hingabe stirbt. Drei Menschen, die ihr etwas bedeuten, drei Menschen, die sie zerstört. Es ist hart für den Leser, Orual dabei zuzusehen, wie sie ihren Selbstbetrug entlarvt und die angebliche Liebe als Eifersucht, Selbstsucht und Neid identifiziert. Man kommt nicht umhin, zumindest zu ahnen, dass man selbst den Begriff der Liebe oft in ähnlicher Weise pervertiert. Oruals schonungslose Ehrlichkeit ist erschreckend. Man mag sich fragen, ob sie nicht zu streng mit sich ins Gericht geht, aber wir müssen doch einsehen, dass ihre Unbedingtheit angemessen ist angesichts der gleißenden Wahrheit Gottes, und dass sein Gericht kaum weniger schmerzhaft erhellend sein wird.
Auch die letzte Entschuldigung, Orual habe ja nie gewusst, dass die Erzählung ihrer Schwester vom unsichtbaren Palast wahr gewesen sei, bricht in sich zusammen: Sie bekennt, dass sie sehr wohl in ihrem Innersten eine Ahnung der Wahrheit verspürte, diese aber abgelehnt habe. In Orual und Psyche treten uns die ungläubige und die gläubige Seele entgegen: Für Psyche ist die Realität ihrer Gotteserfahrung selbstverständlich, aber sie kann nicht „zugänglich“ gemacht werden: Selbst wenn die göttliche Macht in direkten Kontakt mit uns tritt, bleibt Glaube unter anderem auch immer eine Willensentscheidung, sich dieser Realität zu stellen und zu öffnen – gerade ehemalige Nichtchristen, die sich (wie Lewis selbst) auf dem Weg intellektueller Einsicht bekehrt haben, wissen um diesen Aspekt des Glaubens als Willensfrage, und dass auch die besten Argumente an einem verschlossenen Willen scheitern.
Orual muss, da sie Gott nicht erkennen kann, zuerst sich selbst erkennen. Wie aber mit der Einsicht umgehen? Ist der Mensch auf sich selbst gestellt, bedeutet sie Verzweiflung: Orual erkennt, dass sie nicht nur hässlich ist, sondern auch innerlich so hässlich wie die Göttin, die in Glome angebetet wird. Orual begreift: „Ich bin Ungit.“. Das Leid, das ihr Leben geprägt hat und auf andere Leben übergegangen ist, ist von ihr selbst geschaffen, nicht von einer göttlichen Macht. Konsequent will sie sich selbst richten, doch hier greift Gott ein und verhindert den Selbstmord. So erfährt sie in dem Augenblick größter Verzweiflung das Eingreifen der Götter – nicht unzugänglich, rätselhaft und kalt, sondern in Fürsorge und Mitleid. Von dieser Erfahrung ausgehend erschließt sich nach und nach der zweite Teil der Erkenntnis, die nicht beim Erfassen der eigenen Niedrigkeit stehen bleiben darf, sondern erst im Licht der Transzendenz das ganze Wesen erkennt, auch die uns eigene Schönheit, deren volle Entfaltung unsere eigentliche Berufung ist. Auch hier spielt der Wille ein Rolle: „Ich will nicht Ungit sein“, sagt Orual – das Gespür, trotz der Schuld zum Guten, Wahren und Schönen berufen zu sein, macht den Willen bereit, sich durch den Glauben verwandeln zu lassen.
„Ich bin Ungit“, darin schwingt auch die Ahnung mit, dass die Verdrehung oder besser Verkennung der Liebe auf persönlicher Ebene parallel zu sehen ist zum Götzenkult an sich: Auch dieser verkennt Gott und muss ihn verkennen, weil er die Liebe nicht als innerstes Wesen Gottes zu begreifen vermag. Durch Oruals Bericht hindurch spricht immer wieder das nagende, zur Verzweiflung treibende Misstrauen gegenüber der göttlichen Macht, die sie als missgünstig und unberechenbar wahrnimmt. Hier bietet die Gesellschaft Orual nur zwei Möglichkeiten: Resignierte Unterwerfung oder Abkehr vom Glauben an sich. Der griechische Sklave „Fuchs“ konfrontiert sie mit dem rationalistischen, skeptischen Weltbild eines „aufgeklärten“ Geistes. Sein Name ist Programm; mit Schläue und Wortgewandtheit sucht er physikalische Erklärungen für Wunder, missachtet den Glauben als Einfalt und hält ihn für die Ausgeburt eines unwissenden, feigen Verstandes, kurz, er tut nichts anderes als ein Großteil „moderner“ Theologen. Eine pikante Wendung ist, dass der Fuchs nach dem Tod des Priesters Einfluss auf den neuen Priester ausübt und den archaischen Kult hellenisiert – das uralte Götzenbild wird ersetzt durch ein ansehnliches, freundlicheres, der Schrecken des Göttlichen weicht und es bleibt ein angenehmer, aber farbloser Gottesdienst, der nichts mehr von der existenziellen Dramatik des Kults hat, deshalb aber auch der tiefen Sehnsucht der Menschen nicht mehr gerecht wird. Eine hochaktuelle Schilderung, denn in einer ähnlichen Situation befindet sich vor allem die westliche Kirche: Anstatt, wie im Mittelalter etabliert und gelebt, die Ratio zur Erkenntnis Gottes zu nutzen und auf den Glauben hin zu ordnen, missrät die Synthese zwischen Vernunft und Glaube, wenn sich erstere über den Glauben erhebt und die menschliche Erkenntnisfähigkeit zur Grenze der Erkenntnis erklärt. Dann wird Religion kastriert, sie verkommt zu einem Ausdruck bloß menschlicher Gemeinschaft und kann nicht mehr Gottesbeziehung sein.
Der Opferkult dagegen, so düster und furchteinflößend er ist, ist der Wahrheit zugänglicher als das Denken des Griechen, der sich nur auf die Kraft des eigenen Geistes verlassen will. Denn der Kult nimmt eine übernatürliche Wahrheit als selbstverständlich an. Das Defizit des Heidentums ergibt sich allerdings ebenfalls aus seiner Verhaftung im Menschlichen, nur in anderer Weise. Es entspringt nicht der Offenbarung des Göttlichen; es ist keine Antwort auf Gottes Anruf an uns, sondern das sehnsuchtsvolle, auch verzweifelte Ausstrecken des Menschen nach Gott. Auch das liegt in Oruals Erkenntnis „Ich bin Ungit.“: Der Götze ist Ausdruck des Menschlichen, obgleich zum Göttlichen drängend. So scheint eine Ahnung des Mysteriums auf, sie kann sich aber ohne die Selbstoffenbarung Gottes nicht zur ganzen Wahrheit entfalten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Orual, als sie den emanzipativen Schritt wagt, direkt zu den Göttern zu beten, ohne Tempel und Opfer als Mittler, keine Antwort erhält, aber wahrnimmt, dass die Menschen, die im Tempel anbeten, auf unerklärliche Art „Trost“ empfangen: Einerseits gibt selbst ein Körnchen Transzendenz, belastet mit all dem Ballast menschlichen Irrtums, dem Menschen mehr als das Verharren im Feld der eigenen Wahrnehmung. Andererseits scheint hier die Berufung zur unmittelbaren Gottesbeziehung auf, die aber ohne vorhergehende Erlösung nicht realisierbar ist.
Der das Buch durchziehende Konflikt zwischen Kult und Rationalismus ist also nicht nur Spiegel des modernen Irrtums, Vernunft und Glaube einerseits zu trennen und andererseits den Glauben durch eine entstellte Vernunft zu korrumpieren statt zu stärken. Er macht auch deutlich, wie unermesslich das Geschenk der Selbstoffenbarung Gottes in der Menschwerdung ist: Vielen antiken Werken kann man „ablesen“, wie scharfsinnig die Sinnsuche der Autoren war, wie sie aber doch an eine Grenze stieß, die der Geist nicht niederringen konnte. Es ist erstaunlich, wie bereitwillig der Mensch der Postmoderne dieses Geschenk geringschätzt, vergisst und sich wiederum „heidnischer“ Finsternis ausliefert. Wie dankbar müsste man für die Erleuchtung durch das Christentum sein, für das wahre „enlightenment“, dass wir keine Tauben oder Menschen opfern müssen, um Gottes Wohlwollen zu erringen, dass Gott kein wetterwendischer Despot ist, der stets ein Damoklesschwert über unser Lebensglück hält, bereit, zuzuschlagen, sobald man sich in Sicherheit wähnt.
„Till we have faces“ (Bis wir ein Angesicht haben), heißt der Roman auf Englisch, ein Titel, der die Erkenntnis Oruals aufnimmt, dass Gott erst dann von Angesicht zu Angesicht mit uns reden kann, wenn wir selbst ein Angesicht haben.
Damit ist natürlich gemeint, dass wir nicht mit Gott kommunizieren können, solange wir verhüllt von Sünde und Unwillen vor der Wahrheit die Augen verschließen. Man kann aber – und da Lewis bekennender und ringender Christ war, scheint dies legitim – weitergehen: Für den gläubigen Menschen führt diese Aussage direkt zum Antlitz Christi, zum Menschensohn, zu dem, der ganz Mensch war und der die „Gottesunmittelbarkeit“, die innige Kommunikation zwischen Gott und Mensch für jeden Getauften erschlossen hat: Nicht irgendein Angesicht müssen wir haben, nicht nur unser eigenes, sondern das Angesicht Christi müssen wir vor Gott stellen. In diesem Sinne kann der deutsche Titel recht verstanden werden: „Du selbst bist die Antwort“; die Seele findet in Gott ein „Du“, mehr noch, das Du schlechthin. Mit der vertrauenden Hingabe an dieses Du, der die Liebe und die Wahrheit ist, geht der Mensch in diese Wahrheit ein, was nichts anderes ist, als in die Liebe einzugehen und damit in Gott: Orual ist nicht mehr Ungit, sie ist Psyche – die befreite, gläubige Seele, die nach harter Prüfung in die innige Einheit mit Gott wiederaufgenommen wird.
C.S. Lewis besitzt die Tugend vieler englischer Autoren, Unterhaltungswert und Tiefgründigkeit nicht gegeneinander auszuspielen. Dieser Eigenschaft ist es zu verdanken, dass „Du selbst bist die Antwort“ trotz seiner Wucht und der mannigfaltigen Behandlung einer unübersichtlichen Anzahl existenzieller Fragen den Leser nicht überfordert, sondern ganz nebenbei auch noch schlicht ein „spannendes“ Buch ist.
Besondere Kunstfertigkeit beweist Lewis darin, dass er in atemberaubender Leichtigkeit zwischen dem Realismus einer psychologischen Charakterstudie und der visionären Kraft mythologischer Sprache changiert, ohne dass dies die sprachliche Einheit des Werkes beeinträchtigen würde.
Dem englischen Original ist der Untertitel „A myth retold“ beigefügt, „Nacherzählung eines Mythos“. Dies mag als maßlose Untertreibung anmuten, ist der Mythos von Amor und Psyche doch „nur“ eine Folie für Gedanken, die mit diesem nur noch am Rande zu tun zu haben scheinen. Es ist aber, genauer betrachtet, sehr berechtigt: Wenn der Mythos eine Erzählung ist, die die Wahrheit des Menschseins und des Daseins stereotypisiert auslotet, dann spürt Lewis mit der Übersetzung in die konkrete Lebenswelt eines Individuums diesem eigentlichen Ansinnen des Mythos nach und zeigt, dass er nicht abstrakt ist: Er schlägt sich konkret in unserem Leben nieder, ja, unser Leben atmet selbst „mythische“ Größe.
Und mehr noch: Mit der „Personalisierung“ wird der Mythos folgerichtig „christianisiert“. Der personale Gott und die Beziehung von Angesicht zu Angesicht zu diesem Du als Antwort auf alle Fragen - für eine heidnische Frau der Antike beginnt diese Antwort mit dem Tod: Ihre letzten Sätze richtet Orual nicht mehr an die Götter, sondern an Ihn, den Herrn. Der Christ aber erhält bereits in der Taufe die Antwort, die sich in seinem Leben immer weiter und tiefer entfaltet.
Die Anti-Realitätsbewegung
Ein charakteristisches Merkmal der Anti-Realitätsbewegung ist, dass alles angezweifelt und nichts Gegebenes mehr als Tatsache akzeptiert wird. Selbst das angeborene Geschlecht, das anatomisch und genetisch objektiv vorliegt, wird in Frage gestellt. Und die Lage ist mittlerweile so verquer, dass derjenige, der den ideologischen Vorrang des sozialen Geschlechts vor dem biologischen Geschlecht nicht akzeptiert, sogleich als „rechts“ und „fundamentalistisch“ gilt. Das Ausscheren aus dem betreuten Denken und dem kuratierten Sprechen wird mit Verachtungsvokabular geahndet.
Aus: Gudrun Trausmuth, Das Ende der Aufklärung - der Tod der Tatsachen, in: Libratus vom 4. September 2024.
Vilmos Csernohorszky: Mutig durchs Labyrinth. Über Chestertons Autobiographie
Filme, CD
Bernhard v. Cl.
Intelligent Design
Maria u. ihre Kinder
Metamorphose
Pius XII.
Sophie Scholl
The Mission
Unplanned
Bücher
Posener A.
Qumran
Reformagenda
Ruanda
Ruinen
Sabatina James
Schafott
Sheed Frank
Simonis W.
Sollen
Soteriologie
Spaemann
SP: Leitlinien
Spillmann
Sündenregister
Syrienflüchtlinge
Tapfer und Treu
Tod
Todesengel
Till we have faces
Twilight
Universum
Unsterblichkeit
Vergil
Waal Anton de
Weiße Rose
Wissenschafts-theorie
Wust Peter
Zweigewaltenlehre






