zur katholischen Geisteswelt
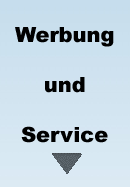
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
biographischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im zweiten Teildes blauen Bereichs des PkG (Buchstaben H bis M)
Zum ersten Teil
Zum dritten Teil
Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum philosophischen Bereich
|
|
Zum
liturgischen Bereich |
Themen
Häresie
Häresien
Heiligkeit
Heilsstrategie
Heimat
Hellenisierung
Herrenbrüder
Herz Jesu
Herz Mariä
Hexenwahn
Himmel
Hinduismus
Hirntod
Hispaniola
Homeschooling
Homoehe
Homosexualität
Humanae Vitae
Humanismus
Humor
HV u. Gewissen
ifp
Indien
Irak
Irland
Islam
Islam und Gewalt
IVF
Jesu Tod
Jesuiten
Jesuitenstaat
Jesus
Jesus II
Jesusbuch
Jesusbuch II
Jesuskind
Joh.-Evangelium
Johannes v. Kreuz
Juden
Jugend
Jugendvigil
Kamerun
Kapharnaum
Kapuzinergruft
Katholikentag
Kath.verfolgung
Kinder Gottes
Kirche I
Kirche II
Kirche III
Kirchenkrise
Kirchenstaat
Kirchenstatistik
Kirchensteuer
Kirchenvolks-begehren
Kirchenzukunft
Kirchweihe
Kirk Charlie
Kirk Erika
Der Analphabetismus der Gefühle und die Kultur der Liebe
Von Livio Melina
In der Audienz für das Institut Johannes Paul II. für Studien über Ehe und Familie am 11. Mai 2006 hat Benedikt XVI. an die grundlegende Idee erinnert, die das Erbe Johannes Pauls II. ist und die diesen in seinem Leben und in seinem Hirtendienst stets begleitete: die Idee, dass man „die Jugendlichen lieben lehren“ muss. Dieser Ausdruck scheint nur schwer verständlich. Was heißt „lieben lehren“? Ist die Liebe etwa nicht das Spontanste, das man sich vorstellen kann? Ist sie nicht etwas, das sich unserer Kontrolle vollkommen entzieht – etwas, das einfach geschieht und über das wir keine Macht haben? Was ist die Liebe, wenn es heißt, dass es notwendig ist, lieben zu lernen? Die Liebe ist keine Idee und auch kein ethischer Entschluss, so sagt Benedikt XVI. in seiner ersten Enzyklika, sondern sie ist vor allem eine Erfahrung, »die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt« (Deus caritas est, Nr. 1). Sie ist nicht nur ein Gebot, sondern eine Antwort auf das Geschenk der Liebe, das uns entgegengebracht wird.
Die Erfahrung der Liebe ist ein Abenteuer, ein Risiko, das man eingehen muss. Sie ist eine Dynamik, die das Leben vorantreibt – hin zu einer neuen, unbekannten Fülle. Wir sollen uns nicht nur an einem Gefühl erfreuen, das wir zufällig für jemanden empfinden, sondern wir sollen lernen zu lieben, also Subjekte zu werden, die wirklich fähig sind zu lieben. Das Abenteuer der Liebe ist kein einfaches. Die Liebe bringt uns aus dem Gleichgewicht, weil sie uns aus unserer Ichbezogenheit herausführt und uns der Realität einer anderen Person gegenüberstellt, die mit ihrer Anwesenheit in unser Leben einbricht, unvorhersehbar und unbekannt, und dennoch so faszinierend in ihrem undurchdringlichen Geheimnis. So erscheint uns die Liebe also als ein Weg, der manchmal schwierig und steil ist, der von uns verlangt, in die neue Dimension des Dialogs mit dem anderen einzutreten, um zusammen eine Lebensgemeinschaft aufzubauen.
Was wäre das Leben ohne Liebe? In seiner ersten Enzyklika Redemptor hominis sagte Johannes Paul II.: »Der Mensch kann nicht ohne Liebe leben. Er bleibt für sich selbst ein unbegreifliches Wesen; sein Leben ist ohne Sinn, wenn ihm nicht die Liebe geoffenbart wird, wenn er nicht der Liebe begegnet, wenn er sie nicht erfährt und sich zu eigen macht, wenn er nicht lebendigen Anteil an ihr erhält« (Nr. 10). Sein Leben ist zum Scheitern verurteilt, wenn er nicht der Liebe begegnet und nicht lernt zu lieben. Der Übergang von der Liebe zur Fähigkeit zu lieben ist schwer, denn zu lieben bedeutet sich hinzugeben, dem anderen keine Dinge, sondern sich selbst zu geben, sich dem anderen hinzugeben. Und das geschieht weder unmittelbar, noch ist es selbstverständlich. Hier klingen die großen Worte der Konzilsväter nach: »Der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur ist, kann sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden« (Gaudium et spes, Nr. 24). Es ist das Paradoxon des Evangeliums: »Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? … Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten« (Lk 9, 24-25).
Der Liebe begegnen und lieben lernen ist vor allem für die jungen Menschen heute besonders schwer. Neue, nie da gewesene Hindernisse stellen sich ihnen in den Weg, und diese müssen klar erkannt werden. Um lieben zu lehren oder zu lernen, muss man sich einer epochalen Herausforderung stellen und eine Kultur wieder aufbauen, ein menschliches Umfeld, das die Person formt und sich einer Gegenkultur widersetzt, die verhindert zu lieben. Meine Überlegungen bestehen aus zwei Schritten: In einem ersten möchte ich die Gegenkultur genauer beleuchten, die die Liebe unmöglich macht. In einem zweiten Schritt werde ich versuchen, die Wege abzustecken, die zum Wiederaufbau einer Kultur der Liebe führen, die nicht nur für jede einzelne Person, sondern auch für die Gesellschaft als Ganze so entscheidend ist.
1. Der Analphabetismus der Gefühle und die Gegenkultur der Autonomie: die Familie „liquidieren“
Vielleicht erinnern sich einige noch an den englischen Butler mit Namen Stevens aus dem Film „Was vom Tage übrig blieb“ (USA 1993) des Regisseurs James Ivory. Der Butler war sehr formal, untadelig und naiv, absolut unfähig, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, vor denen er Angst hatte. In der dramatischen und überzeichneten Handlung bevorzugt der Butler die kalte Steifheit leerer und formaler Beziehungen, an die er sich in seiner Rolle gewöhnt hat. Eine lebendige Beziehung zur Gouvernante hätte ihn aus dem Gleichgewicht geworfen. Zwanzig Jahre später gesteht ihm die Gouvernante ihre Liebe. Stevens ist verlegen und unfähig, das tiefe Gefühl, das er trotz allem in seinem Herzen verspürt, anzunehmen und zum Ausdruck zu bringen. Die Figur erregt Heiterkeit, weil sie dem Klischee des unterkühlten Engländers vergangener Zeiten entspricht und nicht viel mit uns zu tun zu haben scheint. Die Steifheit jener puritanischen Gesellschaft, die ihre Gefühle unterdrückt, scheint in einem radikalen Gegensatz zu stehen zu der Welt, in der wir leben und in der die scheinbare Abwesenheit von Regeln uns die volle Freiheit schenkt, unsere Gefühle zu zeigen und nach eigenem Ermessen in die Tat umzusetzen.
Der Analphabetismus der Gefühle
Dennoch kann sich unter der unkontrollierten und unmittelbaren Zurschaustellung der Gefühle, unter der Gewohnheit, den Emotionen freien Lauf zu lassen, ein Drama verbergen, das dem soeben beschriebenen ähnlich ist. Es ist vor allem unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen weit verbreitet. Man spricht bereits von einem verbreiteten „Analphabetismus der Gefühle“ innerhalb der jungen Generationen. In Southhampton (England) und Umgebung erfolgte kürzlich eine Umfrage in gut 90 Schulen unter Schülern der unteren Mittelschicht, von denen etwa 40 Prozent in Familien mit nur einem Elternteil leben. Diese Jugendlichen kennen im Höchstfall etwa zehn Worte, die mit Gefühl und Affektivität zu tun haben. Die Worte unterscheiden sich kaum voneinander, sind im allgemeinen vulgär und lassen keine Feinheiten zu, wenn es darum geht, den eigenen Gemütszustand zu beschreiben oder den anderer zu verstehen (A. Oliveiro, “Le nostre emozioni alle ricera di un alfabeto”, in Avvenire, 1. März 2001; Ders., “Ragione e passione nelle emozioni”, in Psicologia 130, Juli/August 1995, 52). Dieses Phänomen ist alarmierend. Die Unfähigkeit, mit der Welt der eigenen Gefühle in Kontakt zu treten, verhindert gleichzeitig die Kommunikation mit anderen und den Aufbau echter Beziehungen. Einige aus den Medien bekannte dramatische Vorfälle zeigen, dass in dem Gesellschaftsgefüge, in dem wir leben, der Raum der Gefühle und ihrer Kommunikation bei vielen Jugendlichen immer kleiner wird. Dadurch kommt es zu plötzlichen Gewaltausbrüchen, vor allem dort, wo Massenemotionen gelebt werden.
Dieser Analphabetismus der Gefühle, den Soziologen und Psychologen unterstreichen, ist eine Art Unfähigkeit zu lesen und zu schreiben. Das „Lesen“ und Verstehen eigener Gefühle geschieht nicht. Diese werden verdrängt oder brechen unkontrolliert aus. Das eigene Innenleben wird nicht gedeutet und nicht in einen größeren Sinnzusammenhang gestellt. Die innersten Gefühle kann der Mensch wegen dieses Analphabetismus nicht in den Handlungsverlauf der eigenen Existenz und der Geschichte hinein „schreiben“. Die Gefühle werden also nicht oder nur schlecht zum Ausdruck gebracht, bleiben unverständlich und können nicht umgesetzt werden. Das von Einsamkeit geprägte Umfeld verhindert, die Gefühle zu deuten und den Sinn zu erkennen, der ihnen zugrunde liegt und Orientierung gibt. Lehrer, Erzählungen und gelebte Gemeinschaft fehlen als maßgebliche Bezugspunkte. Ohne Vokabular, ohne Grammatik, ohne Lehrer lernt man nicht lesen und schreiben. Damit ist das entscheidende Problem für die Formung der Person deutlich geworden: Es muss ein Rahmen gefunden werden, der der Deutung des Phänomens der Gefühle dient, ein Sinnzusammenhang, in den die Erfahrung integriert werden kann, um sie verständlich und konstruktiv zu machen.
Die Familie „liquidieren“
An diesem Punkt müssen wir uns mit einer besonderen Schwierigkeit unseres kulturellen Umfeldes auseinandersetzen. Es gibt hier nicht nur eine Krise der Familie und ihrer traditionellen Erzieherrolle, sondern es findet ein Angriff auf die Familie statt, eine wohl organisierte Strategie, sie zu „liquidieren“. Einer Untersuchung des bekannten polnischen Soziologen Zygmunt Bauman zufolge muss dieser Begriff in erster Linie wörtlich aufgefasst werden und erst in zweiter Linie symbolisch. Bauman lehrt in Leeds (England) und ist eine der größten Autoritäten für die Interpretation unserer Zeit. Er definiert unsere Zeit als „flüchtige Moderne“, die gekennzeichnet ist von der Deregulierung und Privatisierung der Aufgaben und Pflichten, die die Modernisierung mit sich bringt. Man kann es als Individualismus bezeichnen: Während die Betonung zunächst auf der gerechten Gesellschaft lag, so liegt sie jetzt auf den Menschenrechten, die jedoch verkürzt werden auf »das Recht des Einzelnen, sich von den anderen zu unterscheiden, und seinen Anspruch, sich für eine eigene Idee des Glücks und einen eigenen Lebensstil zu entscheiden« (Z. Bauman, Flüchtige Moderne, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2003, 40). Die „flüchtige Moderne“ duldet keine festen Körper. Ihre Werte sind Schnelllebigkeit, Veränderung, fließender Wandel, Vergänglichkeit und Instabilität. Daher kann die Moderne die Familie, die Klasse, die Nachbarschaft, die Pfarrgemeinde nicht dulden. Sie müssen „verflüchtigt“ oder „liquidiert“ werden.
Ebenso spricht Bauman von flüchtiger Liebe: Auch die Liebe wird zum Kommerz, zur Handelsbeziehung, zur Supermarktware. In der sich schnell wandelnden Gegenwart ist es „normal“, die Paarbeziehungen den Handelsbeziehungen anzugleichen. Die Liebe und der Partner werden zum Gut, auf das ich ein Recht habe oder das ich wegwerfe, wenn ich genug davon habe und am Horizont ein „Produkt“ sichtbar wird, das mir mehr Befriedigung verspricht. Die Moderne ist beherrscht von Gelüsten, die im Gegensatz stehen zu Wünschen, die gehegt werden, dem Prinzip der Stabilität. Bauman schreibt: “Das Prinzip, die Gelüste zu befriedigen, ist tief in das tägliche Verhalten eingedrillt durch die starke Macht des Konsumgütermarktes. Einen Wunsch zu hegen, gleicht dagegen eher der Liebesverpflichtung – es ist unbequem, unbehaglich, lästig“ (Z. Baumann, Liquid Love, Blackwell Publishers, Malden, MA 2003, 12). Das erklärt die Offensive gegen die auf die Ehe gründende Familie, die sich nicht den Regeln oder besser gesagt der Deregulierung anpasst: Sie muss liquidiert werden.
An diesem unterschwelligen und beharrlichen Angriff haben die Fernsehprogramme und ganz allgemein die Darstellung der Liebe in den Massenmedien Anteil. In Filmen und Talkshows wird die natürliche traditionelle Familie systematisch in ein negatives Licht gerückt, an den Pranger gestellt und ins Lächerliche gezogen. Sie wird als repressiv und lustfeindlich dargestellt. Jede andere Verhaltensweise und Neigung, und sei sie auch noch so absurd und sinnlos, wird dagegen neutral dargestellt, wird „entideologisiert“, also als Normalität verkauft (vgl. U. Folena, I Pacs della discordia. Spunti per un dibattito, Ancora, Mailand 2006, 37-54). Unterschwellig oder offen wird das gelobt und gefördert, was Benedikt XVI. als „schwache Liebe“ bezeichnet hat: eine Liebe ohne dauerhafte Treue und ohne verbindliche Zukunftspläne.
Ob nicht gerade diese schwache Liebe, diese Flüchtigkeit der Liebe das konkrete Sein der Männer und Frauen realistischer zum Ausdruck bringt und glücklicher macht als ein auch institutionell sanktioniertes Treueversprechen? Genau das Gegenteil ist der Fall, und die Belege dazu kommen von Denkern, die alles andere als traditionalistisch oder klerikal eingestellt sind. Der französische Werbefachmann Frédéric Beigbeder, ein Nihilist und Anarchist, schreibt, dass die Unzufriedenheit die wahre Seele des Kommerzes ist: Diejenigen, die uns durch die Kommunikationsmittel Lebensstile aufdrängen, wollen nicht unser Glück, und zwar aus dem einfachen Grund, dass glückliche Menschen nicht konsumieren (F. Beigbeder, Neunundreißigneunzig, Rowohlt, Hamburg 2001, 15). In dem Film Casomai – Trauen wir uns? von Alessandro D’Alatri sagt die Schauspielerin Stefania Rocca: “Manchmal glaube ich, dass es das Unglücklichsein ist, das Wachstum und Gewinn hervorbringt. Zwei Menschen, die sich trennen, geben Anwälten und Richtern Arbeit, verdoppeln Wohnungen und Autos, vervielfachen den Konsum. Wenn ich unglücklich bin, kaufe ich mir ein rotes Kleid. Wer glücklich ist, konsumiert weniger”. Wiederum in England ist eine neue Gesellschaftskategorie entstanden: die Dinks. Dieses Akronym steht für double income no kids: ein Paar mit doppeltem Einkommen und ohne Kinder. “Dinks haben keine Vergangenheit und beanspruchen keine Zukunft. Sie lassen sich treiben in einer ewigen, provisorischen, flüchtigen Gegenwart. Außer kurzfristigen machen sie keine Pläne. Wie sollten sie auch, wenn sie nicht an die Zukunft denken und nicht wissen, ob sie in der Zukunft noch zusammen sein werden? Aus diesem Grunde sind Dinks viel anfälliger für die Verlockungen der Werbung. Auf den Anreiz (‘gib dein Geld so aus!’) folgt bei ihnen unmittelbar die Reaktion” (U. Folena, I Pacs, a.a.O., 53). Während Dinks perfekte Konsumenten sind, sind Eheleute mit Kindern weniger perfekte. Bevor sie das Auto, den Fernseher oder das Handy wechseln, müssen sie nicht nur einmal, sondern zehnmal darüber nachdenken…
Die Gegenkultur der absoluten Autonomie
Diesen Phänomenen wirtschaftlicher, sozialer und moralischer Natur liegt auch eine gut organisierte kulturelle Strategie zugrunde, eine Revolution im wahrsten Sinne des Wortes. Beim Sprachgebrauch angefangen dringt sie in die Mentalität und die rechtlichen Institutionen des Westens ein, um sich dann nach und nach auf globaler Ebene über die ganze Welt zu verbreiten, wie eine Art Neo-Kolonialismus [1]. Das Prinzip der Entscheidungsfreiheit des Individuums im Bereich der Sexualität, der Fortpflanzung und des Lebens wird als etwas Absolutes postuliert, wird zum Faktor des Abbaus der natürlichen und traditionellen Formen der Beziehung in der Familie, in der lokalen Gemeinschaft und in der Gesellschaft.
Im Namen dieses individualistischen Konzepts von Freiheit und Autonomie wird behauptet, dass jede Form der Sexualität gleichberechtigt praktiziert werden kann; man fordert die rechtliche Gleichstellung aller Formen, von den faktischen Lebensgemeinschaften bis hin zur Homosexualität und zur Transsexualität. Verhütung, freie Abtreibung und künstliche Befruchtung werden als Rechte eingefordert, die zur „reproduktiven Gesundheit“ gehören. Das Prinzip der Autonomie wird neben das der Gleichheit gestellt, um eine absolute Neutralität des Staates in der Beurteilung der verschiedenen Formen der menschlichen Sexualität herzustellen. Diese, so heißt es, gehören zur Privatsphäre und das bürgerliche Gesetz habe nur die Aufgabe, die Gleichheit der Rechte zu gewährleisten. Aber eine solche Neutralität des Staates setzt voraus, dass man die Familie nur als eine konventionelle Überstruktur betrachtet, als eine vorübergehende Form unter vielen anderen, von der man sich befreien kann und sogar muss. In Wirklichkeit stehen wir hier vor einem perfekten Beispiel für den Totalitarismus des Relativismus, der nach Kardinal Ratzinger die wahre Freiheit der Personen bedroht und das Überleben der europäischen Zivilisation in Gefahr bringt [2].
Internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen oder die Europäische Union fördern dieses Konzept durch kulturelle oder wirtschaftliche Strategien, indem sie die Unterstützung armer Länder an die Übernahme entsprechender gesetzlicher Maßnahmen binden. Am 18. Januar 2006 hat das Europaparlament eine Resolution mit der Forderung verabschiedet, homosexuelle Verbindungen den Paaren, die aus Mann und Frau bestehen, gleichzustellen. Gleichzeitig werden die Staaten und Nationen, die sich der Anerkennung homosexueller Verbindungen widersetzen, als homophob verurteilt. In den internationalen Konferenzen von Kairo (1994) und Peking (1995) wurden Worte wie Ehemann, gegenseitige Ergänzung, Mutter, Vater, Liebe, Jungfräulichkeit, Familie, Identität, Leiden, Dienst aus dem Vokabular einer neuen Kultur gestrichen. Das Schlussdokument der Pekingkonferenz ist der Frau gewidmet und umfasst gut zweihundert Seiten. Es ist wirklich paradox, dass es gelungen ist, darin das Wort „Mutter“ ganz zu vermeiden. Ein veränderter Sprachgebrauch, der sich einschleicht oder offen auferlegt wird, ist ein Mittel der kulturellen Manipulation, das große Auswirkungen besitzt. Die „Genderideologie“ wird aufgezwungen, der zufolge die männliche bzw. weibliche sexuelle Identität, die anatomisch festgelegt ist, nur eine Konvention sei, ein kulturelles Konstrukt der Gesellschaft, das die Freiheit des Individuums einschränkt, sich seinen Neigungen entsprechend zu definieren und auch offen zu bleiben gegenüber anderen und späteren Qualifizierungen [3]. Der autonome Wahlakt des Individuums verleugnet die Realität, das Faktum der Schöpfung, und damit den Schenkenden: Gott, den Schöpfer. Wir sehen uns dem Versuch gegenübergestellt, das Konzept der menschlichen Person radikal zu verändern, das dreifaltige und theologische Bild des Menschen als Vater-Mutter, Sohn-Tochter, Ehemann-Ehefrau, Bruder-Schwester zu zerstören. Man schlägt eine universale Solidarität vor, ohne die transzendente Quelle der Brüderlichkeit, den Vater, anzuerkennen und ohne die Einzigartigkeit der Person zu achten. In Wirklichkeit ist dies nicht nur eine Rückkehr zur vorchristlichen Zivilisation, sondern eine Ablehnung des natürlichen Empfindens, das in den verschiedenen Kulturen und religiösen Zivilisationen der Menschheit vorhanden ist.
2. Für eine Kultur der Liebe
Prof. Joseph Raz, der an der Universität Oxford Ethik lehrt, schreibt: “Wenn wir zugeben, dass die Monogamie die einzig gültige Form der Ehe ist, dann kann sie nicht individuell praktiziert werden. Sie bedarf einer Kultur, die sie durch den öffentlichen Sektor und die Institutionen anerkennt und unterstützt” (Joseph Raz, The Morality of Freedom, Clarendon Press, Oxford 1986, 162). Die monogame, treue und unauflösliche Ehe kann auch in einem Umfeld gelebt werden, das der Ehe negativ gegenübersteht – wie dem soeben beschriebenen. Aber die Ehe ist in sich eine schwache Institution, wenn sie nicht von der sie umgebenden Kultur und den entsprechenden Institutionen getragen wird. In genau diesem Sinne hat uns Johannes Paul II. in seiner letzten Ansprache an unser Institut aufgefordert, auf akademischer Ebene eine „Kultur der Familie“ zu fördern (JPII., Ansprache an die Dozenten und Studenten des Päpstlichen Instituts Johannes Pauls II. für Studien über Ehe und Familie, 31. Mai 2001).
Die Kultur, sagte Papst Johannes Paul II. im Jahre 1980 in seiner berühmten Ansprache an die Unesco, “ist das, wodurch der Mensch mehr Mensch wird, mehr ‘ist’, dem ‘Sein’ näherkommt” (JPII, Ansprache an den Exekutivrat der Unesco, Paris, 2.Juni 1980, 7: AAS 72, 1980, 728). Die Wahrheit einer Kultur muss also verifizierbar sein in einem Mehr an Licht, an Freude, an Leben und an Liebe, das sie durch die menschliche Erfahrung der Affektivität ermöglicht. Hier liegt die große Herausforderung, auf die Benedikt XVI. seit dem Beginn seines Pontifikats unermüdlich hingewiesen hat und die vor allem in seiner Enzyklika Deus caritas est zum Ausdruck gekommen ist: Das Christentum ist weit davon entfernt, den Eros zu vergiften und dem Schönsten auf der Welt Bitterkeit zu verleihen, sondern es ist seine Heilung zu seiner wirklichen Größe hin (Nr. 5). Nun liegt noch der zweite Teil unserer Überlegungen vor uns: Wo finden sich die Elemente zum Aufbau dieser wahren Kultur und was sind ihre wichtigsten Merkmale? Für das Gemeinwohl einer Gesellschaft ist ein wahres Konzept von Liebe und Familie notwendig, das ihrer natürlichen Form entspricht, die auch durch die Vernunft erfassbar ist.
Zum Herzen zurückkehren, um die Vernunft wieder zu finden
Ob die Kultur, die wir uns erhoffen, möglich und legitim ist, entscheidet sich an folgender Frage: Gibt es wirklich eine Form der Liebe und der Familie, die in ihrem innersten Kern in der Natur des Menschen verwurzelt ist und die deshalb durch die Gesellschaft und ihre Gesetze gefördert werden muss? Oder sind Ehe und Familie nur kulturelle Gegebenheiten, die dem Wandel unterworfen sind und in verschiedenen Geschichtsepochen verändert werden können, ja sogar verändert werden müssen?
Auf diese Frage gibt der Glaube mit Verweis auf die in der Heiligen Schrift enthaltene Offenbarung eine klare Antwort. Mit der Autorität Petri hat Benedikt XVI. kürzlich noch einmal die Überzeugung der Kirche bekräftigt, dass “Ehe und Familie im innersten Kern der Wahrheit über den Menschen und seine Bestimmung verwurzelt sind” (Ansprache an die Dozenten und Studenten des Päpstlichen Institutes “Johannes Paul II.” für Studien über Ehe und Familie, 11. Mai 2006). Jesus, die Fülle der Offenbarung, hat in seiner Antwort auf die Frage der Pharisäer nach der Ehescheidung auf eine ursprüngliche Wahrheit verwiesen, die im „Anfang“ verwurzelt ist, in der Schöpfung, und die der Mensch kein Recht hat zu manipulieren: “Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat: Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen” (Mt 19,4-6). Die Kirche hat durch die Jahrhunderte hindurch aus dieser Lehre Jesu das Licht geschöpft, das es erlaubt, Sexualität und Affektivität richtig zu deuten, in der Ehe ein besonderes Zeichen des Bundes Gottes zu erkennen und so eine Kultur zu schaffen, die auf Ehe und Familie gründet. Die Antwort des Glaubens wurde von den Gläubigen als klar und gewiss angenommen und durch das Zeugnis der christlichen Gemeinschaft und der Heiligen über Jahrhunderte hinweg gefestigt. Heute wird sie jedoch radikal in Frage gestellt. Um einen öffentlichen Dialog zu führen, müssen wir zeigen, dass die natürliche und traditionelle Sicht der Familie für den Menschen große Bedeutung besitzt und ein Teil von ihm ist. Wir suchen ein Licht, das auch diejenigen annehmen, die nicht glauben, ein Licht, das auch der menschlichen Vernunft allein Orientierung schenken kann. Die Vernunft scheint auf Irrwege geraten zu sein und findet nicht mehr zu den Prinzipien zurück, die es ihr ermöglichen, den Weg der Moral zu lenken und eine gerechte Gesellschaft aufzubauen [4].
Wo soll man beginnen, nach dem unfehlbaren Kriterium zur Unterscheidung zwischen einem wahren und guten Leben und einer falschen Lebensgestaltung zu suchen, wenn nicht bei der Erfahrung in ihrer natürlichsten und ursprünglichsten Form, dem Zeugnis des „Herzens“? Die Kriterien für die Wahrheit und das Gute müssen in uns selbst liegen, sonst sind wir entfremdet. Was ist also das Herz? Es ist das Zusammenspiel der ursprünglichen und grundlegenden Bedürfnisse und Gegebenheiten, mit denen die Natur uns in die Realität entlässt und von denen ausgehend jeder Mensch – ganz gleich, ob er es will oder nicht, ob es ihm bewusst ist oder nicht – alles, was ihm widerfährt, spontan beurteilt (vgl. L. Giussani, Das Wagnis der Erziehung: Zur religiösen Erfahrung. EOS, St. Ottilien 1996): die Bedürfnisse und Gegebenheiten der Gerechtigkeit, der Wahrheit, des Guten und der Schönheit. Die thomistische Tradition spricht von „natürlichen Neigungen“, einem angeborenen Streben nach bestimmten Gütern, von denen wir erkennen, dass sie uns entsprechen: der Lebenserhaltungstrieb, der Gemeinschaftstrieb, der Trieb, die Wahrheit zu suchen, Mitleid zu empfinden und den Leidenden zu helfen. Zu diesen natürlichen Neigungen gehört auch und besonders der Geschlechtstrieb. Benedikt XVI. sagt deutlich: Unter den vielen verschiedenen Arten von Beziehungen, die es gibt, “erscheint aber doch die Liebe zwischen Mann und Frau, in der Leib und Seele untrennbar zusammenspielen und dem Menschen eine Verheißung des Glücks aufgeht, die unwiderstehlich scheint, als der Urtypus von Liebe schlechthin, neben dem auf den ersten Blick alle anderen Arten von Liebe verblassen” (Deus caritas est, Nr. 2).
Was aber ist der volle menschliche Sinn dieser natürlichen Neigung? Um zu einer gelungenen Lebensgestaltung beizutragen, muss sie in einen allgemeinen Sinnzusammenhang hineingestellt werden, der ihr eine Bedeutung gibt und der sich im Leben jedes einzelnen Menschen nach und nach abzeichnet – entsprechend den Erfahrungen, die der Reifeprozess der Person mit sich bringt (vgl. J. Noriega, Il destino dell’eros. Prospettive di morale sessuale. Dehoniane, Bologna 2006, 19-39). Der menschliche Verstand begreift, dass der volle Sinn der geschlechtlichen Anziehung nur dann geachtet wird, wenn man den anderen als Person behandelt und nicht nur als Gelegenheit, die eigene Lust auszuleben. Das „Herz“ ist der Ursprung jenes undefinierbaren Unbehagens, das den Menschen überkommt, wenn er zum Beispiel als reines Lustobjekt benutzt wird (vgl. L. Giussani, Der religiöse Sinn, Bonifatius, Paderborn 2003). Das Herz sagt, dass die richtige Haltung gegenüber dem anderen die Liebe ist und dass die geschlechtliche Anziehung in sie hineingestellt und in ihr gelebt werden muss. So kann man zwischen einer guten und angemessenen Umsetzung der Sexualität und einer schlechten und falschen Einstellung zu ihr unterscheiden. Der hl. Thomas spricht von Samenkörnern der Tugend, die in unsere Triebe eingeschlossen sind: Die Vernunft kann sie sehen und pflegen, und wenn sie sich mit der Zeit durch das entsprechende Handeln entfaltet haben, bringen sie die sittlichen Tugenden hervor. Eine Kultur der Liebe muss im Mann und in der Frau jene tugendhaften Veranlagungen pflegen, die einen vollkommen menschlichen Sinn der Sexualität und der Affektivität entwickeln.
Durch unsere Vernunft und ihre Fähigkeit, die diesbezüglichen Erfahrungen im Licht des „Herzens“ zu deuten, können wir also verstehen, was die Sexualität und was die Familie ist. In Bezug auf den Sexualtrieb offenbart uns die Vernunft, die unsere Erfahrungen interpretiert, dass die geschlechtliche Differenz, die in den männlichen und in den weiblichen Leib eingeschrieben ist, der unüberwindliche Faktor ist, der die Begegnung und die Selbsthingabe ermöglicht (Vgl. A. Scola, Uomo-donna. Il “caso serio” dell’amore, Marietti 1820, Genua-Mailand 2002, 15-28). Sie richtet uns auf die Selbsthingabe aus, die eine ihr eigene innere Logik besitzt. Sie verlangt Ganzheit und Endgültigkeit und muss in ihrer Fruchtbarkeit geachtet werden. Dietrich von Hildebrand schreibt: “Die sinnliche Sphäre ist ihrem Sinn nach ein besonderes Ausdrucks- und Erfüllungsfeld der ehelichen Liebe. Sie allein ist daher imstande, diese Sphäre organisch mit der des Herzens und des Geistes zu verbinden. Einzig die eheliche Liebe besitzt gleichsam den Schlüssel, den erlebnismäßigen Sinn dieser Sphäre zu aktualisieren und ihr wahres positives Gesicht der Person sichtbar zu machen” (D. von Hildebrand, Reinheit und Jungfräulichkeit, Eos, St. Ottilien 1981, 98-99). Die vernunftgemäße Form der Umsetzung der Sexualität, die der Realität des Sexualtriebs in all seinen Dimensionen entspricht, ist daher die Ehe, verstanden als rechtmäßiger Bund zwischen einem Mann und einer Frau.
Darüber hinaus steht die Fähigkeit zur Zeugung neuer Personen, die der Geschlechtlichkeit zwischen Mann und Frau von Natur aus innewohnt, nicht außerhalb dieses Sinnzusammenhangs. Im Gegenteil: Sie bestätigt und untermauert ihn sogar. Einerseits zeigt sich die menschliche Geschlechtlichkeit nur dann in ihrer ganzen Wahrheit, wenn sie offen bleibt gegenüber der Dimension, die die ursprüngliche Beziehung zwischen den beiden Ehepartnern übersteigt, wie Maurice Blondel in Bezug auf die seltsame Mathematik der Liebe sagte: “Zwei Wesen sind nur mehr eines, und sind sie eins geworden, werden sie drei”. Die Geschlechtlichkeit entspricht den Anforderungen der wahren Liebe nur dann, wenn sie die Öffnung zur Weitergabe des Lebens nicht vorsätzlich ausschließt. Wenn sie sich als Luststreben in sich selbst zurückzieht, wird sie auch als menschliche Erfahrung unfruchtbar.
Andererseits ist das Kind – die Frucht der Hingabe – keine Sache, sondern eine Person. Es wird nur dann rechtmäßig gewollt, ins Leben gerufen und angenommen, wenn es nicht als “Produkt” behandelt wird und das gewisse Ansprüche erfüllen muss, sondern wenn es als einzigartige und unwiederholbare Person erkannt wird, die in sich selbst wertvoll ist und Achtung verdient, weil sie “jemand” und nicht “etwas” ist. So wird verständlich, warum nur der eheliche Akt der angemessene Ort ist, um einer Person das Leben zu schenken. Ebenso ist nur die rechtmäßig gegründete Familie eines Mannes und einer Frau das Umfeld, in dem die Person auf angemessene Weise erzogen werden kann.
Universalität der Erfahrung der Liebe
So haben wir kurz die Wahrheiten dargelegt, die von Natur aus in die Herzen der Männer und Frauen eingeschrieben sind und die die Vernunft begreifen kann. All dies ist nicht nur Ausdruck einer katholischen Sicht der Moral, die nur für die Gläubigen Gültigkeit besitzt, sondern sie kann auch von denen vertreten werden, die nicht glauben oder die einen anderen Glauben haben. Wir stehen hier der Universalität der Erfahrung der Liebe gegenüber, die einen Weg öffnet zum Dialog und zur Begegnung zwischen den Menschen, der den Weg der rein rationalen Universalität Kants übersteigt (Vgl. J.-J. Pérez-Soba, “Una nuova apologetica: la testimonianza dell’amore”, in Anthropotes XXII/I (2006). Die Erfahrung der Liebe, besonders in ihrer Urform der Liebe zwischen Mann und Frau, zeigt sich als universaler Weg zum Verständnis des Menschlichen. Keinem Menschen ist die Erfahrung der Liebe fremd, ganz gleich welcher Kultur, Rasse oder Religion er angehört, woher er kommt oder wie alt er ist: Sie geht alle an und ist gewissermaßen jedem Menschen und jeder Epoche zu eigen.
Um diese Universalität wirklich zu erfassen, muss die Deutung überwunden werden, die der Emotivismus und der Romantizismus von der Liebe geben, die diese nur dem subjektiven Empfinden zuordnen. Die universale Dimension der Liebe, deren höchste Form die vom Evangelium gebotene Feindesliebe ist, liegt nicht in einem psychologischen Prinzip begründet, sondern im Verweis auf eine ursprüngliche Liebe, die uns vorausgeht, die Liebe des Vaters: “Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte« (Mt 5,44f; siehe dazu: W. Pannenberg, Grundlagen der Ethik. Philosophisch-theologische Perspektiven, Vandenhoek&Ruprecht, Göttingen 1996, 80-88). Es gibt einen universalen Wunsch, glücklich zu sein, der alle Menschen verbindet, weil alle den Wunsch haben zu lieben, auch wenn nicht alle mit universaler Öffnung zu lieben wissen. Gleichermaßen gibt es eine auf dem Guten gründende Kommunikation der Liebe, die eine Universalität besitzt, die der des Glücklichseins ähnlich ist. Sie liegt in der universalen Kommunikation des Guten begründet, an der wir alle durch die Schöpfung teilhaben (vgl. L.B. Gillon, “Può la carità essere un’amicizia universale per tutti gli uomini?”, in Sacra Doctrina 23, 1978, 81-94).
Darüber hinaus ist die Dynamik der Liebe ihrem Wesen nach dem Glauben gegenüber offen: Sie bringt dem anderen stets persönliches Vertrauen entgegen und öffnet sich ihm und der Verheißung des Guten, die uns in der Begegnung und im gegenseitigen Austausch erreicht. Wie Benedikt XVI. in seiner ersten Enzyklika in Erinnerung gerufen hat, bedeutet zu lieben stets auch, der Liebe zu glauben (Deus caritas est, Nr. 1). Nach der inneren Logik der Liebe zu handeln bedeutet, sich dem anderen vertrauensvoll zu öffnen und sich so gleichzeitig dem geheimnisvollen Sein der menschlichen Existenz gegenüber zu öffnen. Der Begriff „geheimnisvoll“ zeigt hier nicht das Unbekannte an, sondern vielmehr die Öffnung gegenüber dem Urheber des Lebens und des Guten. Die Erfahrung der Liebe schließt diese Öffnung mit ein [5]. So lässt uns gerade die Erfahrung der Liebe, wenn sie in ihrer ganzen Wahrheit erfasst wird, die Trennung zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen überwinden, zwischen dem, was christlich und dem, was rein menschlich ist. Die Liebe ist nämlich eine universale und ursprüngliche menschliche Erfahrung, die in der Lage ist, die grundlegende Wahrheit über den Menschen zu offenbaren. Das Christentum wiederum ist anthropologisch bedeutsam, weil es ein Licht schenkt, das den letzten Sinn offenbart. Wir müssen jedoch erkennen, dass man nicht selbstverständlich und nicht ohne Schwierigkeiten zur Wahrheit der Liebe gelangt: Es bedarf dazu des erzieherischen Kontexts einer Gemeinschaft und kompetenter, glaubwürdiger Zeugen, es bedarf eines klaren Blicks, und diese Dinge findet man heute nicht oft. Selbst die Idee, dass es eine „natürliche“ Form gibt, die Sexualität zu leben, wird in weiten Kreisen in Frage gestellt. Der heutige Mensch erkennt seine eigene ursprüngliche Natur nicht mehr. Wir müssen also unsere Überlegungen geduldig wieder aufnehmen und bei einer Problematik sozialen Charakters ansetzen, mit Hilfe einer Argumentation, die die elementarsten Ansprüche des Gemeinwohls in Betracht zieht.
Familie und Gemeinwohl
Warum soll das bürgerliche Gesetz einer „laikalen“ und pluralistischen Gesellschaft, wie unsere westlichen Gesellschaften es sind, die Ehe zwischen Mann und Frau als privilegierte Form der Umsetzung der menschlichen Sexualität und als Grundlage zum Aufbau der Familie fördern? Unsere Gedankengänge werden jetzt nicht mehr auf der der Erfahrung innewohnenden Rationalität basieren, sondern auf dem Wesen der Gesellschaft und dem Gemeinwohl, das diese rechtfertigt.
Welche Bedeutung hat die Idee eines „Gemeinwohls“ als Grundlage der Gesellschaft? [6] Den sozialen Beziehungen zwischen den Menschen wohnt ein Gut inne, das wesentlich ist für das persönliche Leben und das daher geschützt und gefördert werden muss. Nur in der gelebten Beziehung zum anderen und zu den anderen wird das Umfeld geschaffen, in dem jeder in der eigenen Menschlichkeit wachsen kann. Das steht der Auffassung des Individualismus entgegen, der den Menschen als isoliertes Einzelwesen und die Beziehung zu den anderen Personen als etwas rein Äußerliches und nicht Ursprüngliches betrachtet. Die andere Person ist aber nicht nur eine Grenze, die meinen Rechten gesetzt wird. Sie ist der Gesprächspartner, durch den ich mir meiner selbst bewusst werden und meine Persönlichkeit entfalten kann. Das Gemeinwohl ist also »die Gesamtheit jener Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, die sowohl den Gruppen als auch deren einzelnen Gliedern ein volleres und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung ermöglichen« (Zweites Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution Gaudium et spes, Nr. 26). Eine Gesellschaft, die nur auf der individualistischen Idee der Rechte des Individuums aufgebaut wäre, ohne die höhere Ebene des Gemeinwohls zu berücksichtigen, würde am Ende auch das Wohl der Person verneinen.
Die auf der dauerhaften Ehe eines Mannes und einer Frau gründende Familie ist ein wesentliches und entscheidendes Element für das Gemeinwohl der Gesellschaft. Viele Verfassungen unserer Staaten erkennen die Familie ausdrücklich als erste, natürliche Keimzelle der Gesellschaft, als Grundlage des bürgerlichen Lebens an. Diese uralte und stets gültige Überzeugung wird bestätigt durch eine kürzlich erschienene soziologische Studie, die das Konzept des „sozialen Kapitals“ untersucht hat [7]. Dieses bezeichnet das kulturelle Erbe und den Bestand, der die Beziehungen des Vertrauens, der Zusammenarbeit und der Wechselseitigkeit zwischen den Personen trägt. Eine Gesellschaft muss die Werte des gegenseitigen Vertrauens, der Loyalität und der Solidarität aus den Grundbeziehungen innerhalb der Familie schöpfen, um nicht unmenschlich zu werden und sich auf fatale Weise selbst zu zerstören. Sie ist das erstrangige soziale Kapital, und auf ihr gründet das zweitrangige: die Beziehungsnetze und Zusammenschlüsse im bürgerlichen Bereich. Das soziale Kapital ist also ein Beziehungsgut, das alle zusammen produzieren und nutzen und ohne das die Gesellschaft zugrunde geht.
Der Gedankengang ist einfach: Die Gesellschaft hat für ihre eigene Existenz ein vitales Interesse an der Förderung der Einrichtung, die für das Entstehen des sozialen Kapitals maßgeblich ist: die monogame und dauerhafte Ehe, die auf der fruchtbaren Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau gründet. Die anerkannte geschlechtliche Differenz ist die Urform der Annahme des anderen in seiner Identität und seinem Anderssein, die die Grundlage der Wechselseitigkeit ist. Nur in einer dauerhaften Verbindung kann die positive Funktion für die betreffenden Personen ausgeübt werden und ist eine Erziehung möglich. Nur durch die Geburt und Erziehung von Kindern gewährleistet die Gesellschaft die eigene Zukunft. Nur durch die Unterstützung der schwachen und alten Menschen, die von der Familie gewährleistet wird, ist die Gesellschaft in der Lage, eine angemessene Antwort zu geben auf immer stärker vorhandene soziale Bedürfnisse.
Natürlich bringt nicht jede Form des Zusammenlebens dieses erstrangige soziale Kapital hervor. Es liegt nicht im Interesse der Gesellschaft, Lebensgemeinschaften zu fördern, in denen die Partner nicht die Pflicht zur gegenseitigen Unterstützung, zur Treue und zum dauerhaften Zusammenleben in der vom öffentlichen Recht vorgegebenen Form übernehmen wollen. Die Gleichstellung mit der Ehe von Formen des Zusammenlebens, die einerseits die dem Ehebund entspringenden Rechte fordern, andererseits aber die entsprechenden Pflichten ausschließen, würde sogar unvermeidlich zur Schwächung der Institution der Familie führen, die die Gesellschaft trägt [8]. Das bürgerliche Recht hat nämlich Erziehungscharakter. Nach dem englischen Kriminologen Nigel Walker werden die Gesetze einer Generation leicht zur Sitte der nächsten Generation [9]. Die Privatisierung der Liebe und die ausschließliche Berücksichtigung der Rechte des Individuums führen zu einer raschen Aufzehrung des notwendigen Kapitals, das für das Leben einer Gesellschaft unverzichtbar ist.
Noch mehr wäre zu sagen im Hinblick auf die schwächsten Glieder der Gesellschaft, die zu schützen das Gesetz besonders verpflichtet ist. In diesem Fall sind es die Kinder. Durch die adoptionsrechtliche Gleichstellung nicht dauerhafter oder homosexueller Lebensgemeinschaften, in denen die gegenseitige Ergänzung der Vater- und der Mutterfigur fehlt, wird den Minderjährigen das Recht abgesprochen, in einem angemessenen familiären Umfeld, wie es die natürliche Familie ist, geboren zu werden und aufzuwachsen – ohne dass man weiß, welche psychischen Folgen es für die Heranwachsenden haben wird. Da auf diese Weise Menschen dem Leben in einem Umfeld ausgesetzt werden, das für ihre psychische Entwicklung und ihr Wachstum ungeeignet ist, wird damit auch das Prinzip der Gleichheit der Personen verletzt. Daher müssen die Gesetze, die diese Formen des Zusammenlebens mit der Ehe gleichstellen, als ungerecht eingestuft werden.
3. Schluss
»Die Zukunft der Menschheit geht über die Familie!«: Jetzt können wir ermessen, welch wahrhaft prophetischen Charakter diese Aussage hat, die Johannes Paul II. vor mehr als 25 Jahren im Apostolischen Schreiben Familiaris consortio machte (Familiarsi consortio, Nr. 86). Wird die Familie zerstört, verschwindet der Bereich der Kultur, in dem der Mensch sich selbst finden und in seiner wahren Menschlichkeit wachsen kann, in seiner Fähigkeit, bis zur Selbsthingabe lieben zu lernen. Eine Gesellschaft, die die Familie zerstört, ist eine zum Selbstmord verurteilte Gesellschaft. Wir stehen bereits der Möglichkeit einer solchen Zerstörung gegenüber. Daher ist die Herausforderung für uns heute dramatisch und dringend. Eine Antwort muss auf anthropologischer, ethischer, rechtlicher und erzieherischer Ebene gegeben werden. Sie muss vor allem bewusst und organisch auf den Aufbau einer wahren „Kultur der Familie“ abzielen.
Vor kurzem sagte Benedikt XVI. zu uns: »Die Lebens- und Liebesgemeinschaft, die die Ehe ist, erweist sich somit als ein wahres Gut für die Gesellschaft. Heute ist es besonders dringlich, zu vermeiden, dass die Ehe mit anderen Verbindungsformen verwechselt wird, die auf einer schwachen Liebe gründen. Nur der Fels der totalen und unwiderruflichen Liebe zwischen Mann und Frau ist imstande, die Grundlage für den Aufbau einer Gesellschaft zu sein, die für alle Menschen ein Zuhause wird« [10]. Die Aufgabe, die vor uns liegt, hat Johannes Paul II. aufgezeigt. Wir müssen „lieben lehren“, damit die Person und die Gesellschaft auf dem festen Fels der wahren Liebe gründen und die Familien Wohnstätten sein können, in denen der Mensch seiner ursprünglichen Berufung entsprechend gefördert wird.
Anmerkungen:
[1] Siehe dazu: M. A. Peeters, The Specifity of Christian Kerygma in the Face of the New Global Ethic, Kampala 2005; E. Roccella - L. Scaraffia, Contro il cristianismo. L’onu e l’Unione Europea come nuova ideologia, Piemme, Casale Monferrato 2005.
[2] Vgl. J. Ratzinger, L’Europa nella crisi delle culture, Conferenza per la consegna del Premio San Benedetto, Subiaco 1. April 2005; dt. in Marcello Pera / Joseph Ratzinger, Ohne Wurzeln. Der Relativismus und die Krise der europäischen Kultur, Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2005.
[3] Vgl. J. Butler, Das Unbehagen der Geschlechter (Gender Studies. Vom Untergang der Geschlechter),Suhrkamp, Frankfurt a.M. 51995. Für eine kritische Beurteilung: J. Burggraf, Genere (“Gender”), in Päpstlicher Rat für die Familie, Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, Dehoniane, Bologna, 2003, 421-429.
[4] Ich greife hier die Gedankengänge auf, die Carlo Kardinal Caffarra darlegte in dem Vortrag “Che cos’è la famiglia” (S. Pietro in Casale, 30. Mai 2006).
[5] Vgl. A Scola, “Esperienze nella preparazione degli Instituti per la famiglia”, Manuskript, in Congresso Internacional Teológico Pastoral “La transmisión de la fe en la familia”, Valencia 4-7 de julio 2006.
[6] Vgl. Päpstlichen Rat für Gerechtigkeit und Frieden, Kompendium der Soziallehre der Kirche, Herder, Freiburg i. Br. 2006, Nr. 164-170.
[7] Siehe insbesondere: P. Donati, “La famiglia come capitale sociale primario”, in: P. Donate (Hg.), Famiglia e capitale sociale nella società italiana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2003, 31-101, mit reichhaltiger Bibliographie.
[8] Vgl. V. Marano, Le unioni di fatto, Esperienza giuridica secolare e insegnamento della Chiesa, Giuffré, Mailand 2005; M. Bovini Baraldi, Le nuove convivenze. Tra discipline straniere e diritto interno, Ipsoa, Mailand 2005.
[9] Die moderne Strafrechtslehre erkennt ausdrücklich und thematisch den Wert des Gesetzes als Modell für die Herausbildung der sittlichen Orientierung des Bürgers an. Vgl. J. Andenaes, La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell’irrogazione e dell’esecuzione della pena, in: M Romano - F. Stella (Hg.), Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, Il Mulino, Bologna 1980, 33ff. Hier findet sich das Zitat von Nigel Walker.
[10] Benedikt XVI., Ansprache anlässlich des 25jährigen Bestehens des Päpstlichen Instituts “Johannes Pauls II.” für Studien über Ehe und Familie, 11. Mai 2006 (in Italienisch).
Es handelt sich bei diesem Text um das vierte Kapitel des hervorragenden Buches Livio Melina, Für eine Kultur der Familie: Die Sprache der Liebe; Altötting: Grignion Verlag 2015.
Themen
KloneKNA
Kommunioneinheit
Kondome
Konf.verbind. Ehen
Konklave v. KN
Konstruktivismus
Konversion
Konzil
Konzilsgeist
Konzilsstreit
Kopfstand
Korea
Kranke
Kreuz
kreuznet
Kreuzzüge
Kritik
Kruzifixurteil
Küng Hans
Le Fort
Lebensschutz
Lebensspiritualität
Lehramt
Lérins V. von
Liebe
Liebe II
Liebe III
Liebe IV
Liebe siegt
Lobpreis
LThK
Luther
Machtdiskurs
Mannheimer E.
Maria
Maria 2.0
Maribor
Mariologie
Marsch f. d. L.
Marsch II
Marsch III
Medienapostolat
Medienpolitik
Memorandum
Menschwerdung
Mercedarier
Messstipendien
Mexiko
Missbrauch
Missbrauch II
Missbrauch III
Missbrauch IV
Missbrauch V
Missbrauchsgipfel
Mission
Mission Manifest
Missionschronik
Modernismus
Morallehre
Mosebach
Moralbegriff
Morality
Mündigkeit
Mutterschaft








