zur katholischen Geisteswelt
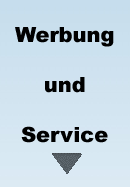
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
biographischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im zweiten Teildes blauen Bereichs des PkG (Buchstaben H bis M)
Zum ersten Teil
Zum dritten Teil
Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum philosophischen Bereich
|
|
Zum
liturgischen Bereich |
Themen
Häresie
Häresien
Heiligkeit
Heilsstrategie
Heimat
Hellenisierung
Herrenbrüder
Herz Jesu
Herz Mariä
Hexenwahn
Himmel
Hinduismus
Hirntod
Hispaniola
Homeschooling
Homoehe
Homosexualität
Humanae Vitae
Humanismus
Humor
HV u. Gewissen
ifp
Indien
Irak
Irland
Islam
Islam und Gewalt
IVF
Jesu Tod
Jesuiten
Jesuitenstaat
Jesus
Jesus II
Jesusbuch
Jesusbuch II
Jesuskind
Joh.-Evangelium
Johannes v. Kreuz
Juden
Jugend
Jugendvigil
Kamerun
Kapharnaum
Kapuzinergruft
Katholikentag
Kath.verfolgung
Kinder Gottes
Kirche I
Kirche II
Kirche III
Kirchenkrise
Kirchenstaat
Kirchenstatistik
Kirchensteuer
Kirchenvolks-begehren
Kirchenzukunft
Kirchweihe
Kirk Charlie
Kirk Erika
Die Madonna von Puig
Von Sophie zu Eltz
 Atemlos lehnte sich der junge Artur d’Alvez gegen die niedrige Steinwand. Der Schweiß stand ihm in großen Perlen heiß und ätzend auf der Stirn. Mit einem Seufzer, der fast ein Stöhnen war, wischte er sich über das Gesicht. Er nahm den weiten, grauweißen Turban ab und versuchte seinen Kopf zu kühlen. Rücken, Arme, alles schmerzte ihn von der Übermüdung, die staubglühende Wüstenluft presste ihm die Brust zusammen. Halb mechanisch rieb er sich die schmerzenden Glieder. Dann stülpte er den Turban wieder auf, warf noch einen Blick auf den ungeheuren Berg gefüllter Säcke, die er seit 12 Stunden aufgeschichtet hatte, und wandte sich dem Heimweg zu.
Atemlos lehnte sich der junge Artur d’Alvez gegen die niedrige Steinwand. Der Schweiß stand ihm in großen Perlen heiß und ätzend auf der Stirn. Mit einem Seufzer, der fast ein Stöhnen war, wischte er sich über das Gesicht. Er nahm den weiten, grauweißen Turban ab und versuchte seinen Kopf zu kühlen. Rücken, Arme, alles schmerzte ihn von der Übermüdung, die staubglühende Wüstenluft presste ihm die Brust zusammen. Halb mechanisch rieb er sich die schmerzenden Glieder. Dann stülpte er den Turban wieder auf, warf noch einen Blick auf den ungeheuren Berg gefüllter Säcke, die er seit 12 Stunden aufgeschichtet hatte, und wandte sich dem Heimweg zu.
Er war nicht allein. Vielleicht zwei Dutzend anderer Sklaven gingen den gleichen Weg. Sie alle schritten müde, gedrückt, wie Männer, deren Tagewerk ihre Kraft überschritten hat. Keiner sprach ein Wort, auch nicht die beiden türkischen Soldaten, die sie überwachten. Ein Geier schrie oben im bleiernen Himmel. Alvez blickte zu ihm auf: „Wäre ich schon so weit, dass mich dieser holen könnte!“, dachte er unwillkürlich. Aber dann kämpfte er gegen die Verzweiflung an: „Nein, ich bin noch jung, ich kann noch durchhalten, und mein guter König Ludwig der Getreue wird mich eines Tages doch befreien. Vielleicht komme ich wirklich noch einmal nach Hause. Madonna, lass mich nicht verzweifeln!“
Sie erreichten die elende Hütte, in der die Arbeitssklaven nächtigten. Datteln, Feigen und gedörrter Reis wurden von einer Sklavin gebracht. Schweigend saßen die Männer da, schweigend aßen sie die alltäglich gleiche Kost. Dann gingen sie hinein und fielen todmüde auf die Erde. Schon nach wenigen Minuten schlief alles. Nur Artur d’Alvez konnte nicht schlafen. Er setzte sich wieder vor die Hütte und starrte über den Sand. Hinter ihm warf das Mittelmeer seine Wellen gegen die nordafrikanische Küste. In etwa einer Stunde Entfernung lag eine Stadt. Man sah die Minarette der Moscheen im Abendlicht glänzen. Alvez schauerte zusammen. Er schloss die Augen, brennendes Heimweh verzehrte ihn.
In den Pyrenäen lag die Stammburg dieses jungen spanischen Ritters. Seine geliebten Eltern lebten dort und mit ihnen eine junge weitläufige Verwandte, die Arturs Herz besaß. Es war ein liebes, schönes Mädchen - für Alvez die herrlichste Frau der Welt. Trotz ihrer großen Jugend war eine tiefe Liebe zwischen diesen beiden Menschen. Fast hätte sie zu einer blutigen Fehde Anlass gegeben; denn der mächtige Nachbar, Ritter Juan de Melfort, warb ebenfalls um die kleine Isabella. Aber sie mochte von ihm nichts wissen und lehnte seine Werbung entschieden ab. Grollend hatte sich der abgewiesene Freier zurückgezogen.
Alvez war jedoch viel zu jung, um heiraten zu können. Erst sollte er sich die Rittersporen verdienen. So trat er in den Dienst König Ludwigs des Heiligen von Frankreich, der damals das leuchtendste Vorbild junger Ritterschaft war. An seiner Seite hatte er den Kreuzzug des Jahres 1249 mitgemacht, wurde aber nach der unglücklichen Schlacht bei Mansura 1250 in Algier gefangen. Der König musste mit dem Rest seines Heeres fliehen, Alvez und mancher seiner Gefährten waren in den Händen der Moslems zurückgeblieben. Er wurde an Moas Joegh, den neuen Herrscher Ägyptens, verkauft, der ihn zu schwerer Arbeit verwendete. Jetzt eben musste er große Mengen von Getreidesäcken aufladen, die zum Transport nach Stambul bestimmt waren. Und keinerlei Aussicht auf Befreiung - Zehntausende von Christensklaven waren in diesen Ländern schon gestorben und verdorben! Es fiel schwer, die Hoffnung aufrechtzuerhalten, zumal ihn in den zwei Jahren der Gefangenschaft kein einziges Wort aus der Heimat erreicht hatte. Von Spanien in das Reich der Bahariden führten wenige Wege!
Ein einsamer Reiter kam auf die Hütte zu. Sein Pferd lahmte. Artur erhob sich, es war Bibar, der Sohn seines Herrn. Dessen Pferd hatte sich offenbar irgendwie am Fuß verletzt. Alvez ging auf ihn zu; er hielt die Zügel, derweil der Reiter abstieg, und grüßte diesen korrekt, aber ohne den Stolz zu verletzen, den er stets seinen Unterdrückern gegenüber bewahrte. Bibar beachtete ihn nicht; mit einem leisen Fluch untersuchte er den Fuß seines Tieres. Das Übel fand sich bald, ein scharfes Eisenstück war in den Huf eingedrückt. Artur konnte es entfernen. Derweil sandte Bibar einen der türkischen Wächter um ein frisches Reittier und warf sich selbst auf den Boden. Alvez blieb beim Pferd stehen.
„Warst du ein Ritter?“, fragte Bibar ihn träge. „Ich heiße Ritter Artur d’Alvez“, antwortete der Gefragte kurz. Der Mameluk begann zu lachen. „Ihr seid ein komisches Volk, ihr Ungläubigen! Den ganzen Tag schleppst du Säcke, trägst das Kleid eines Sklaven, führst das Leben eines Hundes und wirst über kurz oder lang auch dessen Tod sterben. Und immer noch hältst du dich für einen Edelherren! Wie reimt sich das zusammen?“
„Vielleicht könnt Ihr es nicht verstehen“, antwortete Artur ruhig, „aber es ist doch so. Unser Adel liegt in unserer Seele, die kann Eure Hand nicht erreichen. Aber ihr, ihr alle“, fuhr er fort und die Röte stieg ihm glühend in die Stirn, da er gepresst weitersprach, „fühlt ihr es nicht, welch ewige Schmach ihr auf euch ladet, indem ihr Edelmänner zu Sklaven erniedrigt. Graut euch nicht manchmal vor euch selbst?“
Der junge Mann lachte. „Alvez, du bist ein toller Hund! Du hast schon oft die Peitsche unseres Sklavenaufsehers gespürt, und ich sehe, du hast immer noch Appetit nach ihr. Aber im Übrigen lass dir’s sagen, dass wir mit uns selbst ganz zufrieden sind. Der Sklavenhandel ist eine famose Einrichtung, wir können eurer gar nicht genug haben! Ihr schafft uns die Arbeit, und du weißt, dass ein Moslem lieber kämpft als arbeitet. Darum glaub ja nicht, dass wir euch jemals freigeben, es sei denn, dass ihr euer eigenes Gewicht in Gold aufbringen könntet oder einen Ersatzarbeiter stellt! Das gibt es übrigens wirklich, wie ich höre, närrische Männer eurer Völker, die hierher kommen und sich selbst als Lösegeld für andere Sklaven stellen, wenn ihr Geld nicht ganz ausreicht. Na, wenn es sie freut, uns stört das nicht.“
„Und nicht einmal diese Seelengröße wisst ihr zu würdigen“, rief Alvez aus. „Also gibt es diese Männer wirklich“, fragte er staunend, aber halblaut weiter. „Ich hatte wohl davon gehört, von einem neuen Ritterorden, der das vollbringt, aber ich hatte es nicht ganz geglaubt.“
In diesem Augenblick kam der Soldat mit einem frischen Pferd heran; Bibar erhob sich vom Boden. „Ich werde heimreiten“, sagte er, „und du, Alvez, führe das kranke Tier in die Burg, aber gehe vorsichtig mit ihm um! Mein Vater wird dich peitschen lassen, wenn du es schlecht behandelst, besonders wenn ich ihm erzähle, welche Sprache du dir herausnimmst.“
Damit sprang der Bursche in den Sattel, lachte den jungen Spanier schadenfroh an und galoppierte davon. Artur schaute ihm unbeweglich nach. Er war zum Umfallen müde, auch hatte der Wortwechsel einen Sturm in seiner Seele entfacht, dass es ihm schien, als tanzten die Sterne einen wilden Reigen vor seinen Augen. Aber er schwieg mit verbissenen Zähnen. Der Wächter gab ihm einen Stoß. „Was lungerst du da herum, vorwärts!“ Schweigend begann der Rittersohn den langen, mühsamen Weg.
Es war schon späte Nacht, als Artur in der Burg des Wesirs ankam. Er lieferte das kranke Pferd im Stall ab und warf sich dann dort aufs Stroh. Er war so todmüde, dass ihn alle Glieder schmerzten, und doch musste er bald wieder aufbrechen, um bei Sonnenaufgang an seinem Arbeitsplatz zu sein. Als er da lag, kam ein etwa 16-jähriger Stallsklave und setzte sich neben ihn. Früher, als Artur in der Burg hatte arbeiten müssen, hatte er den schmalen, bleichen Jungen, der von der sizilianischen Küste geraubt worden war, häufiger gesehen. Armes Kind, das Heimweh zehrte an ihm, dass es ein Jammer war! Es war zu fürchten, dass er es nicht lange aushielt. Er hatte sich gefreut, als Artur kam, wenn dieser auch zu müde war, mit ihm zu sprechen. Stumm legte er sich neben ihn hin und schaute ihn an. Dann brach er in heftiges Weinen aus. Das Schluchzen schüttelte den jungen Körper. „O Herr Gott, erbarme dich!“, murmelte der Spanier, während er den Jungen beruhigend streichelte. Aus seinem gequälten Herzen rang sich ein inniges Gebet empor. Er flehte die Gnadenmutter, die er von Kindheit an verehrt hatte, um ihre Fürbitte an. Auch in der fürchterlichen Sklaverei vergaß er an keinem Tag sie liebevoll zu grüßen. Dann schliefen die Leidensgenossen ein.
Sie hatten zwei Stunden lang geschlafen; Mitternacht mochte knapp vorüber sein, als ein Mann den Stall betrat und Alvez weckte. Es fiel ihm nicht leicht, den Spanier aus dem betäubungsähnlichen Schlaf zu reißen. Endlich verstand Alvez aber, das er aufstehen und hinüber in die Burg zum Wesir solle, „und du, Peppo, sollst auch mit“, fügte der Mann zu dem Jungen gewandt hinzu, der erschreckt daneben stand.
Alvez reckte sich hoch, und sein Gesicht wurde steinhart. Hatte Bibar, die junge Schlange, sich so sehr über ihn beklagt, dass der Wesir ihn mitten in der Nacht rufen ließ? Nun, der Spanier nahm sich vor, keine Angst zu zeigen. „Nimm dich zusammen, Peppo, Christen müssen diesen Heidenmenschen Mut beweisen“, sagte er zu dem verstörten Jungen und fügte leise bei: „Vertrau auf die Madonna, sie lässt uns nicht im Stich.“ „Ach, ob die Madonna uns nicht doch vergessen hat?“, seufzte der Knabe mutlos. Beide reinigten sich schnell und gingen in die Burg hinauf, die hell erleuchtet war. Der Wesir hatte die Gewohnheit, die Nacht zum Tag zu machen und Gäste und Geschäfte um diese Stunde zu erledigen; auch wollte er am anderen Morgen einen mehrtägigen Ritt unternehmen.
Der Saal, in den die zwei Sklaven geführt wurden, war in orientalischem Stil eingerichtet. Kunstvolle Teppiche bedeckten den Boden, sowie die verschiedenen Ottomanen und kleinen Ruhesessel, die herumstanden. Die Wand, die gewölbte Decke, die Möbel, die Lampen, die verschiedenartiges Licht vergossen, alles war reich gearbeitet, geschnitzt und teilweise mit Elfenbein eingelegt. In einer Zimmerecke stand ein großes Gefäß, dem köstlicher Duft entstieg, eine junge Orientalin sorgte mit immer neuen Spezereien dafür, dass der Wohlgeruch nicht ausging. Auf niedrigen Tischen waren Obst und allerlei Speisen, besonders Süßigkeiten, aufgestellt.
Auf all das warf Artur keinen Blick. Eines aber sah er, und dieses eine ließ sein Herz einen Augenblick fast stillstehen und das Blut wie toll in seinen Ohren brausen: Neben dem Wesir saß ein Mann, ein spanischer Ritter, der sich erhob, als Alvez eintrat. Über der eisernen Rüstung hing ein großes, weißes Skapulier, wie es Mönche tragen. Darauf war ein gewaltiges Kreuz gestickt. Groß und edel stand der Ritter da, und seine Augen hefteten sich leuchtend auf die Gestalt des Eingetretenen. Da wusste Artur d’Alvez nichts mehr von Müdigkeit, Schmerz und Überanstrengung.
Einen Herzschlag lang stand er stumm an der Tür, dann trat er rasch vor und begrüßte den Fremden nach Ritterart. Jetzt erst bemerkte er, dass noch sechs andere solche Männer in weißem Skapulier im Raum waren. Auch diese grüßte er freudig. Dann erst erinnerte er sich an den Wesir und verneigte sich vor ihm.
Der Fürst lachte. „Man sieht es, dieser will nicht mehr mein Sklave sein“, meinte er, „doch er hat Recht! Herr von Alvez, Ihr König hat mir eine Million Bezantas in Gold gesandt, Ihr seid frei und mögt mit diesen Männern heimziehen. Nur heute Nacht verbleibt noch als mein Gast.“
Artur stand ganz still da. Er brachte kein Wort über die Lippen, ja einen Augenblick fühlte er mit Schrecken, wie er kaum die Tränen zurückhalten konnte. Da ging der eine Ritter auf ihn zu und drückte ihm beide Hände. Auch die anderen drängten sich um ihn. Es war wie ein Erwachen aus schwerem Traum. Er wandte sich um und sah den kleinen Peppo an. Dieser sprang auf ihn zu und fiel ihm um den Hals. „O ich bin so froh, ich bin so froh!“, wiederholte der Junge wieder, dann schrie er auf: „Ich weiß es, das hat die Madonna getan! So hat sie uns doch nicht vergessen!“ „Du hast Recht, Junge“, antwortete ihm der Fremde, „denn wir alle sind ihre besonderen Diener; die Mercedarier heißen wir, Ritter Marias zur Befreiung der Sklaven.“
Dann wandte er sich wieder dem Wesir zu, der ihn an seine Seite bat. Auch Artur lud er mit einer Handbewegung zum Sitzen ein. Ein Sklave ging umher und bediente sie. Bibar aber saß mit bösen Augen daneben. Nun fing ein Handeln an, ein Feilschen ohnegleichen zwischen Moas Joegh und den Mercedarier-Rittern. Nicht nur das königliche Lösegeld für Alvez hatten die Männer gebracht, auch noch eine große Summe, die sie in christlichen Ländern zum Loskauf von Sklaven gesammelt hatten. Mit dieser sollten nun noch viele andere Christensklaven freigekauft werden. Freilich hatten diese längst keinen so hohen Preis, wie ihn der Ritter gehabt hatte, aber auch für die anderen forderte der Wesir viel, sehr viel. Alle Christensklaven, die zur Zeit im Palast Moas beschäftigt waren, erschienen nach und nach im Saal; zitternd standen sie da und sahen auf den schrecklichen Handel, der um ihr Leben, um ihre Freiheit ging. Einen nach dem anderen strich der Moslem dann schließlich von seiner Liste, und die Männer traten vor und warfen sich den Ordensrittern zu Füßen in fassungslose Freude.
Für alle reichte das Geld jedoch nicht. Wie sehr der Mercedarier sich auch bemühte, der Herrscher ließ von seinem Preis nicht ab. Schließlich war die ganze große Summe vergeben. Nur einer war übriggeblieben - Peppo, der Stallsklave. Wortlos und totenblass stand der arme Junge da und blickte mit Augen voller Entsetzen um sich. Alvez konnte es nicht mit ansehen. „Wenn Ihr auf keinen Fall Erbarmen haben könnt, Fürst, so bleibe ich lieber anstelle des Jungen“, sagte er heftig. Der Wesir lächelte höflich. „Der König der Franken würde sich wundern, wenn er für einen armen Sizilianer eine Million Bezantas gezahlt hätte.“ Aber auch der Mercedarier schüttelte den Kopf. „Nein, Alvez, dieses Vorrecht hat Maria uns aufbewahrt“, und zum Wesir gewandt, fügte er hinzu: „Ihr kennt unsere Gewohnheiten, ich bleibe statt des Jungen.“ Der Mameluk zuckte die Achseln. „Tut, was Euch gefällt, Ritter, ich mache keinen schlechten Tausch. Ihr werdet eine bessere Arbeitskraft abgeben als dieser Schwächling. Du bist also frei!“, rief er Peppo zu. Da trat dieser unsicher vor, setzte an, etwas zu sagen, und sackte dann plötzlich zusammen. Zwei Frauen sprangen herbei, trugen den Bewusstlosen hinaus und legten ihn auf ein Bett, bis er wieder zu sich kam. Der Wesir schüttelte abermals den Kopf. „Und für solch ein armseliges Pflänzchen wollt Ihr wirklich Eure Freiheit hergeben?“, fragte er, „denn Ihr müsst wissen, dass Ihr hier Sklave und sonst nichts seid.“ Nachdenklich blickte der Ritter Alvez an. „Das glaube ich Euch, Fürst! Dieses ist aber eben unsere Art, der Himmelskönigin zu dienen.“ „Beim Barte des Propheten“, lachte der Mann, „Ihr habt sonderbare Vorstellungen! Immerhin wollen wir diesen Vertrag durch ein Festgelage beschließen.“
Der Morgen graute, als das Mahl zu Ende ging; Artur dachte an den Arbeitsplatz, auf dem er jetzt hätte stehen müssen. Er wusste noch kaum, ob alles Wahrheit oder Traum war. Glutvolle Bilder tanzten in seinem Kopf: Freiheit, Heimat, Eltern, Isabella und dann: die Madonna. Aber er konnte es noch nicht ganz fassen.
Der Wesir war ein liebenswürdiger Gastgeber; er grollte seinen entlassenen Sklaven keineswegs. Im Gegenteil, sie hatten ihm ein schönes Geld eingebracht. Nicht so Bibar; er konnte sich nicht so schnell in die Veränderung finden. Als die Befreiten beim Morgengrauen zum spanischen Schiff hinuntergingen, trat er zu Alvez. „Da hast du Glück gehabt, Ritter“, meinte er höhnisch. „Also merkst auch du, dass ich ein Ritter bin?“, antwortete Alvez. Stumm standen sich die beiden jungen Männer einen Augenblick gegenüber. „Ihr schaut mich wohl so an, damit Ihr mich meiden könnt, wenn wir uns wieder einmal in einer Schlacht begegnen sollten“, sagte schließlich der Moslem höhnisch. Alvez lächelte: „Ich denke, es wird mir leicht sein, Euch jederzeit wiederzuerkennen; verlasst Euch darauf, wir stehen uns nochmals gegenüber“, fügte er plötzlich mit solcher Heftigkeit bei, dass der junge Mameluk einen Schritt zurücktrat.
Der Ordensritter, der zurückbleiben sollte, begleitete alle noch bis zum Schiff. Mit tiefer Ergriffenheit nahm Alvez von ihm Abschied. Wusste dieser junge Mensch, der mit leuchtendem Blick vor ihm stand, welches Martyrium ihn erwartete? Ja, dachte sich der Spanier, er weiß es. Und in plötzlicher heißer Begeisterung sagte er laut: „Bei Gott, wenn ich nicht Eltern und eine liebe Braut zu Hause hätte, ich wüsste nichts Herrlicheres als dieses: Leben und tun, wie Ihr es tut.“ Der andere drückte ihm die Hand. „Gott allein weiß, wozu er uns berufen hat, Alvez.“
Eine halbe Stunde später lichtete das Schiff die Anker. Der einsame Ritter stand am Ufer und winkte seinen Gefährten. Sein Gesicht strahlte. „O Maria, du hast mich beim Wort genommen, ich danke dir!“, sagte er mit stiller Freude. Bibar trat zu ihm hin: „Vorwärts, Mensch, an die Arbeit!“ Der Mercedarier wandte sich um und blickte den Burschen gelassen an, und vor dem Licht in seinen Augen trat dieser wortlos zurück.
Bevor die Sonne die Mittagshöhe erreicht hatte, schichtete der neue Sklave Getreidesack auf Getreidesack am großen Lagerplatz am Ufer.
Artur d’Alvez war nach Hause gekommen. Wie im Flug war die lange Reise auf dem kleinen Segelschiff vergangen, so herrlich war die wiedererlangte Freiheit, so beseligend der Gedanke an das nahe Wiedersehen. Jede Einzelheit im Vaterhaus sah er schon vor sich: die Eltern, Isabella, alle die lieben alten Dienstboten, die schöne Burg. Und nun war er da!
Aber es wurde eine furchtbare Heimkehr. Als er um den Bergkegel ritt, der die Aussicht auf die Heimat freigab, schrie er plötzlich laut auf vor Schreck und Entsetzen. Er rieb sich die Augen; wieder und wieder beugte er sich vor und schaute hinunter, ob es denn Wirklichkeit war. Aber es war kein Trugbild - die Burg Alvez lag als wüster Trümmerhaufen da. Nicht Mauer, Turm noch Bauwerk war zu sehen, ausgebrannte Ruinen reckten ihre schwarzen Arme in die Höhe. Und die Seinen? Eisige Angst schnürte dem jungen Ritter die Kehle zusammen. Er gab seinem Pferd die Sporen, dass es sich aufbäumte und in rasendem Lauf den steinigen, steilen Bergpfad hinunterstürmte. Es war erstaunlich, dass Ross und Reiter sich nicht alle Beine brachen.
Wie besessen irrte Artur dann zwischen den ausgebrannten Trümmern umher, die seine Heimat bedeckten. Tränen rannen ihm über die Wangen, er merkte es nicht. Er musste jemanden finden, der ihm von den Seinen und ihrem Schicksal berichten konnte. Ach, wenn nur sie lebten, die Eltern und Isabella, so konnte er alles andere verwinden! Da stieß er in einer leeren Türwölbung mit einem Jungen zusammen. Dieser schrie laut auf vor Schreck, ja er machte kehrt und floh in kühnen Sprüngen über die Steinhaufen. Artur war sogleich hinter ihm her. Der Knabe rannte aus Leibeskräften, aber der junge Ritter lief noch schneller. Seine Muskeln waren eisenhart, und der Schmerz gab ihm doppelte Kraft. Rasch hatte er ihn eingeholt; er fasste ihn an den langen Haaren und hielt ihn fest. Jammernd warf sich der Junge auf die Knie, rang die Hände und schrie wie besessen.
Artur setzte sich nieder und drückte den Knaben neben sich auf die Erde. Dann sprach er freundlich zu ihm. Er wartete mit eiserner Selbstbeherrschung, bis sich das Kind beruhigt hatte. „Ich kenne dich doch“, sagte er, „du bist Juan Grant, dein Vater war Hirte. Wieso läufst du vor mir davon, weißt du nicht, wer ich bin?“ „Ach, Herr Ritter“, meinte er, mühsam nach Worten ringend, „verzeiht mir, ich dachte, Ihr wäret lange tot und es sei Euer Geist, der hierher kommt, um den grässlichen Mord zu rächen. Aber jetzt sehe ich, dass Ihr lebt.“ Der Knabe schauderte noch einmal in sich zusammen; aber nun saß er still, obwohl Arturs Hand ihn losgelassen hatte. Wie betäubt saß der junge Ritter da. Ihm war es, als ob ein ungeheurer Felsen auf ihn stürzte. Die Ruine, die Gestalt des Knaben vor ihm, alles wankte vor seinem Blick, wurde klein und immer kleiner und schien sich vor ihm zu drehen. Es dauerte einige Minuten, bis er wieder klar sehen konnte und die furchtbare Wahrheit ganz begriff. Dann sprang er mit einem solchen Schrei auf, dass der Hirtenjunge wieder entflohen wäre, wenn Arturs Hand ihn nicht erneut festgehalten hätte. „Sie sind ermordet, alle, alle“, schrie der Ritter. „Wann und von wem? Sag es mir, Bursche, wenn dir dein Leben lieb ist.“
So erfuhr er alles; stammelnd und entsetzt berichtete der Hirtenjunge, was er wusste: Wie die Seinen hier Jahr um Jahr auf ihn gewartet hätten, wie Juan de Melfort, der grausame Nachbar, immer wieder gekommen sei und um Isabella geworben hätte, bis Arturs Vater dem Unerwünschten endlich die Tür gewiesen habe, wie dann die Nachricht gekommen sei, er, Artur wäre beim Kreuzzug gestorben. Dann wäre Melfort wieder gekommen, unerwartet, mit großer Macht und hätte die Burg überfallen. Nach verzweifeltem kurzem Widerstand war alles in Flammen aufgegangen, und Melforts Mannen hätten alle Insassen ermordet, auch Isabella. Melfort habe dazu gelacht.
Als Artur den genauen Hergang erfahren hatte, saß er wie versteinert; der Knabe machte sich eilends davon. Die ganze Nacht saß der Ritter stumpf und regungslos auf den Ruinen seines Vaterhauses; aber als der Tag graute, stand er mit einem grässlichen Schwur auf. Alle Gewalten der Hölle waren in diesen Stunden in der Seele des jungen Mannes entfacht. Hätte er es vermochte, er hätte sich wohl dem Teufel selbst verschrieben, um seiner Rache Willen.
Drei Tage und drei Nächte irrte Artur in hilflosem Zorn um die Brandstätte. Einige Leute kamen aus dem Dorf; denn die Kunde, die der Hirtenjunge gebracht hatte, war wie ein Lauffeuer durch die Gegend geflogen. Alle hatten den ritterlichen Knaben geliebt. Aber vergeblich versuchten die alten Dörfler mit ihm zu sprechen. Er trieb jeden von sich, scheu wichen die Leute schließlich zurück. Artur d’Alvez glich einem Wahnsinnigen in jenen Tagen. Schließlich kam die Erschöpfung über ihn. Das lange Fasten und die Wildheit seiner Gefühle hatten ihn halb aufgezehrt. Nun, da er ruhig wurde, begann ihm vor sich selbst zu grausen. So floh er fort von seiner Heimat, die ihm zur Hölle geworden war.
Wochenlang irrte er in dem Gebirge herum, halbtot vor Hunger und Erschöpfung. Mitleidige Leute gaben dem wirren Fremdling Speise und Trank. Unterkunft verlangte er nicht, mit keinem sprach er ein Wort. Immer wieder musste er an den Geier denken, der über dem Lagerplatz am Meeresufer gekreist hatte. O wäre er doch jenem dort zum Opfer gefallen! Mit tiefer Bitterkeit nur konnte er an seine Rettung denken. Es gab Stunden, in denen er an seinem Glauben Schiffbruch litt. Eines aber tat er doch nicht; er fluchte nicht wider Gott, nicht wider die Jungfrau Maria. Wenn sich auch solche Worte in seinem siedenden Hirn formten, sich auch auf seine Lippen drängten, er sprach sie nicht aus. Die Gewohnheiten einer frommen Jugend, wohl auch die Fürsprache der Seinen bewahrten ihn vor diesem Frevel. Verzweiflung und Rachsucht aber zerrissen seine Seele, bis sein Körper all dieses Übermaß nicht mehr ertrug. Er verfiel in ein hitziges Fieber. Bewusstlos, glühend, halb verschmachtet, lag er schließlich in einer Pyrenäenhöhle. Dort fand ihn ein wandernder Mönch.
Es war Petrus selbst, der den Orden der Ritter Marias zur Befreiung der Sklaven gegründet hatte zusammen mit Raymond von Penafort und König Jakob I. von Aragon. Ihnen war die Allerseligste erschienen an weit getrennten Orten und hatte sie zu dieser Gründung aufgefordert. Kaum 20 Jahre war das nun her, aber glänzend entwickelte sich schon der heldenmütige Ritterorden, dessen Zweck es war, die Küsten und Handelsschiffe vor den Seeräubern zu schützen und die Christensklaven auszulösen.
Mit unermüdlicher Liebe pflegte der heilige Mönch den jungen Ritterssohn, den er in sein Kloster gebracht hatte. Langsam nur wich das böse Gehirnfieber. Noch langsamer verlosch der furchtbare Zorn. Am schwersten war es, die so natürliche Rachsucht gegen den Mörder der Alvez niederzuringen. Petrus Nolascus aber ließ nicht locker, wenn auch Monate darüber vergingen. Seine Mitbrüder staunten - seitdem der kranke Fremde unter ihnen war, ging ihr verehrter Stifter kaum mehr aus dem Kloster. Keine einzige größere Sammelreise unternahm er in all diesen Wochen. Er, den die heilige Unruhe zu immer neuem Werben für die große Sache trieb, schien alles andere über dem einen Zweck vergessen zu haben, diese eine arme Seele zu retten.
Sein Eifer blieb nicht fruchtlos. Es kam die Stunde, in der der junge Edelmann vor seinem Seelenführer kniete. Mit fester Stimme gelobte er, aller Rachsucht gegen Juan de Melfort zu entsagen, nach dem großen Gebot der Feindesliebe. Er empfing den Leib des Herrn auf diesen Schwur. Dann stand er auf und trat auf Petrus zu. „Und nun, Vater, gewährt mir noch eines: Nehmt mich auf in Euren Orden.“ Petrus Nolascus gewährte diese Bitte nicht. Ein Jahr lang sollte Artur erst in die Welt zurückkehren. Nicht im Sturm großer Empfindungen darf ein Ordensgelübde abgelegt werden. Der Anwärter sollte es sich reichlich überlegen.
Mit großem Schmerz hörte Artur die kluge Entscheidung. Es graute ihn vor der Welt, aber er musste sich fügen. So beschloss er, zu dem neuen großen Wallfahrtsort Spaniens zu gehen, zur Kirche Unserer Lieben Frau von Puig bei Valencia. Hier, wenn irgendwo, musste Maria wohl zeigen, ob sie ihn zu ihrem Ritter haben wollte oder nicht.
Ganz Spanien sprach in diesen Jahren von Unserer Lieben Frau von Puig und den großen Wundern, die dort unaufhörlich geschahen. Mehr als alle anderen aber zeichneten sich die Ritter des Mercedarierordens bei der Verehrung dieses Gnadenortes aus. Hier war ihr Mutterhaus, hier der Sammelpunkt, den Maria selbst für ihre Söhne bestimmt hatte.
Mit Puig hatte es folgende Bewandtnis: König Jakob I. von Aragon war selbst in die Hände der Mauren gefallen. Hier konnte er mit eigenen Augen das seelische und leibliche Elend so vieler Christensklaven schauen. Da gelobte er, falls er die Freiheit wiedererlangen sollte, einen eigenen Orden zur Befreiung der Gefangenen ins Leben rufen zu wollen.
Er wurde wirklich befreit, und sogleich dachte er an die Erfüllung seines Gelübdes. Mit großer Freude vernahm er, dass die Mutter Gottes seinem Beichtvater, dem heiligen Raymond von Penafort, und einem unbekannten Einsiedler, Petrus Nolascus, erschienen war und ihnen den gleichen Gedanken eingegeben hatte, den er im Herzen trug. Sogleich berief er beide zu sich. Bevor sie noch kamen, erschien die Madonna auch dem König selbst. Auch ihm sagte sie, es sei ihr Wille, dass ein solcher Ritterorden entstehe. Mit heiliger Begeisterung verkündeten die drei Männer Marias Auftrag, und von fern und nah meldeten sich heldenmütige Seelen, die Ritter der Gottesjungfrau werden wollten. Der Orden der Mercedarier wurde gegründet. König Jakob stellte ihm eine seiner Burgen in Valencia zur Verfügung; eine große Klosterkirche sollte noch angefügt werden. Es war einer der schönsten Tage seines Lebens, als er der Gründung des neuen Ritterordens im Dom beiwohnen konnte. - Als der Tag sich neigte, unternahm der Fürst einen Ritt vor die Tore der Stadt. Viele Herren seines Gefolges begleiteten ihn. Sie waren schweigsam, noch voll des großen Tages. Plötzlich verhielt der König sein Pferd, auch alle anderen fuhren betroffen zusammen, denn ein eigenartiges Schauspiel erschien am nächtlichen Himmel.
Außerhalb Valencias lag ein kleiner Hügel, Puig oder Puché genannt. Er war von Weideland bedeckt. Gerade über diesem Hügel nun löste sich langsam Stern um Stern vom Himmelsgewölbe. Alle Anwesenden sahen es deutlich. Es waren keine Sternschnuppen, sondern ganz langsam stiegen sieben leuchtende Himmelslichter hernieder, bis sie als glorreicher Kranz um den kleinen Hügel strahlten. Mehrere Stunden lang zeigte sich das unerklärliche Schauspiel. Der König war vom Pferd gestiegen und auf die Knie gesunken. „Hier spricht Gott der Herr mit uns!“, rief er und harrte unbeweglich während der langen Dauer der Erscheinung aus. Petrus Nolascus riet dem Fürsten, an dieser Stelle nachgraben zu lassen, was auch geschah.
Einige Tage lang gruben die Leute, die bei ihrer Arbeit stets von einer Schar Neugieriger umgeben waren. Plötzlich stieß einer mit der Hacke auf einen eisernen Gegenstand. Sofort wurde die Arbeit eingestellt und dem König Meldung gemacht, wie es Jakob befohlen hatte. In Gegenwart des Fürsten und des ganzen Hofes wurde dann weiter gegraben. Eine gewaltige Metallglocke kam zum Vorschein und unter ihr eine steinerne Platte, auf der in schöner und seltsamer Arbeit die Himmelfahrt Mariens in Steinrelief zu sehen war.
Mit entblößtem Haupt stand der König da, während er den geheimnisvollen Fund in Händen hielt. Er übergab ihn Petrus Nolascus. Auch die Metallglocke war von uralter Art; jahrhundertelang musste sie hier unter der Erde ihr Heiligtum geschützt haben. An ihrem Rand fand sich eine lange Aufschrift, aber keiner der Anwesenden konnte die alten Zeichen lesen. So ließ man sich einen gelehrten Mann aus Salamanca kommen, der die seltsamen Buchstaben entziffern konnte. An einem großen Marienfeiertag, mittags nach dem Hochamt, berief der König die Einwohner von Valencia, dass sie die Botschaft der Glocke vernehmen sollten.
Sie war wohl wunderbar genug! Es stand geschrieben, dass St. Jakobus der Ältere, der Apostel Spaniens, diese steinerne Tafel aus dem Heiligen Land gebracht hätte. Man wusste in den ersten Christengemeinden Spaniens nichts anderes, als dass jene Platte vom Grab der Gottesmutter herstamme und Engelshände die kunstreichen Formen in sie getrieben hätten. Wie dem auch sei, die Jünger hielten sie in großen Ehren. Als der hl. Eugenius, der Schüler des Jakobus und erste Bischof von Valencia, dort eine Marienkapelle erbaute, stellte er die Tafel darin auf. Hier blieb sie auch bis zum Jahr 622. Dann aber drohten die Einfälle der Mauren. Die Leute bangten um ihr Heiligtum. Darum vergruben sie das Bild unter der Glocke, auf deren Rand sie die ganze Geschichte einritzten.
Grenzenloser Jubel brach aus, als das Volk erfuhr, was für ein wunderbarer Schatz ihm geschenkt worden war. Und besonders die Freude der Mercedarier kannte keine Grenzen; denn niemand bezweifelte: Um ihrer Ritter Willen hatte Maria dieses Geheimnis gerade jetzt preisgegeben. Zimens von Daroca, der Priester, und Guimeano, der Chronist, trugen alle Begebenheiten getreulich in alte Bücher ein, in denen die kostbaren Handschriften für alle späteren Geschlechter aufbewahrt wurden. So konnte auch Papst Benedikt XII., als er 1407 eine Bulle zugunsten des Wallfahrtsortes Puig herausgab, die Geschichte der Auffindung und der alten Aufschrift als historisch einwandfrei bezeugen. Bis auf den heutigen Tag wird Unsere Liebe Frau von Puig in Spanien hoch verehrt.
Kurze Zeit nach der Auffindung unternahmen die Mauren einen neuen großen Einfall in das Innere Spaniens. König Jakob, der für das Heiligtum auf dem Gnadenberg von Puig eine Kapelle errichtet hatte, zog im Vertrauen auf Marias Schutz mit den Seinen in die Schlacht. Mit nur 2500 Mann war der König gegen zahlreiche Mauren ausgerückt, man sprach sogar von 40.000. Trotzdem errang er einen vollkommenen Sieg. Das bedrohte Valencia und weite Gegenden südlich davon wurden befreit, zahllose Feinde blieben tot auf dem Schlachtfeld, von dem siegreichen Heer fielen nur wenige. Spanier und Mauren aber sahen über den Kämpfenden St. Jakobus mit gezogenem Schwert; er ritt auf einem weißen Ross und trug ein Kreuz auf der Brust. Da wussten alle: Das war Gottes Sieg, nicht der eines Menschen.
Nach dieser Schlacht, der ersten von vielen, die König Jakob schließlich den Namen des Eroberers einbrachten und Spanien bis nach Granada vom maurischen Joch befreiten, war es des Fürsten brennendster Wunsch, Puig mit einem würdigen Gotteshaus zu schmücken. Er führte das Werk auch durch. Auf dem Castillo, wie die Leute den geweihten Hügel nannten, ragte bald eine prachtvolle Wallfahrtskirche auf. Als sie vollendet war, trug der König die Schlüssel von Valencia herbei und übergab sie für alle Zeiten der Schutzfrau von Puig. Ganz Aragon hatte sich an dem frommen Werk beteiligt.
Und der Segen des Himmels ruhte nunmehr auf ihm. Immer wieder sah man sieben Sterne, die von neuem einen Kranz um den auserwählten Ort wanden. Auch hörte man häufig Engelsgesang, besonders wenn die Mönche das Chorgebet verrichteten und das Salve Regina anstimmten. Noch jahrhundertelang sollte dieses Wunder anhalten, von Tausenden erlebt werden. Ja, als im Jahr 1588 Philipp II. das Gnadenbild nach Valencia hineinnahm, um es 16 Tage hindurch bei einer besonderen Gelegenheit dort zu verehren, sah man die Sterne zwischen Puig und Valencia hin und her ziehen. Auch hörte man den Engelsgesang nun in Valencia. Der Raum, in dem das Gnadenbild aufgehoben wurde, erhielt den Namen Engelszimmer.
Zu diesem Heiligtum kam Artur d’Alvez. Hier fand er auch die Gewissheit, dass Maria ihn würdigte, einer ihrer Ritter zu werden. Da kamen Friede und Freude in sein Herz. Nun konnte er auch warten. Er ritt zu Ludwig dem Heiligen, um ihm für seine Befreiung zu danken. Und als das Probejahr verstrichen war, erhielt er in der Gnadenkirche selbst das Ehrengewand des Mercedariers.
Der junge Ordensmann gewöhnte sich bald an sein neues Leben. Das lange Zusammensein mit Petrus Nolascus ließ ihn ungemein rasch alle geistlichen Dinge verstehen. Durch die furchtbaren Verluste, die ihn betroffen hatten, war seine Seele eine weite, leere Wohnung geworden. Nichts Irdisches gab es ja mehr, das sie anfüllen konnte. Weil er aber den heldenhaften Akt der Feindesliebe gemacht hatte, segnete Maria ihren Ritter mit Händen, die von Gnade überströmten. Der junge Mann staunte oft über sich selbst. Wie Furchtbares hatte er erlebt! Und dennoch, er konnte es nicht anders sagen, er fühlte sich restlos glücklich.
Nachdem Alvez seine theologischen Studien vollendet und die Priesterweihe empfangen hatte, bekam er zunächst die Aufgabe, Freunde und Gönner für den neuen Orden und Lösegeld für die Sklaven zu suchen. Pater Juan hieß er nun; denn in einer Aufwallung von Großmut hatte er gebeten, den Namen eben seines Todfeindes als Ordensnamen zu erhalten. Niemand, außer Petrus, wusste, wer der junge Priester eigentlich war.
Nach einer langen und erfolgreichen Bettelreise kehrte er wieder einmal nach Valencia zurück. Es war ein heißer Spätnachmittag, er saß in dem ziemlich weiten Garten des Klosters, bei dem neuen Marienheiligtum am Castillo. Da kam ein Bruder zu ihm und sagte, eine Dame sei da, offenbar in größter Bedrängnis; sie bäte um eine Unterredung mit einem der Ordensherren. Pater Juan ließ sie kommen. Es war eine Spanierin, nicht mehr ganz jung. Sie war hierher gereist, um die Hilfe der Mercedarier anzuflehen. Es war dieselbe Geschichte, wie sie Tag um Tag an das Tor des Hauses gebracht wurde: Verzweifelte Menschen weinten um einen Angehörigen, der in die Sklaverei der Moslems gefallen war. Ihren Bruder hatte dieses Unglück getroffen. Auf einer Fahrt nach Neapel war das Schiff, mit dem er fuhr, in die Hände ägyptischer Piraten gefallen. Nur ein Bursche war schwimmend entkommen und hatte sich auf ein anderes Schiff retten können; dieser hatte die furchtbare Botschaft gebracht. Ihr Bruder hieß Juan de Melfort.
Artur fuhr zusammen, als hätte ihn jemand mit einem rotglühenden Eisen mitten ins Gesicht geschlagen. Er rührte kein Glied. Zu unerwartet war die Stunde gekommen, die seinen Eid, seine Feindesliebe, auf eine unerträglich harte Probe stellen sollte. Artur hatte nicht geglaubt, dass es so schwer sein würde! Tag um Tag hatte er das „Ich habe vergeben“ gesprochen, hatte ein kleines Gebet für seinen Feind verrichtet, wie es sein Seelenführer verlangt hatte. Aber nun schien das alles weggefegt zu sein. Einen Augenblick schloss er die Augen, dann sprang er unvermittelt auf und lief mit langen Schritten davon, fort in den dunkelnden Garten. - Fast eine halbe Stunde lang tobte sein innerer Kampf. Alles war in ihm lebendig geworden, das alte Grauen, die ohnmächtige Verzweiflung, die brennende Qual. Der Hass, den er so lange tot geglaubt, zerrte und tobte an seiner Kette. Er wand seinen Rosenkranz so fest um die Hand, dass sich die Perlen und das metallene Kreuz ins Fleisch eindrückten. „Madonna!“, rief er einmal laut, fast herrisch vor Pein. Dann schwieg er und kämpfte es nieder.
Elvira de Melfort war bestürzt auf ihrem Platz zurückgeblieben. Sie wusste nicht, wie sie sich das Verhalten des Priesters erklären sollte. Wohl hatte sie mit Schwierigkeiten gerechnet, denn unmöglich konnten die frommen Ritter all die Tausende auslösen, die ihnen anempfohlen wurden. Aber das erklärte diese plötzliche Flucht doch nicht. Sie blieb indessen und wartete - schon darum, weil sie nicht wusste, ob sie in dem weiten Garten den richtigen Ausgang finden würde.
Schließlich kam Pater Juan leichenblass wieder, sodass Elvira über sein Aussehen erschrak. Aber er sprach ruhig und höflich. Er fragte genau nach allen Einzelheiten von Ort und Zeit. Dann erhob er sich. „Seien Sie überzeugt, Dona de Melfort, wenn es irgend möglich ist, werde ich Ihren Bruder retten. Ich werde mich in ganz besonderer Weise gerade für ihn bei unserem Oberen einsetzen.“ Elvira sprang auf. In einem Ausbruch von Freude streckte sie dem Ritter die Hand hin. Den Bruchteil einer Sekunde zögerte er, dann aber gab er die seine mit einer fast heftigen Bewegung. Elvira schien es, dass sie kalt war, kalt wie die Hand eines Toten.
Artur d’Alvez hielt Wort. Petrus Nolascus weilte gerade in jenem Kloster. Abends, im Kapitelsaal, stand Artur auf und berichtete vor dem ganzen Konvent von Elviras Bitte. Als er den Namen Melfort nannte, zuckte Nolascus leicht, es ging wie eine Röte über seine Züge. Er warf einen scharfen Blick auf den jungen Ritter, einen Blick, der dann wunderbar weich und warm wurde. Das war alles, zwischen den beiden wurde kein Wort über die Sache gesprochen. Eine heiße Welle der Freude flutete über Arturs Herz. Nun erst war alles wirklich gut! Petrus Nolascus stimmte der Bitte Pater Juans bei. Dieser Gefangene sollte unbedingt ausgelöst werden. Man würde die Gelegenheit benützen, um die Gelder des letzten Jahres nach Nordafrika zu bringen. Sechs Männer wurden ausgewählt, um die Aufgabe durchzuführen. Alvez war unter ihnen.
Zunächst wurden die üblichen Vorbereitungen getroffen und Erkundigungen einzogen. Mit Hilfe von islamischen Stellen, die an dem Loskauf interessiert waren, gelang es den Mercedariern, fast über jeden Sklaven genaue Auskunft zu erhalten. Als Artur hörte, dass Melfort an den Hof des Wesirs von Ägypten gekommen war, setzte er sich in seine Zelle und lachte laut. Welch sonderbares Spiel trieb doch der liebe Gott mit ihm!
Vor dem Gnadenbild von Puig holten sich die Ausziehenden den letzten Segen, erneuerten ihr Gelübde: Alles, nötigenfalls sich selbst, für die Gefangenen hinzugeben. Dann segelten sie mit gutem Wind nach Ägypten.
Artur schien es wie ein Traum, als er in den Hof des Wesirs einritt. Was war nun die Wahrheit - seine einstige Gefangenschaft oder seine jetzige Freiheit? Aber nicht zum Herrscher wurden die Ritter geführt, denn dieser war an den Hof eines benachbarten Emirs geritten, sondern zu Bibar, seinem Sohn. Stumm standen die Gegner von einst einander gegenüber. Artur dachte: „Wie er dick ist!“ Und man sah es dem aufgedunsenen, listigen Gesicht an, dass dieser Mensch noch grausamer und gemeiner geworden war als ehedem. Bibar aber war zunächst vor Überraschung sprachlos. Dann aber funkelte es rachgierig in seinen Augen. Er hatte Arturs ungestrafte Zurechtweisung nie ganz überwinden noch vergessen können.
Arturs erste Frage galt Juan de Melfort. Aber Bibar konnte sich zuerst gar nicht erinnern, was mit dem Mann geschehen war. Schließlich wusste ein Mitsklave Auskunft: Juan war von der Pest befallen und deshalb von den übrigen Sklaven abgesondert worden. Seitdem lebte er in einer Höhle, etwa drei Stunden entfernt in der Wüste. Einer seiner Mannen hatte ihm Speise und Trank dorthin gebracht. Es schien nicht, dass er sterben werde. Artur verlangte sogleich die Auslieferung dieses Kranken. Aber, merkwürdig, gerade von ihm wollte Bibar durchaus nichts hören. Vielleicht sagte ihm eine Ahnung, dass sein Feind es auf eben diesen abgesehen hatte. Jedenfalls ließ er sich in diesem Punkt durch nichts erweichen. Die anderen Verhandlungen nahmen ihren üblichen Lauf, wenn es auch viel schwerer war, mit Bibar zu verhandeln als mit seinem Vater. Immer versuchte er zu betrügen und den Preis hinaufzutreiben. Mehrere Tage lang ging das Feilschen und Bieten hin und her. Aber schließlich gelang es, eine große Zahl Sklaven zu befreien, alle fast, die auf der Liste der Mercedarier standen. Nur einer war nicht dabei, der wertlose Pestkranke.
Die Ritter konnten Bibars Weigerung nicht begreifen, nur Artur rechnete von Anfang an mit der grenzenlosen Tücke und Rachsucht des Wüstlings. „Mutter Gottes“, flüsterte er wohl manchmal für sich, „willst du es so fügen, dass ich meine Rache bis zum Letzten auskoste? Ich bin es zufrieden, wenn du es so haben willst!“ - Es kam, wie er geahnt hatte. Als der Sprecher der Mercedarier nochmals einen erhöhten Kaufpreis für Melfort bot, erklärte Bibar unumwunden: „Nein, ich gebe ihn nicht frei und wenn er tausendmal arbeitsunfähig ist. Nur unter einer Bedingung mögt Ihr ihn haben - wenn Ihr einen Ersatzmann stellt. Und dann muss es dieser sein, dieser und kein anderer.“ Und triumphierend wies er mit seinem dicken Finger auf Alvez. Dieser lächelte. „Ich wusste es von Anfang an und bin es zufrieden.“ Da wurde der Mameluk blaurot im Gesicht. Dass dieser verhasste Christ den Mut hatte, sich nochmals in seine Gewalt zu geben, hatte er nicht vermutet. Er rechnete vielmehr auf den Bruch seines Rittereides, und nun hatte ihm Artur diesen Triumph aus der Hand gewunden.
Die anderen Ritter waren außer sich, dass ein so großes Opfer gebracht werden sollte, zumal es hier besonders unnötig schien. Artur ließ sich jedoch von seinem Entschluss nicht abbringen. Er war von fast übermütiger Freude, als reizte ihn der ganze Handel beständig zum Lachen. „Ahnt unser junger Bruder denn nicht, welchem Martyrium er entgegengeht?“, dachte mancher, aber Artur sagte: „Gut, so lasst uns gleich hinausreiten, meinen Mann einzuliefern; er komme auf unser Schiff, und ich bleibe Euch als Pestersatz hier, Freund Bibar.“ Da schien es fast, als wolle der Wesirssohn an der eigenen Galle ersticken.
Schweigend ritten die Mercedarier in die Wüste, von dem treuen Dienstmann Melforts begleitet, der diesem das Leben gerettet hatte. Einmal sagte einer der Ritter: „Bruder Juan, ich fürchte, Ihr werdet unser Opfer hier bis zur Neige auskosten müssen.“ Artur schaute ihn freudestrahlend an. „Wünscht mir Glück dazu, lieber Bruder, dass ich so früh zum Minnedienst gelange, den wir geschworen haben! Ich hätte es mir nicht vollkommener aussuchen können, als es nun kommt.“ Da schwiegen die anderen.
Juan de Melfort bot einen jammervollen Anblick. Aber der geübte Blick der Männer erkannte, dass die Krankheit selbst überwunden war. Er war nicht mehr ansteckend, man konnte ihn getrost mit den anderen Losgekauften zusammenbringen. Natürlich erkannte der halb verhungerte Mensch in dem gebräunten Mercedarier den blutjungen Nebenbuhler nicht, den er lange tot geglaubt hatte. Tränen der Freude und Dankbarkeit liefen ihm über das Gesicht, als er von seiner Befreiung hörte. Auf Arturs Bitte sollte er erst später erfahren, welcher Preis für ihn gezahlt worden war. Der Kranke war so schwach, dass man ihn auf einer Bahre zwischen zwei Pferden an die Küste tragen musste.
So wurde Artur wieder Sklave. Sogleich nahm Bibar ihn in Beschlag, obwohl das Mercedarierschiff noch vor Anker liegen musste, weil der Segelwind ausblieb. Artur machte keine Einwände. Er schien von innerem Jubel überzuströmen. Bibar hasste ihn aus seinem ganzen feigen Herzen und suchte ihn dementsprechend zu quälen. Artur verstand ihn wohl, aber er lächelte nur dazu, was Bibar fast zur Raserei brachte.
Gegen Abend kam Joas Moegh, der Wesir, nach Hause. Niemand hatte ihn erwartet, am wenigsten Bibar, dem dieses jähe Ende seiner Herrschaft gar nicht passte. Die Mercedarier aber atmete auf. Vielleicht war von diesem weitherzigen Mann mehr zu erhoffen. Artur lachte nur. Ob ihn der Wesir erkennen würde? Schwerlich, nach zehn langen Jahren! Der ganze Haushalt des Fürsten versammelte sich fackeltragend im Hof, als der Herr kam. Bibar war ihm bis vor die Stadt entgegengeritten. Die Mercedarier mussten auf ihr Schiff zurück, hofften aber, am folgenden Tag zum Wesir gerufen zu werden. Dieser war in glänzender Laune. Er hatte schöne Wochen am Hof seines Freundes verlebt und kam voll kühner Pläne in seine Heimat zurück. Das hässliche Aussehen seines Sohnes aber legte sich wie immer trüb auf seine Stimmung.
Leicht grüßend ritt er durch den Hof an seinen Sklaven vorbei, als plötzlich sein Pferd stolperte. Schnell sprang einer vor und fing das Tier im Straucheln auf. Es war Alvez. Dankend grüßte der Wesir - und erkannte ihn. Staunend, ungläubig runzelte er die Brauen und schaute ihn wieder und ein drittes Mal an. Da war er seiner Sache sicher. „Ritter Alvez“, rief er, „welches Wiedersehen? Mir scheint, Ihr drängt Euch förmlich an meinen Hof! Warum seid Ihr hier?“ Artur lächelte. „Ihr seht in mir den Ersatz für eine Pestleiche.“ Der Wesir fasste ihn an der Schulter. „Kommt mit und erklärt mir diesen Unsinn!“ und misstrauisch fiel sein Blick auf Bibar, der schwerfällig soeben von seinem Pferd herabgeglitten war.
Artur begleitete seinen Herrn in die Burg. Schon eine Stunde später, als dieser bei Tisch saß, berichtete er ihm das hier Vorgefallene. Hatte der Wesir sicher kein überzartes Gewissen, so war er doch von diesem herrenhaften Edelmut des christlichen Ritters gepackt und bewegt. Der Gedanke, einen freien Edelmann als Ersatz für einen Pestkranken zu verlangen, war ihm zuwider. Sogleich gab er Artur die Freiheit zurück und lud ihn samt allen Mercedariern am nächsten Tag zu seinem Fest ein. Ähnlich wie El-Kamir, den auch Kaiser Friedrich II. als Freund behandelte, liebte es Joas Moegh, sich mit gelehrten Männern des Abendlandes zu unterhalten und seinen Geist mit dem ihren zu messen. In ihm war die ritterliche Art der großen Araber noch lebendig. Reich beschenkt verließen Artur und die Seinen schließlich den Hof. Bibar war verdrossen in die Wüste geritten; es hatte böse Worte zwischen ihm und seinem Vater gegeben.
Ruhig und schön war die Heimfahrt der Ritter mit den Befreiten. Alvez hatte sich die Pflege Melforts ausbedungen, und der kranke Mann erholte sich zusehends unter seinen fürsorglichen Händen. Es kam auch die Stunde, da die Fesseln seines Geistes aufsprangen. In einer langen Nacht beichtete er dem Priester die Sünden seines Lebens, bezwungen von der nie endenden Gewissensnot, die ihn seit jener Blutnacht in Alvez verfolgt hatte. Da tat Artur an ihm, was Nolascus einst an ihm selbst getan hatte: Er führte eine verirrte, verzweifelte Seele zu Gott zurück. Und Maria wurde auch hier die Mittlerin der Gnaden!
Schließlich brach der ersehnte Tag an, da das Schiff den heimatlichen Hafen erreichte. Es war ein herrlich strahlender Frühlingsmorgen. Die Kunde von der Ankunft hatte sich rasch verbreitet, und viele Menschen fanden sich ein, um die Losgekauften und die Ordensritter zu begrüßen. Keine reinere Freude kannten die christlichen Länder jener Zeit, als wenn es gelungen war, einige der Geraubten der Heimat zurückzuschenken. Auch Elvira de Melfort war unter denen, die da waren.
Vorne am Schiff standen die sechs Mercedarier und sangen das Salve Regina, wie es ihre Gewohnheit war. Hinter ihnen aber waren die vielen Losgekauften, die für diese Stunde ihre Ketten wieder angelegt hatten. Jubelnde Freude strahlte auf allen Gesichtern. Das Schiff warf Anker aus, viele kleine Barkassen schwärmten heran. Es war damals wie heute, die Ungeduldigen konnten die Heimkehr der Geliebten nicht mehr erwarten. Schwestern, Mütter und Frauen der Befreiten kletterten an Bord. Auch Elvira ließ sich von einem Burschen hinausrudern, um früher den vermissten Bruder begrüßen zu können.
Melfort stieg, von Alvez geführt, die Schiffstreppe hinab zum Boot seiner Schwester. Plötzlich rief jener Ruderer in heller Freude: „Ihr, Herr, Ihr! Ich wusste ja gar nicht, dass Ihr Mercedarier geworden seid! Kennt Ihr mich noch, Juan Grant, den Ziegenhirten, Herr Artur von Alvez, kennt Ihr mich noch?“ Gerne hätte Artur dem Vorwitzigen das Wort abgeschnitten, aber es war zu spät. Mit einem Aufschrei war Melfort von ihm zurückgewichen. Elvira stand wie vom Blitz getroffen. Dunkle Glutwellen ergossen sich über die Gesichter der beiden Männer, die so bittere Gegner gewesen waren. Da streckte Alvez dem anderen die Hand entgegen. „Schlagt ein, Freund, hat uns die Madonna doch beide in Zucht und Schule genommen!“ Zögernd, ja zitternd gab Melfort ihm schließlich die Hand. „O Alvez!“ In plötzlicher Aufwallung warf er sich auf die Knie und küsste den Saum des weißen Mantels. „Melfort, lass!“, flehte Artur und drängte ihn hinüber ins Boot.
Dann kamen andere Leute; der Mercedarier konnte flüchten. Gegen Abend trafen die Ordensritter in Valencia ein. Sobald er es irgend konnte, machte Artur sich los und ging in die Gnadenkirche. Er trat an den Altar, und nachdem er ehrfurchtsvoll das Knie gebeugt hatte, küsste er das Bild Unserer Lieben Frau von Puig. Da wusste er, was es heißt, vollkommen glücklich zu sein.
Es handelt sich bei diesem Text um ein Kapitel aus dem Buch von Sophie zu Eltz, Die schweigende Königin. Marienlegenden berühmter Wallfahrtsorte, erschienen im Verlag Petra Kehl.
Themen
KloneKNA
Kommunioneinheit
Kondome
Konf.verbind. Ehen
Konklave v. KN
Konstruktivismus
Konversion
Konzil
Konzilsgeist
Konzilsstreit
Kopfstand
Korea
Kranke
Kreuz
kreuznet
Kreuzzüge
Kritik
Kruzifixurteil
Küng Hans
Le Fort
Lebensschutz
Lebensspiritualität
Lehramt
Lérins V. von
Liebe
Liebe II
Liebe III
Liebe IV
Liebe siegt
Lobpreis
LThK
Luther
Machtdiskurs
Mannheimer E.
Maria
Maria 2.0
Maribor
Mariologie
Marsch f. d. L.
Marsch II
Marsch III
Medienapostolat
Medienpolitik
Memorandum
Menschwerdung
Mercedarier
Messstipendien
Mexiko
Missbrauch
Missbrauch II
Missbrauch III
Missbrauch IV
Missbrauch V
Missbrauchsgipfel
Mission
Mission Manifest
Missionschronik
Modernismus
Morallehre
Mosebach
Moralbegriff
Morality
Mündigkeit
Mutterschaft








