zur katholischen Geisteswelt
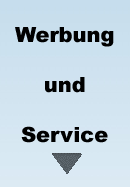
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
biographischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im dritten Teildes blauen Bereichs des PkG (Buchstaben N bis Z)
Zum ersten Teil
Zum zweiten Teil
Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum philosophischen Bereich
|
|
Zum
liturgischen Bereich |
Themen
Nächstenliebe
Normen-verschiebung
NS 1937
Offenbarung
Ökumene
Ökumene II
Osttimor
Pallium
Papst
Papstbesuch 06
Papstbesuch 11
Papstbesuch 11b
Papstrücktritt
Papstverleumdung
Paragraf 218
Parallelgesellschaft
PAS
Pastoral
Persien
Petrusbruderschaft
Phobien
PID
Pille
Pius XII.
Piusbruderschaft
Plan
Politik u. Religion
Pornographie
Portugal
Posener A.
Pränataldiagnostik
Predigtqualität
Preußen
Priester
Priester II
Priesterberuf
Priesterheiligkeit
Priesterkleidung
Primat
pro familia
Progressismus
Prometheus
Pseudotheologie
Psychotherapie
Rahner K.
Randnotizen
Ratzinger stört
Redlichkeit
Reformkirche
Religion
Religionen
Religionsfreiheit
Religionsfreiheit II
Religionsunterricht
Ring-Eifel
Rosenkranz
Rosenkranz II
Rosenkranz III
San Bartolomeo
schlechte Priester
Schöpfung
Schweden
Schweigen
Seeleneifer
Selbstbestim
Selbstgerechtigkeit
Sexualerziehung
Die hierokratische Theorie im Spätmittelalter
Ihr paradoxes Schicksal als paradigmatisches Beispiel kirchlicher Krise
Von P. Engelbert Recktenwald
Die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts steht unter dem Schatten zweier großer Auseinandersetzungen zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt. Die erste Auseinandersetzung ist die zwischen Papst Bonifaz VIII. und dem König von Frankreich Philipp IV., die zweite zwischen drei Päpsten und Ludwig dem Bayern, dessen Kaisertum von ihnen nicht anerkannt wird. Dieses gewaltige Ringen stellt den Höhepunkt des jahrhundertealten Konflikts zwischen geistlicher und weltlicher Macht dar. Dieser Konflikt wurde jedoch nicht nur politisch und militärisch, sondern auch literarisch und doktrinell ausgetragen. Auf kurialer Seite führte er zur Ausformung einer immer überspitzteren Theorie päpstlicher Herrschaftsgewalt. Anfang des 14. Jahrhunderts erreicht diese Entwicklung ihren Höhepunkt. Doch während bis zum Hochmittelalter Theorie und Wirklichkeit päpstlicher Machtansprüche miteinander Schritt hielten, bricht nun diese Konvergenz auseinander: Noch kein Jahr, nachdem Bonifaz VIII. in der Bulle "Unam sanctam" (18. November 1302) die päpstlichen Machtansprüche auf ihren Höhepunkt getrieben hat, offenbart der Überfall von Anagni (7. September 1303) die politische Ohnmacht des Papsttums und leitet die Phase der Abhängigkeit vom französischen König ein, die ihren Niederschlag im avignonesischen Exil (1309 - 1377) findet. Dieses bildet den realpolitischen Hintergrund der tragischen Auseinandersetzung dreier Päpste mit Ludwig dem Bayern. Diese Tragik gewinnt ihre Schärfe nicht zuletzt durch das Interdikt, welches Johannes XXII. 1323 über ganz Deutschland verhängte. Das Interdikt dauerte bis 1347 und stürzte die Kirche Deutschlands in tiefste geistliche Not. Es macht blitzartig die widersprüchliche Situation deutlich, in die das päpstliche Selbst- und Machtbewußtsein sich hineingesteuert hat.
Wir wollen im ersten Teil die mittelalterliche Entwicklung der Zweigewaltenlehre überblicken, um im zweiten Teil den ideengeschichtlichen Hintergrund der hierokratischen Theorie auszuleuchten und zu untersuchen, wie dieser Theorie ihre paradoxe Rolle zufallen konnte. Während sie inhaltlich anscheinend eine kontinuierliche Fortführung erfuhr, wirkte sie sich plötzlich in eine ihrem Anspruch entgegengesetzte Richtung aus: Sie verhinderte nicht die Krise, sondern verfestigte sie. Von der Untersuchung dieses eigenartigen Mechanismus dürfen wir uns auch Aufschluß zum größeren Verständnis gegenwärtiger Krisensymptome in der Kirche erwarten.
I. Die Entwicklung der Zweigewaltenlehre bis zu Papst Bonifaz VIII.
Die Zweigewaltenlehre des Mittelalters fand ihre Ausformung vor allem in der Gestalt der Zweischwerterlehre, die sich auf eine allegorische Deutung von Lk. 22, 35-38 stützte. Dabei kam die Dualität der beiden Schwerter zunächst dem Dualismus entgegen, der von kaiserlicher Seite aus immer wieder gegen die päpstlichen Anspruchssteigerungen ins Feld geführt wurde. Heinrich IV. führte die Stelle gegen Gregor VII. an, ebenso wie der prokaiserliche Sigebert von Gembloux OSB (+ 1112) gegen Paschalis II. und später Friedrich Barbarossa, Friedrich II., die Parteigänger Philipps IV. und Dante. Dieser Dualismus war ursprünglich - in der Abweisung cäsaropapistischer Tendenzen des oströmischen Kaisertums - auch das Anliegen der Päpste gewesen und von Papst Gelasius I. in seinem berühmten "Duo quippe"-Brief an Kaiser Anastasius im Jahre 494 auf seine klassische Formulierung gebracht worden. Deshalb sollte es nicht wundernehmen, daß ausgerechnet Petrus Damiani, ein Vorkämpfer der kirchlichen Reformbewegung des 11. Jahrhunderts, es ist, der zum ersten Mal die beiden lukanischen Schwerter auf die weltliche und geistliche Macht verteilt. Ein anderer Reformer allerdings, Kardinal Humbertus von Silva Candida, stellt die Weichen für die spätere Entwicklung, wenn er um das Jahr 1058 die These aufstellt, daß die principes ihr Schwert von den Priestern Christi empfangen. Klassisch und Gegenstand vieler Kommentare wird der Text des hl. Bernhard von Clairvaux (um 1090 - 1153), der beide Schwerter der Kirche zuspricht, das eine pro, das andere ab ecclesia zu führen.
Zweifellos sind diese Texte jedoch noch nicht in jenem Sinne zu lesen, wie sie später von kurialer Seite ausgewertet werden, nämlich als streng rechtliche Vollmacht über die Vergabe des Kaisertums. Es geht vielmehr um eine ideale Zuordnung der Gewalten und um die Einordnung des Gebrauchs der weltlichen Gewalt in die christliche Gesamtordnung. Aus diesem Grunde sprechen Humbertus und Bernhard abstrakt vom Schwert des Priesters, nicht des Papstes. Erst unter Innozenz III. werden aus Texten wie denen Bernhards juristische Kompetenzen abgeleitet.
Es lassen sich ab dem 12. Jahrhundert zwei Traditionslinien unterscheiden: die theologische und die kanonistische. Dabei hält die kanonistische Linie bezeichnenderweise weitaus länger am Dualismus fest als die theologische. Letztere entwirft ein ideales Bild der Christenheit, erstere hat es mit den konkreten Realitäten zu tun. Aus diesem Grund neigt die theologische Linie, repräsentiert etwa durch Hugo von St. Victor und Johannes von Salisbury, zur Herausarbeitung einer geschlossenen Einheit der christlichen Heilsordnung, neben der kein Platz mehr ist für eine selbständige politische Gewalt. Diese wird zu einem Moment innerhalb der Kirche herabgedrückt. Deutlich wird dies etwa formuliert von Hugo von St. Victor (+ 1141), der daraus auch das Absetzungsrecht der "spiritualis potestas" - wiederum das Abstractum statt des Papstes! - ableitet. Demgegenüber war die kanonistische Tradition lange Zeit weitaus vorsichtiger. So wurde etwa von den Glossatoren des Decretums Gratiani das Recht der Thronenthebung, das Papst Gregor VII., sich auf das historische Vorbild des Papstes Zacharias' stützend, der den Frankenkönig abgesetzt habe, beanspruchte, stets abschwächend interpretiert: Die Thronenthebung sei eine Folge der Exkommunikation (so Gratian), der Papst habe nicht abgesetzt, sondern der Absetzung nur zugestimmt (so Simon von Bisignano, Schüler Gratians). Nach Huguccio, dem "Meister der Dekretisten" (+ 1215), sind beide Gewalten "quoad institutionem" voneinander unabhängig. Einig war man sich auch lange Zeit darin, daß man nicht vom weltlichen Richter an den Papst appellieren könne, ein Grundsatz, an dem noch Papst Alexander III. (1159-1181), der erste große Kanonist auf dem päpstlichen Stuhl, festhielt. Richard Anglicus, ein englischer Kanonist, der Ende des 12. Jahrhunderts in Bologna, der bedeutendsten mittelalterlichen Kanonistenschule, lehrte, geht in einer ausführlichen Quaestio auf die Zweischwerterlehre ein und verteidigt den Dualismus ausdrücklich gegen die entgegengesetzten Thesen. Der Grundsatz Alexanders III. ist für ihn ein Argument dafür, daß der weltliche Herrscher sein Schwert nicht vom Papst empfangen hat, sondern von Gott allein.
Doch bald wendet sich das Blatt, und zwar durch Innozenz III. (1198-1216), einem Schüler Huguccios. Er verbindet die theologische Tradition mit der kanonistischen, wertet sie kanonistisch aus und setzt ihre Aussagen in rechtliche Machtansprüche des Papstes um. Dabei bleibt der Dualismus im Prinzip erhalten, doch "ratione peccati" werden dem Papst Eingriffsmöglichkeiten in die weltliche Herrschaftsführung eröffnet. Damit wird dem Papst die Urteilsbefugnis und Richtermacht über den rechten oder unrechten Gebrauch der potestas temporalis eingeräumt. Dies ist der entscheidende Ansatz zur Lehre über die potestas indirecta in temporalibus, die von den Dekretalisten des 13. Jahrhunderts weiter ausgebaut wird und einen fließenden Übergang zur potestas directa ermöglicht. Alanus Anglicus, zu Beginn des 13. Jahrhunderts Kanonist in Bologna, ist der Vorreiter der neuen Position. Der Papst ist "iudex ordinarius imperatoris et quoad temporalia et quoad spiritualia". Deshalb kann der Papst den Kaiser auch im Notfall absetzen. Der Kaiser hat sein Schwert vom Papst. Nach Johannes Teutonicus kann der Papst den Kaiser wegen Häresie und anderer "iniquitates" absetzen, nach Gottfredo von Trani (+ 1245), einem Kanonisten in Bologna, wegen Häresie und dem Versäumnis, gegen Häretiker vorzugehen. Einen weiteren Schritt vollzieht Innozenz IV. (1243-1254), der dem Papst, den vicarius-Christi-Titel auswertend, prinzipiell dieselbe Machtstellung dem Kaiser gegenüber zuspricht wie Christus selbst, der "iure naturali" den Kaiser und alle anderen Herrscher absetzen kann. Diese Theorie findet Eingang in die kanonistische Tradition, vor allem durch Heinrich von Segusia (Hostiensis, + 1270), den "monarcha iuris utriusque".
Eine ebenso große Bedeutung wie die Unterscheidung von direkter und indirekter Gewalt in temporalibus gewinnt die Unterscheidung zwischen dem Besitz des weltlichen Schwertes und seinem Gebrauch. Wenn auch dem Kaiser die executio des Schwertes zukommt, so bleibt es doch stets im rechtmäßigen Besitz des Papstes. Bedeutet dies nun, daß der Kaiser seine Gewalt nur über die Kirche empfängt? Die Antworten fallen verschieden aus. Wie fließend die Übergänge sind, zeigt etwa die Auskunft Bernhards von Botone, des bedeutendsten Glossators des Liber Extra, aus der Mitte des 13. Jahrhunderts: Zunächst hält er daran fest, daß das Imperium allein von Gott ausgeht, dann aber läßt er den Kaiser von der Kirche die "executio gladii temporalis" empfangen. Der Papst hat also doch beide Schwerter und besitzt deshalb gegenüber dem Kaiser das Konfirmations-, Konsekrations-, Krönungs- und Absetzungsrecht. Der Dualismus wird immer mehr verdrängt zugunsten der hierokratischen Theorie, die beide Schwerter dem Papst zuspricht und die Herrschaft des Kaisers bzw. des Königs in eine immer größere Abhängigkeit vom Papst bringt. Wir befinden uns hier in einer Zeit, in der auch realpolitisch das Papsttum sich auf einem Höhepunkt befand: 1245 setzt Innozenz IV. den Staufer Friedrich II. ab, 1279 akzeptiert Rudolf von Habsburg die päpstliche Theorie.
Neue Anstöße empfängt die Diskussion durch das Vordringen des Aristotelismus. 1260 übersetzt Wilhelm von Moerbecke die "Politik" des Aristoteles. Sie wird als erstes kommentiert von Albert dem Großen und Thomas von Aquin. Wir können nun die interessante Beobachtung machen, daß das aristotelische Gedankengut sowohl von den Dualisten wie von deren Gegnern für die jeweils eigene These ausgewertet wird. Auf der einen Seite fördert der Aristotelismus eine natürliche Sicht des Staates, die dessen Eigenständigkeit in einem positiven Sinne anerkennt. Der Staat ist nicht mehr bloß ein notwendiges Übel infolge der Erbsünde, das erst durch die Kirche, d.h. durch die Integrierung in die übernatürliche Heilsordnung, geheilt werden kann. Das war die augustinische Konzeption des Staates. Nun rückt der Mensch als ein animal sociale ins Blickfeld. Der Staat ergibt sich aus der Natur des Menschen und hat deshalb eine Daseinsberechtigung und einen positiven Wert vor und unabhängig von der christlichen Heilsordnung. Auf der anderen Seite machen sich die Gegner des Dualismus die aristotelische Lehre von der Hierarchie der Zwecke zunutze. Wenn irgendeinmal dem Menschen ein Ziel vorgegeben wird, das über das natürliche Ziel des Staates hinausliegt, dann kann dieses gar nicht anders, als jenem sich unterzuordnen. Gerade die aristotelische Zwecklehre schließt ein Fortdauern der Autonomie des Staatszweckes aus. Die aristotelische Eigenständigkeit des Staates kann - auch und gerade mit Aristoteles selber - nur solange anerkannt werden, solange in der Menschheitsgeschichte kein höheres, übernatürliches Ziel auftaucht. So sehr ein solches außerhalb des Blickfeldes des Aristoteles lag, so selbstversändlich ist es allen Diskussionsteilnehmern unseres Zeitraumes bis zum Ausgang des Mittelalters. Von daher erklärt sich die ambivalente Wirkung des Aristotelismus in der mittelalterlichen Diskussion über das Verhältnis von zeitlicher und geistlicher Gewalt.
Es sieht so aus, als ob in der Synthese des heiligen Thomas von Aquin OP (1225-1274) die berechtigten Anliegen beider Seiten für einen weltgeschichtlichen Augenblick zu einer ausgewogenen Balance gefunden hätten. Daraus ließe sich auch die gegensätzliche Wertung erklären, die Thomas in der Forschung findet. John A. Watt etwa sieht ihn in einer Linie mit den hierokratischen Ansprüchen Bonifaz VIII., Fritz Bleienstein dagegen betrachtet ihn als den entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der politischen Theorie, der der Anerkennung der relativen Selbständigkeit des Staates zum Durchbruch verholfen habe. [1] Nach Thomas ist der Staat eine Gesellschaftsform, die sich aus der Natur des Menschen ergibt und einen natürlichen Zweck verfolgt. Dieser Zweck ist das irdische Glück des Menschen durch ein tugendhaftes Leben. Dem Grundsatz gemäß, daß die Gnade die Natur nicht zerstört, bleibt dieser dem Staat eigentümliche Zweck auch im Neuen Bund bestehen. Doch im Neuen Bund obliegt es den Priestern, die Menschen zu einem übernatürlichen Ziel hinzuführen. Diesem Ziel muß auch das Staatsziel untergeordnet werden. Aus diesem Grund müssen die Könige dem Papst unterworfen sein wie Christus selbst. Wie diese Unterwerfung unter die geistliche Gewalt mit der relativen Eigenständigkeit der zeitlichen Gewalt harmonisierbar ist, läßt Thomas offen. In dieser offen gelassenen Spannung aber liegt der Keim zu jener maßvollen Theorie der potestas indirecta in temporalibus, zu deren reiferen Ausbildung der Weg erst durch den Zusammenbruch der päpstlichen Machtansprüche freigelegt wurde.Unmittelbarer Vorläufer zur hierokratischen Theorie ist schließlich Tholomeus von Lucca OP (1236-1326/27). Seine "Determinatio compendiosa" aus dem Jahre 1280 denkt die Approbationstheorie konsequent zuende. Die kaiserliche Herrschaft gerät in eine so prinzipielle Abhängigkeit vom Papst, daß dieser die freie Verfügung über das Reich besitzt. Der Papst hat gegenüber dem Kaiser nicht nur das Approbations-, sondern auch das Ernennungsrecht. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, die zur letzten Steigerung und Übersteigerung päpstlichen Machtanspruchs im großen Doppelkonflikt mit Philipp IV. und Ludwig dem Bayern führen.
II. Die hierokratische Theorie zu Anfang des 14. Jahrhunderts
Man kann im propäpstlichen Lager zwei Richtungen unterscheiden, eine extreme und eine gemäßigte. Die extreme Richtung ist die hierokratische, die die potestas directa des Papstes in temporalibus immer ungehemmter ausbaut. Die gemäßtigte versucht, die Kontinuität mit der von Gelasius herkommenden Tradition zu wahren und beschränkt die Oberhoheit des Papstes auf eine potestas indirecta in temporalibus. Dabei bleibt der Vorrang der geistlichen Gewalt gewahrt, und je nachdem, wie sehr er betont und auf welche Weise die Fälle bestimmt werden, in denen die potestas indirecta zum Zuge kommt, kann diese Konzeption sich sehr stark der extremen Richtung nähern.
Die theologische Speerspitze des propäpstlichen Lagers stellt der Orden der Augustinereremiten. In der Auseinandersetzung zur Zeit Ludwigs steht er - von der bayerischen Provinz abgesehen - treu dem Papst zur Seite. Zwei seiner Ordensgeneräle, Alexander a San Elpidio (1312-1326) und Wilhelm von Cremona (1326-1342) sind scharfe literarische Verfechter der päpstlichen Oberhoheit über die weltliche Gewalt. Die bedeutendsten Theoretiker der hierokratischen Theorie sind jedoch die beiden Augustinereremiten Aegidius Romanus OESA und Augustinus von Ancona OESA, genannt Augustinus Triumphus. Aegidius Romanus (ca. 1243-1316), persönlicher Schüler Thomas' von Aquin, seit 1287 offizielle Lehrautorität des Ordens, 1296 von Bonifaz VIII. nach Rom zum Beistand im Konflikt mit Philipp IV. gerufen und Mitwirkender bei der Abfassung von "Unam sanctam", hat die Gewaltenfülle des Papstes in seinem Werk "De ecclesiastica potestate" (1301) am radikalsten zu Ende gedacht. Was die systematische Entfaltung und Fundierung der hierokratischen Theorie angeht, so gebührt die erste Stelle jedoch Augustinus Triumphus (1243-1328). Seine monumentale "Summa de ecclesiastica potestate" entstand ca. 1325 anläßlich des "Defensor pacis" des Marsilius von Padua. Erwähnt werden muß hier auch Jakob von Viterbo OESA, der mit seinem Traktat "De regimine christiano" (1302) in die Fußstapfen des Aegidius Romanus tritt, allerdings in der Beschreibung der päpstlichen Gewaltenfülle infolge aristotelischen Einflusses maßvoller ist.
Die zweite große Summa aus jener Zeit neben der des Augustinus Triumphus stammt von einem kanonistisch gebildeten Franziskaner, Alvaro Pelayo (latinisiert Alvarus Pelagius, 1275/80-1350). Er schrieb seine "Summa de planctu Ecclesiae" im Auftrag Johannes' XXII. und steht teilweise in wörtlicher Abhängigkeit von Jakob von Viterbo.
Andere Vertreter der hierokratischen These, die hier lediglich erwähnt werden sollen, sind die Franziskaner Matthäus von Aquasparta, Vitalis de Furno, Guilelmus de Sarzano, Andreas und Franciscus Toti de Perusio, die Dominikaner Guido Vernani von Rimini, Galvaneus Flamma, Hervaeus Natalis und Johannes de Regina von Neapel, und schließlich die Weltkleriker Opicinus de Canestris, Egidius Spiritalis de Perusio und Heinrich von Cremona (+ 1312). Letzterer rühmt sich, als erster die Lehre von der direkten zeitlichen Gewalt des Papstes formuliert zu haben.
Als Verfechter der potestas indirecta gehören zur gemäßigten Richtung des propäpstlichen Lagers die Dominikanertheologen Petrus de Palude und Remigius Girolami von Florenz, der Karmelit Sybert von Beek und der Prämonstratenser Petrus de Lutra. Der Dominikaner und Thomist Johannes Quidort von Paris (+ 1306) ist durch seinen Dualismus schon ein Verteidiger der weltlichen Gewalt, nämlich des französischen Königs, gegen die Machtansprüche des Papstes, ebenso Dante (1265-1321) und Wilhelm von Ockham OFM (um 1285-1347). Marsilius von Padua dagegen verläßt in seinem "Defensor pacis" (1324) bereits die dualistische Tradition und stellt der hierokratischen Theorie einen Cäsaropapismus gegenüber, der den göttlichen Ursprung des Papsttums ableugnet und die Kirche, indem ihr jede potestas coactiva abgesprochen wird, ganz der Herrschaft des Kaisers unterwerfen will. Auch die Vorstellung eines normativen Naturrechts gibt er auf.
Doch geht es uns hier weniger darum, den genauen Verlauf der Kontroverse zu verfolgen, als vielmehr den ideengeschichtlichen Hintergrund der hierokratischen Theorie zu untersuchen, um zu erkennen, wie sie ihren Charakter unter der Hand auf eine Weise ändert, daß sie eine der ursprünglichen Intention genau entgegengesetzte Wirkung entfaltet.
Welches sind die Argumente, die die Hierokraten für ihre Theorie ins Feld führen? Die biblische Argumentation ist für die Zeitgenossen unserer Kontroverse eine Selbstverständlichkeit, da für sie als gläubige Christen die göttliche Offenbarung eherne Norm des Denkens ist. Da jedoch die Ablehnung des Dualismus eine Neuerung gegenüber der traditionellen Auffassung darstellte, für deren Anhänger dasselbe gilt, kommen hier die biblischen Texte nicht als eigentlich inspirierende Quelle für die neuen Anschauungen in Betracht. Vielmehr erfahren umgekehrt die klassischen Bibelstellen im Lichte der neuen Theorie eine neue Deutung. Ein Beispiel ist die Deutung von Mt. 16, 19: "Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis; et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis." Dieses Wort Christi an Petrus wurde stets im Sinne der geistlichen Jurisdiktion innerhalb der sichtbaren Kirche verstanden. Papst Innozenz IV. leitet daraus aber eine Urteilsbefugnis über die rechte Amtsführung des Kaisers ab und damit die Vollmacht, den Kaiser abzusetzen, wenn er sich in den Augen des Papstes als seines Kaisertums unwürdig erweist. In seiner Absetzungsbulle "Ad apostolicae dignitatis" vom 17. Juli 1245 beruft er sich ausdrücklich auf diese Stelle. Später wird das Binden und Lösen auf Erden wie selbstverständlich im Sinne einer iurisdictio temporalis verstanden, z.B. schon von Tholomeus von Lucca OP. Die Gegner der potestas directa in temporalibus dagegen erinnern an die alte Deutung, z.B. Remigius Girolami und Dante: Mt. 16, 16-19 beziehe sich auf die geistlichen Dinge. Remigius verweist im Gegenzug auf Mt. 22,21: "Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist", Dante auf Joh. 18,36: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt." Dieses dialektische Wechselspiel im Beibringen von Schriftzitaten ließe sich noch an vielen anderen Beispielen illustrieren. Wichtig für uns ist hierbei die Erkenntnis, daß in den meisten Fällen die bereits anderweitig gewonnene Überzeugung es ist, die darüber entscheidet, welche Deutung man den einzelnen Schriftaussagen gibt, welchen man die entscheidende Beweiskraft zuspricht und welche man in ihrer Bedeutung gegenüber der anderen relativiert.
Dennoch soll noch auf eine Schriftstelle eingegangen werden, nämlich auf Joh. 21,17: "Pasce oves meas." Hier überträgt der Herr dem Petrus auf feierliche Weise durch dreimalige Wiederholung die allgemeine Hirtengewalt über seine Schafe. Wenn nun Guido Vernani beispielsweise zu diesen Schafen auch den Kaiser zählt, dann knüpft er damit an eine alte Tradition an. Ist nicht dasselbe gemeint, wenn etwa schon Ambrosius den Kaiser einen Sohn der Kirche nannte und ihn in der bekannten Episode von 390 wegen des Gemetzels in Thessalonich der Bußgewalt der Kirche unterwarf? Genau dieser Sachverhalt aber war das Einfallstor für jene Konzeption der Eingriffsmöglichkeit "ratione peccati", die von den Kanonisten immer mehr zu einer ordentlichen rechtlichen Kompetenz ausgebaut wurde. Bei dem Kanonisten Rufin (+ um 1192) handelt es sich noch um eine reine Buß- und Absolutionsgewalt des Papstes über die Person des weltlichen Herrschers. Bei Innozenz III. aber wird sie bereits zum Examinations- und bei Innozenz IV. zum Absetzungsrecht. Der Umschlag zur potestas directa in temporalibus ist schließlich sehr schön zu beobachten bei Matthäus de Aquasparta. Er spricht dem Papst bereits allgemein die Urteilsbefugnis ratione peccati "de omni temporali" zu, um unmittelbar zur Unterscheidung zwischen executio und Besitz der zeitlichen Jurisdiktionsgewalt de iure überzugehen: "de omni temporali habet cognoscere summus pontifex et iudicare ratione peccati. Unde dico quod iurisdictio temporalis potest considerari vel prout competit alicui ratione actus et usus, vel prout competit summo pontifici, qui est vicarius Christi et Petri, de iure." Die Unterscheidung zwischen Besitz und Ausübung der Gewalt wird dann typisch für die hierokratische Theorie.
Dieses Beispiel soll zeigen, wie ein ursprünglich richtig gesehener Sachverhalt, sobald seiner Deutung eine bestimmte Richtung gegeben wird, eine Eigendynamik entfalten kann, die die Behandlung eines Problems immer mehr unter die Herrschaft der eigenen Perspektive reißt, so daß er zum alles beherrschenden und einzig entscheidenden Faktor der Untersuchung wird. Dies gilt nun in besonderem Maße für zwei Begriffe, aus denen heraus die hierokratische Anschauung immer stringenter entwickelt wird: der Papst als "vicarius Christi" und seine "plenitudo potestatis." Alle Hierokraten schlachten diese Begriffe in ihrem Sinne aus, indem sie ihnen einen Sinn unterlegen, der die Grenzen der ursprünglichen Bedeutung überschreitet. Die "plenitudo potestatis" deuten sie so, daß sie auch die direkte zeitliche Gewalt umfaßt. Dies wird von Jakob von Viterbo gerade mit dem vicarius-Christi-Titel begründet. Nach Aegidius Romanus kann der Papst wie Christus sprechen: "Data est mihi omnis potestas in celo et in terra" (Mt. 28,18), denn: "In potestate summi pontificis continetur omnis potestas sacerdotalis et regalis, celestis et terrena" (De ecclesiastica potestate, III, 10, S. 197). Bei Egidius Spiritalis wird die plenitudo potestatis zu einer absolutistischen Willkürherrschaft, die außer an den Glauben an kein Recht gebunden ist. Was dem Papst gefällt, hat Gesetzeskraft, denn: "apud eum erit pro ratione voluntas."
Wenn auch "vicarius Christi" und "plenitudo potestatis" die beiden Schlüsselbegriffe in der hierokratischen Argumentation darstellen, so ist dennoch damit noch nicht die tiefste theologische Wurzel des hierokratischen Systems angesprochen. Das ist vielmehr der Augustinismus.
Mit "Augustinismus" ist hier jene theologische Richtung gemeint, die im engen Anschluß an die Gnadenlehre des hl. Augustinus so sehr von der Notwendigkeit der Gnade überzeugt ist, daß ohne sie der Mensch vor Gott zu nichts Gutem fähig ist. Die Verderbnis seiner Natur infolge des Sündenfalls reicht so tief, daß der Mensch selbst zur Wiederherstellung einer rein natürlichen Integrität vollständig auf die Heilung durch die Gnade angewiesen ist. Sünde oder Gnade lautet die Alternative. Ein Zwischenbereich des bloß Natürlichen und Naturrechtlichen existiert nicht. Der entscheidende Gedankengang besteht nun in der Anwendung dieser Theologie auf die Frage des dominiums. Am konsequentesten ist dabei Aegidius Romanus vorgegangen. Nach ihm haben wir durch die Erbsünde - wie auch durch die persönliche Sünde - jedes Besitzrecht verloren. Herrschaft, "potestas", faßt Aegidius nach Analogie des Besitzrechtes ("possessio") auf, der Mittelbegriff ist "dominium." Durch die Sünde verliert der Mensch jedes Eigentumsrecht, und das heißt gleichzeitig: jede potestas. Der einzige Weg aber vom Zustand der Sünde in den der Gnade führt über die Taufe, dem "remedium contra originale", bzw. über das Bußsakrament, dem "remedium contra peccatum actuale", und das heißt: über die Kirche. "Nullus efficitur dignus dominator nec dignus princeps nec possessor rerum, nisi sub ecclesia et per ecclesiam." [2] Folglich ist die Verleihung durch die Kirche der einzige Weg, in den rechtmäßigen Besitz einer Sache zu kommen. Die Kirche selber hat also im eigentlichen Sinn das Eigentumsrecht und die höchste Herrschaft über alle Temporalia. Der Begriff der "Kirche" ist aber bei Aegidius austauschbar mit dem des Papstes. Und so gilt für die "potestas summi sacerdocii": "sic habet imperium super temporalibus, quod dominus temporalium dici debet" (ebd. II, 10, S. 91). Der Kirche kommt auch das "iudicare de iusta et iniusta possessione quarumcumque rerum" zu. Da auch die potestas unter die Kategorie des dominiums fällt, ergibt sich die Folgerung für jeden weltlichen Herrscher von selbst. Aegidius drückt es in unerbittlicher Prägnanz aus: "nullus princeps erit dignus et verus princeps, nisi sit per ecclesiam regeneratus spiritualiter, et si incidat in peccatum mortale, nisi sit per ecclesiam absolutus sacramentaliter" (ebd. III, 2, S. 154). Der Papst ist - wie Gott - Quelle aller Gewalt. Er ist vicarius Dei.
So absorbiert bei Aegidius Romanus die Überzeugung von der Notwendigkeit der Heilsvermittlung durch die Kirche jeden Gedanken an ein natürliches Rechts- und Herrschaftssystem. Bei anderen Hierokraten wie Jakob von Viterbo, Alvarus Pelagius und Augustinus Triumphus wird diese Überzeugung etwas abgemildert durch die Konzeption der naturrechtlichen Begründung des Staates. Jakob von Viterbo beruft sich für seine These, daß die Gesellschaftsordnung sich aus der natürlichen Neigung der Menschen ergäbe, ausdrücklich auf Aristoteles. Deshalb kann es für ihn bei den Ungläubigen in beschränktem Maße gerechte Herrschaft geben. Auch für Alvarus Pelagius, der sehr von Jakob abhängig ist, ergibt sich der Staat aus der sozialen Natur des Menschen. Die weltliche Gewalt kommt von Gott "mediante natura hominum." Doch durch die Tatsache des Sündenfalls wird die Bedeutung dieses Gedankens wieder relativiert: Im Urstand gab es nur Gemeineigentum. Das individuelle Eigentum ist Folge der Erbsünde. Die Herrschaft der heidnischen Gewalthaber beruht auf Usurpation. Schließlich finden wir auch bei Augustinus Triumphus die Anerkennung des natürlichen Ursprungs des Staates. Das naturale regimen gehört zu den beneficia naturalia. Diesen Charakter bewahrt es selbst nach der Erbsünde. Deshalb ist es auch möglich, daß die Ungläubigen etwas ohne Sünde besitzen. Hier steht Augustinus Triumphus in direktem Gegensatz zu Aegidius Romanus.
Dennoch spielen alle diese Abmilderungen, die sich bei den drei Genannten im Gegensatz zu Aegidius finden, keine Rolle, sobald es sich um die Frage des Verhältnisses der kirchlichen bzw. päpstlichen Gewalt zur weltlichen handelt. Denn in diesem Falle befinden wir uns in der christlichen Heilsordnung, innerhalb derer es keinen eigenständigen, bloß naturalen Bereich geben kann. Die abmildernden Gedankengänge greifen hier nicht mehr. Die Natur des Menschen als animal sociale vermag nach Jakob von Viterbo nur "materialiter et inchoative" die weltliche Gewalt zu begründen, "perfective und formaliter" hängt sie von der geistlichen Gewalt ab. Wahre Herrschaft kann es deshalb in der Zeit nach Christus nur infolge der Verleihung durch die Kirche geben. Der Kirche ist alle Gewalt, auch die königliche, von Gott übertragen. Alvarus Pelagius übernimmt wörtlich die Unterscheidung materialiter/inchoative und formaliter/perfective. Nach ihm wurde den Heiden bei der Ankunft Christi das dominium entzogen. Christus vereinigte alles dominium in sich und übertrug es seinerseits dem Petrus. Jede weltliche Gewalt wird deshalb seit Christus von der Kirche eingesetzt. Augustinus Triumphus, der als Verfasser von Aristoteleskommentaren noch am meisten um einen Ausgleich mit dem aristotelisch-thomistischen Gedankengut bemüht ist, geht von den dreien am weitesten in der Einbeziehung der naturrechtlichen Konzeption weltlicher Gewalt, ohne jedoch den Kern der hierokratischen Theorie zu gefährden. Er schränkt die Herrschaft des Papstes gegenüber den Heiden so weit ein, daß er für ihn ein Eingriffsrecht nur vorsieht, wenn die heidnischen Gebräuche den christlichen Glauben stören. Der Grundsatz "potestas iurisdictionis omnium spiritualium et temporalium est solum in papa", den er am Anfang seiner Summa aufstellt, gilt offensichtlich nur innerhalb der Christianitas. Innerhalb ihrer ist der Papst der "vicarius dei". Aber auch als solcher ist er an das Naturrecht gebunden: "papa non tollit ius naturae, sed loco dei transgressores iuris naturalis punit." Gesetze des Kaisers empfangen erst durch päpstliche Autorität ihre "robur et firmitas", aber wenn der Papst kaiserliches Recht korrigiert, dann ist auch er an die "utilitas rei publicae" als vorgegebene Norm gebunden. Somit handelt es sich bei der Konzeption des Augustinus Triumphus um den intensivsten Versuch, den naturrechtlichen Ansatz des Aristoteles in die hierokratische Theorie zu integrieren. Die plenitudo potestatis des Papstes wird nicht in dem Sinne eingeschränkt, daß ihr innerhalb der Christenheit ein eigenständiger Bereich entzogen wäre, der dem Inhaber der weltlichen Gewalt vorbehalten wäre, sondern ihr Gebrauch auf seiten des Papstes wird an die vorgegebene naturrechtliche Norm gebunden. So kann Augustinus das thomistische Axiom "gratia non tollit naturam" integrieren, ohne daß sein System in einen Dualismus umkippt.
Die Tatsache, daß es überhaupt einen vom Papst verschiedenen Inhaber weltlicher Gewalt gibt, wird bei allen Hierokraten durch die Unterscheidung zwischen dem rechtmäßigen Besitz des zeitlichen Schwertes und seiner executio erklärt. Der Papst hat dem Kaiser die Führung des Schwertes überlassen "ad nutum sacerdotis", wie die Formel seit Bernhard von Clairvaux lautet. Er kann es aber wieder an sich ziehen, d.h. in praxi: in die Herrschaftssphäre des Kaisers bzw. Königs durch konkrete Maßnahmen eingreifen. Seit Innozenz III. ist das Eingreifen "ratione peccati" von Seiten des propäpstlichen Lagers allgemein anerkannt. Die Dekretale Innozenz' III. "Qui filii sunt legitimi" sieht die unmittelbare executio der zeitlichen Gewalt "certis causis inspectis" vor. In der Interpretation dieser Fälle gibt es unzählige Varianten. Wir brauchen nicht im Detail auf sie einzugehen. Daß von einem Aegidius Romanus eine möglichst weitgehende Interpretation zu erwarten ist, dürfte klar sein. Er widmet dieser Frage in seinem Traktat gleich drei Kapitel und unterscheidet zehn Fälle. Zum Beispiel kann nach ihm der Papst dann eingreifen, wenn kaiserliche Gesetze schwer zu erfüllen oder wenn sie zweideutig sind. Denn dem Papst kommt die Interpretation der Gesetze zu. Die Fälle, die Alvarus Pelagius vorsieht, übernimmt er von Jakob von Viterbo. Der Papst darf eingreifen in Zehntfragen, Eherecht, in Appellationsfällen, bei Gefahr für den Frieden und wegen eines defectums der weltlichen Gewalt. Dennoch nimmt Alvarus eine gewisse Sonderstellung ein. Denn als Franziskaner ist er gleichzeitig Anhänger des Armutsideals. Diese Perspektive prägt den zweiten Teil seiner Summa. Er betont hier ganz den spirituellen Charakter des Reiches Christi, das weder material noch kausal von dieser Welt sei. Deshalb ist für ihn die Weitergabe der executio gladii an die weltliche Gewalt nicht bloß eine Frage der decencia, wie es etwa bei Aegidius Romanus manchmal erscheint, sondern eine strenge Forderung der Würde der geistlichen Gewalt und des ordo potestatum.
Wir haben den Augustinismus als den theologischen Nährboden für die Ausbildung der hierokratischen Theorie namhaft gemacht. Dadurch wird auch verständlich, weshalb diese Theorie vor allem im Orden der Augustinereremiten und der Franziskaner heimisch werden konnte, die ja beide der augustinischen Tradition sehr verbunden sind. Für diese Richtung spielte der Aristotelismus keine so große Rolle wie im Dominikanerorden, nachdem dessen größter Theologe Thomas von Aquin Aristoteles rezipiert hatte. Gerade deshalb war seinerseits die Philosophie des Dominikanerorden von der Streitfrage über die potestas directa viel mehr betroffen und der Orden war in dieser Frage geteilt. Das aristotelische Gedankengut nicht nur als Steinbruch von Argumenten für vorgegebene eigene Thesen zu benutzen, sondern seinen Kerngedanken gerecht zu werden, bedeutet die potestas directa des Papstes in temporalibus abzulehnen zugunsten der Anerkennung der relativen Selbständigkeit der weltlichen Gewalt. Das wurde zum Anliegen z.B. eines Johannes Quidort OP. Lag eine solche Einstellung zu Aristoteles nicht vor, dann kam, wie bereits im ersten Teil bemerkt, jedem Hierokraten ein Gedanke des Aristoteles in besonderer Weise entgegen: der der Hierarchie aller Künste und Wissenschaften, die notwendigerweise alle einem einzigen Zweck untergeordnet sein müssen. Sobald dieser Zweck gegeben ist, erhalten alle Künste mit untergeordnetem Zweck ipso facto einen Instrumentalcharakter in Bezug auf jene Kunst, der der höchste Zweck eigen ist.
Dies ist so ziemlich der einzige Gedanke, den Augustinus Triumphus ausdrücklich von Aristoteles übernimmt. Im ersten Artikel der Quaestio 35, in dem es um die Frage geht, ob der Papst "per se ipsum" den Kaiser erwählen könne, bringt Augustinus die entsprechende Stelle aus dem ersten Buch der "Nikomachischen Ethik" bei: Die Kriegskunst wähle sich die Reitkunst oder das Sattlerhandwerk zur Erlangung des Sieges, also des ihm eigenen Zweckes, aus, je nachdem es ihr dafür zuträglich erscheine oder nicht. Da aber für Augustinus der Kaiser durch göttliche Anordnung der "minister summi pontificis" ist, kann er diesen Grundsatz ohne weiteres auf das Verhältnis Papst/Kaiser anwenden. So kommt dieser aristotelische Gedanke auf willkommene Weise dem großen Einheitsideal entgegen, das schon immer die christliche Theologie durchzogen hat.
Dennoch besteht zwischen der Einheit der christianitas, die einem hl. Bernhard von Clairvaux oder einem Hugo von St. Viktor vorschwebte, und der Einheit, wie sie ein Aegidius Romanus beschreibt, ein Unterschied. Und dieser Unterschied wird für unsere jetzige Betrachtung entscheidend. Den treibenden Faktor, der hinter diesem Unterschied steht, hat Alois Dempf in seinem Werk "Sacrum Imperium" namhaft gemacht: die Renaissance des römischen Rechts. Diese These, für die sich Dempf auf Carlyle beruft, kann hier natürlich nicht im einzelnen überprüft werden. Immerhin ergibt sich die Bedeutsamkeit des römischen Rechts für die Kanonistik aus zwei Umständen: Erstens spielte das römische Recht auf kaiserlicher Seite eine große Rolle, besonders wieder unter den Staufern. Friedrich Barbarossa förderte das Studium des römischen Rechts in Bologna, also in der Hochburg der Kanonistik. So war ein unmittelbarer Austausch möglich und fast unvermeidlich. Zweitens galt auf Seiten der Kanonistik seit Gratian folgender Grundsatz: "Toties legibus Imperatorum in ecclesiasticis negotiis utendum est, quoties sacris canonibus obviare non inveniuntur" (Decretum Gratiani, D. X, dictum post c. 6 et 7; dictum post c. 4 C 15, q. 3). Das bedeutete die größtmögliche Rezeption römischer Rechtsbegriffe und -vorstellungen in das Kirchenrecht. Die bedeutendsten Dekretalisten waren Magister beider Rechte, z.B. Heinrich von Segusia.
Waren zur Zeit der Dekretisten die Kanonisten gegenüber den Theologen die besonneneren Konservativen, die am Dualismus festhielten, so stellten sich durch die Möglichkeiten, die das Dekretalenwesen eröffnete, die Dekretalisten, vor allem, wenn sie selber Päpste wurden, an die Spitze der Entwicklung. Das aber hatte eine verhängnisvolle Wirkung: das Einheitsideal der christianitas wurde verrechtlicht. Anders ausgedrückt: Wenn in den beiden großen Innozenzpäpsten die theologische und die kanonistische Linie sich kreuzten, dann bewirkte dies nicht nur die Umwandlung der konservativen kanonistischen Partei in eine fortschrittliche, sondern auch umgekehrt eine tiefgehende Transformation des theologischen Einheitsideals. Dieses wird nun beschrieben in Kategorien des römischen Rechts. Nirgends wird dies deutlicher als bei Aegidius Romanus. Der Schlüsselbegriff wird für ihn das "dominium", ein Kernbegriff des römischen Rechts. Die potestas des Papstes wird nicht als ethische Verantwortung und moralische Last begriffen wie bei Bernhard von Clairvaux, sondern als dominium, Macht, Eigentumsrecht. Diese Verrechtlichung zugunsten eines selbstgenügsamen Machtbegriffs auf Kosten der ethischen Verantwortung stellt den eigentlichen Verrat am alten Ideal der Theologen dar. Diese waren zutiefst ethische Denker, und diesen Maßstab legten sie als fordernde Norm auch an jeden weltlichen Herrscher an. Ganz deutlich wird dies z.B. im "Policratius" des Johannes von Salisbury (1159): Die Staatslenker sollen Instrumente der aequitas sein. Sie sollen geleitet werden von der ratio und der Weisheit. Die Geistlichen aber machen als Vorbilder den Inhalt der göttlichen Gebote sichtbar. Deshalb sind sie die Seele des Staatskörpers, und die Fürsten sollen die Ermahnungen der Geistlichen beherzigen. Eine solche Art der Unterordnung unter die geistliche Gewalt ist etwas ganz anderes als das, was unter den Händen der Kanonisten daraus geworden ist. Es geht darum, daß die weltliche Herrschaft keine Willkürherrschaft ist, sondern an ethische Normen und Werte, an Gerechtigkeit und Weisheit gebunden ist. Diesen sollen sie "unterworfen" sein. Dadurch sind die Untertanen vor Tyrannei geschützt. Die geistliche Gewalt ist nur die Inkarnation dieser ethischen Norm. Von daher erklärt sich auch die Bevorzugung der abstrakten Ausdrucksweise bei den alten Theologen. Der "sacerdos" des hl. Bernhard, der durch seinen "nutus" die weltliche Gewalt in den rechten Bahnen hält, ist etwas ganz anderes als der "vicarius dei" des Aegidius, dem alles gehört. Wenn im "Policratius" der Fürst das Schwert aus der Hand der Kirche empfängt, dann bedeutet dies die Verpflichtung, für die res publica und für die Durchsetzung von Gesetz und Recht in ihr zu sorgen. Bei Aegidius wird das Verhältnis genau umgekehrt: Die Gerechtigkeit soll deshalb bewahrt werden, damit der Inhaber der geistlichen Gewalt um so freier herrschen kann: "Hoc ergo potissime faciunt principes terreni, quod disponunt et preparant materiam principi ecclesiastico. Illi ergo salvant iusticiam in rebus temporalibus et materialibus, ut salvetur pax mentis et tranquillitas in rebus spiritualibus, ut ille qui spiritualiter dominatur, possit liberius dominari" (De ecclesiastica potestate, II, 6, S. 68.)
Bei den Hierokraten steigt der Papst in dem Sinne zum vicarius Dei auf, daß auf ihn wie auf Gott alles hingeordnet ist wie auf das letzte Ziel; bei den alten Theologen hat Gott sich herabgelassen in die Konkretion eines Stellvertreters, damit dieser alle Menschen und Dinge hinlenke auf die Gerechtigkeit und damit zu ihrer eigenen Vollendung. Die Hierokraten haben ihre Traktate "De potestate papae" geschrieben zur Verteidigung und Verherrlichung der höchsten Macht des Papstes, der hl. Bernhard schrieb "De consideratione" als einen Papstspiegel, der den Papst an seine Verantwortung erinnern soll und daran, daß sein Amt ein Dienst, ministerium ist. Am krassesten wird der Gegensatz, wenn man gegen diese hohe ethische Auffassung des Papsttums den bereits referierten Standpunkt des Egidius Spiritalis hält: dort das höchste Amt auf Erden als tiefstes In-die-Pflicht-genommen-Sein, hier das höchste Amt auf Erden als äußerstes Ausleben des eigenen Willens.
Nun ergibt sich aber eine merkwürdige Konstellation: Egidius hat mit Wilhelm von Ockham und Marsilius eines gemeinsam: die Etablierung des Voluntarismus. Die Gesetzlosigkeit des Papstes bei Egidius ist das hierokratische Spiegelbild des ockhamistischen Nominalismus und Voluntarismus. Die Beschreibung des egidianischen Papstes paßt genau auf den ockhamschen Gott: Dessen Wille ist durch kein Gesetz und durch keine Gerechtigkeit gebunden. Das Gute ist gut, weil Gott es will, nicht umgekehrt. Mit Marsilius ist Egidius sich in der Verwerfung des Naturrechts einig.
So besteht der entscheidende Gegensatz nicht zwischen der hierokratischen Theorie und ihren Gegenentwürfen. Vielmehr handelt es sich bei diesem Gegensatz um die entgegengesetzten Seiten derselben Münze, durch welche die alte Währung abgelöst wurde. Dempf sieht deshalb in den hierokratischen Theorien die Faktoren der Neuzeit genauso wirksam wie bei Wilhelm von Ockham und Marsilius von Padua [3]. Der Abgrund, der die Modernen von den Alten trennt, ist die verschiedene Rolle, die sie dem Ethischen zuweisen. Voneinander unterscheiden sie sich nur durch die Frage, wem sie die solcherart autonom gewordene Macht zusprechen. In dieser Frage ist eine Vermittlung ausgeschlossen, es kann nur ein Souveränitätsideal dem anderen gegenübergestellt werden. Denn die einzige Klammer, die einigend wirken könnte, ist weggefallen: die Orientierung an einer gemeinsamen Vorgabe, nämlich dem Ordo des Ethischen. Genau dies war dem hl. Thomas gelungen. Die natürliche Ethik des Aristoteles konnte er - ohne daß sie letztlich, wie bei Augustinus Triumphus, doch absorbiert wurde - so in die christliche Heilsordnung integrieren, daß sie gleichzeitig den Dualismus und die Einheit ermöglichte. Sie war die Klammer, die beide Gewalten in einen je relativ eigenständigen Bereich auseinanderhielt und gleichzeitig miteinander verband in der hierarchisch gestuften Unterordnung unter ein gemeinsames Gesetz und gemeinsames Ziel. Er verband das im Übernatürlichen wurzelnde Einheitsideal des Hugo von St. Viktor mit der aristotelischen Anerkennung der natürlichen Eigenständigkeit der Welt. Zusammengehalten wurde diese Spannungseinheit durch das Ethische. Fiel dieses weg, mußte die Spannungseinheit, konsequent zu Ende gedacht, entweder in einen hierokratischen Absolutismus wie bei Egidius Spiritalis, oder in einen unversöhnlichen Dualismus und damit - weil ein solcher Dualismus immer nur als Übergang möglich ist - in einen cäsaropapistischen Absolutismus [4] auseinanderfallen. Thomas mildert Bernhard von Clairvaux, so daß er kein Augustinus Triumphus wird, und bewahrt den Dualismus davor, unversöhnlich zu werden.
Ein Blick auf die reale Situation bestätigt diese These, auch wenn der erste Augenschein trügt: Steht Johannes XXII. in seiner Auseinandersetzung mit Ludwig dem Bayern nicht für dieselbe Sache ein wie einst Gregor VII. im Investiturstreit gegen Heinrich IV.? Sind nicht die Machtansprüche Johannes' eine Neuauflage des Programms Gregors - man denke an den Dictatus Papae? Bei dieser Fragestellung aber bleibt die innere Transformation, die der Begriff der potestas durchgemacht hat, verborgen. Wenn man bedenkt, daß Gregor als Mönch Hildebrand aus der Reformbewegung kam, die z.B. die Simonie als den Todfeind der Kirche bekämpft hat, und wenn man ein wenig die "Petrusmystik" kennt, von der Gregor VII. durchglüht war, dann weiß man, daß er aus demselben Holz geschnitzt war wie ein Bernhard von Clairvaux. Das Ethos Gregors war wie das Bernhards ein zutiefst moralisches. Für ihn war die päpstliche potestas noch heilige auctoritas: erschütternde Last der Verantwortung. Selbst für die Könige der Menschen haben die Priester im jüngsten Gericht Rechenschaft abzulegen, schrieb einst Gelasius über die "auctoritas sacrata ponitificum." Gregor ging es im Investiturstreit um die libertas ecclesiae, damit diese ihrer vom Herrn anvertrauten Sendung nachkommen könne. Wenn dagegen Johannes XXII. ein jahrzehntelanges Interdikt über Deutschland verhängt, um Ludwig in die Knie zu zwingen, dann ist dies in der Praxis genau die Umkehrung der Theorie, die die Praxis rechtfertigen soll. Die Theorie begründet die Suprematie des Papstes mit der Unterordnung der temporalia unter die spiritualia, und die Praxis Johannes' ordnet die spiritualia seinen höchst temporalen Machtbestrebungen unter. Die Politik des in Avignon sitzenden Papstes ist ein Verrat an der libertas ecclesiae, seine Geltungsansprüche eine Karikatur der Ideale Gregors. Derselbe Bernhard von Clairvaux, der beide Schwerter der Kirche verlieh, hätte ihm wohl nicht einen Tractatus de potestate papae gewidmet, sondern, über seinen Papstspiegel hinaus, ihm ins Angesicht widerstanden und ihn an seine Verantwortung für das Heil der Seelen erinnert, wie es wenige Jahrzehnte später die hl. Katharina von Siena getan hat, als sie an Gregor XI. schrieb: "Erwerben Sie sich zuerst einen wahren Hunger nach dem Heil der Seelen und dann wägen sie die beiden Übel gegeneinander ab: den Verlust weltlicher Größe und Herrschaft und den Verlust so vieler Seelen. Dann werden Sie einsehen, wie viel mehr Sie gehalten sind, die Seelen heimzuholen."
Damit wird ein Strukturelement kirchlicher Krise sichtbar, das sich in der Geschichte wiederholt. Nicht Anfechtung von außen, sondern falsche Reaktion im Innern der Kirche sind normalerweise für Kirchenkrisen verantwortlich. Ein ursprünglich positives Anliegen verselbständigt sich und führt zu einer Störung und Umkehrung der richtigen Rangordnung kirchlicher Ziele und Werte. Für die Durchsetzung seiner Theorie zahlt Johannes XXII. einen Preis, der genau das opfert, um dessentwillen die Theorie entwickelt wurde. Die Theorie hält am päpstlichen Anspruch auf die potestas temporalis fest, um die Unabhängigkeit der potestas spiritualis sicherzustellen. In der Theorie ist die politische Gewalt des Papstes um des Seelenheiles der Gläubigen willen da. In der Praxis wird die Theorie durchgesetzt, indem die spirituelle Gewalt der Politik untergeordnet wird. Um Ludwig politisch in die Knie zu zwingen, wird das Interdikt über ganz Deutschland verhängt. Das Seelenheil wird der Politik untergeordnet. Ein Blick auf die Gegenwart genügt, um sich zu überzeugen, wie frappierend ähnlich sich der Vorgang wiederholt. Die Erneuerung, die allgemein vom Zweiten Vatikanischen Konzil erwartet wurde, fand in einigen Punkten statt: aber um einen Preis, der die Kirche in eine der größten Krisen ihrer Geschichte stürzen ließ. Exemplifiziert sei der Vorgang an der liturgischen Erneuerung. Kardinal Ratzinger schrieb bereits 1975: "Ist es zum Beispiel nicht wirklich merkwürdig, daß man nie von ähnlichen bischöflichen Reaktionen gegen Zerstörungen im Kern der Liturgie selbst gehört hat, wie sie nun gegen den Gebrauch des doch nicht erst seit Pius V. existierenden Meßbuches der Kirche hervortreten?" (Theologische Prinzipienlehre, München 1982, S. 408). Von der Richtigkeit dieser Beobachtung kann sich jeder auch heute noch überzeugen. Wenn sie aber zutrifft, dann bezeugt dieses widersprüchliche Verhalten der Bischöfe eine Transformation, die das liturgische Anliegen des letzten Konzils unter der Hand durchgemacht hat: Gewisse Zielgrößen der Liturgiereform wie z.B. die participatio actuosa haben eine solch beherrschende Stellung im Urteilen über das, wie Liturgie sein soll, erlangt, daß demgegenüber sogar noch konstitutivere Elemente der Liturgie wie z.B. ihr Geheimnischarakter oder ihre im unverfügbaren Ritus sich manifestierende wesentliche Vorgegebenheit nicht ins Gewicht fallen. "Heute muß man sich fragen, ob es überhaupt noch einen lateinischen Ritus gibt; ein Bewußtsein dafür ist sicher kaum noch vorhanden. Die Liturgie erscheint in den Augen der meisten vielmehr als eine Gestaltungsaufgabe für die jeweilige Gemeinde, in der entsprechende Kreise oft mit einem ebenso bewundernswerten wie verfehlten Eifer von Woche zu Woche eigene 'Liturgien' basteln" (Ratzinger, Das Fest des Glaubens, Einsiedeln 1981, S. 75). Im Namen der liturgischen Erneuerung wird solch liturgiezerstörerisches Verhalten gefördert oder geduldet, während es auf der anderen Seite vorgekommen ist, daß z.B. blühendes kirchliches Leben an Wallfahrtsorten erstickt wurde, weil die Liturgie dort noch zu sehr im alten Stil gefeiert wurde. Im Namen der Reform, die sich angeschickt hatte, die Liturgie zu erneuern, wird Liturgie zerstört. Die Reform wird zum Maßstab der Liturgie, nicht mehr die Liturgie zum Maßstab der Reform. Die Reform ist zu einem Selbstwert geworden, der das ursprüngliche Ziel aus dem Auge verloren hat. Johannes XXII. ordnete um der Theorie willen, die die Politik dem Seelenheil unterordnete, das Seelenheil der Politik unter. Heute ordnet man um der Reform willen, die eine liturgische Erneuerung anstrebte, die liturgische Erneuerung der Durchsetzung der Reform unter.
Anmerkungen:
[1] John A. Watt, Spiritual and temporal powers, in: J. H. Burns (Hg.), The Cambridge history of medieval political thought c. 350 - c. 1450, Cambridge 1988, S. 367-423; Fritz Bleienstein in der Einleitung zur Edition des Traktates Über königliche und päpstliche Gewalt des Johannes Quidort von Paris, Stuttgart 1969.
[2] De ecclesiastica potestate II, 8, S. 78 f. Das ganze 11. Kapitel des 2. Buches ist dem Beweis der These gewidmet: "Quod infideles omni possessione et dominio et potestate qualibet sunt indigni."
[3] "Das Überraschende der hier vertretenen These ist also, daß die scheinbar extrem mittelalterliche Partei der Kurialisten gar nicht mehr mittelalterlich ist. Sie ist schon bestimmt von den drei Hauptfaktoren der Neuzeit, Wissenschaft, juristischer Bildung und geldwirtschaftlichem Denken," Sacrum Imperium, S. 442. Uns interessiert hier nur die "juristische Bildung", womit der Versuch gemeint ist, die Einheit der Christenheit und damit die temporale und spirituelle (!) Gewalt von Papst und Kirche in rechtlichen Kategorien auszudrücken und damit nach Art des neuzeitlichen Absolutismus zu fassen. Zu Egidius Spiritalis von Perugia macht Dempf diesbezüglich die bissige Bemerkung: "Man kann sagen, daß eigentlich bis Hobbes niemand mit solcher Schärfe die rein voluntaristische Staats- und Rechtsauffassung so stilgerecht durchgedacht hat. Stünde er nicht auf seiten der falschen Partei, so würde er zweifellos als der erste Theoretiker des Polizeistaates und des konsequenten Absolutismus entsprechenden Ruhm in der Geschichte der Staatsphilosophie besitzen." S. 462 f.
[4] Watt, a.a.O., S. 421, nennt übrigens das System des Marsilius einen Cäsaropapismus, den er gegen die Hierokratie konstruiert habe. Tatsächlich knüpft Marsilius ja an die oströmische Tradition des Cäsaropapismus an, erinnert daran, daß der Kaiser die ersten Konzilien einberufen habe und hält Ludwig für einen Constantinus redivivus. Wenn Ludwig einen Gegenpapst aufstellt, ist dies der Versuch der Verwirklichung der cäsaropapistischen Ideologie.
Der Text erschien zuerst in der Festschrift Esse in Verbo für Heinrich Reinhardt, hg. von Benedikt Dissel, Kisslegg 1993. Es handelt sich um eine Kurzfassung dieser Studie.
Themen
SexuallehreSilesius
Sinnthesen
Sixt. Kapelle
Spanien 711
Span. Bürgerkrieg
Span. Märtyrer
Spiegel
Staat
Stammzellen
Starkmut
Striet Magnus
Südsee
Sühnopfer
Synodaler Weg
Syn. Weg u. Greta
Terror
Theater
Theodizee
Theologeneifer
Theologenkongress
Theologie
Thomaschristen
Thomismus
Tier
Todesstunde
Todeswunsch
Toleranz
Tradition
Transgender
Türkenkriege
Umkehr
Unauflöslichkeit
Unbefl. Empfängnis
Urlaub
Urteilen
Veränderung
Verblendung
Vergebung
Verheißung
verlorenes Schaf
Vernunft
Vertrauen
Verweyen
Verzicht
Vorsehung
Wahrheit
Weihestufen
Weihnachten
Weihnachten II
Weihnachtsmann
Wiederverheiratete
WJT
Woche f. d. L.
WSW-Gutachten
Wunder
Wunder II
Wurzeln
Yad Vashem
ZdK
Zeugnis
Zölibat
Zweigewaltenlehre








