zur katholischen Geisteswelt
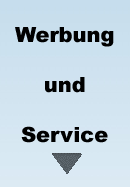
|
Zum
Inhalts- verzeichnis |
|
Zum
Rezensions- bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im biographischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
Datenschutzerklärung
|
Zum philosophischen Bereich
|
|
Zum
liturgischen Bereich |
Personen
(Auswahl)
Albert d. Große
Allouez C.
Amadeus v. L.
Auden W. H.
Bacon Francis
Bain James
Balmes J.
Barón R.
Barbarigo G. Baronius C.
Basset J.
Bataillon P. M.
Bélanger Dina
Bellarmin R.
Benninghaus A.
Benno v. M.
Bernanos G.
Billot Louis
Billuart C. R.
Bobola A.
Böhm D.
Borghero F.
Borja Franz v.
Boscardin B.
Brendan
Brisson L.
Bryson Jennifer
Calvin J.
Capestrano J.
Capitanio B.
Cassian v. N.
Castro A. de
Chambon M.M.
Chaumonot
Claret A.M.
Cornacchiola B.
Crockett Clare
Dawkins R.
Deku Henry
Delp Alfred
Döblin Alfred
Döring H.
Duns Scotus
Ebner F.
Eltz Sophie zu
Ferrero
Ferretti G.
Fesch Jacques
Flatten Heinrich
Focherini O.
Gallitzin A.v.
Geach P. T.
Gerlich M.
Green Julien
Haecker Th.
Hasenhüttl G.
H. d. Seefahrer
Hengelbrock W.
Hildebrand D. v.
Hochhuth Rolf
Höffner Joseph
Hönisch A.
Homolka W.
Hopkins G. M.
Husserl E.
Ignatius v. L.
Innozenz XI.
Jakob Max
Janssen A.
Jogues Isaak
Jones David
Jörgensen J.
Kaltenbrunner
Knox R. A.
Konrad I.
Kornmann R.
Kutschera U.
Lamy J. E.
Laurentius v. B.
Le Fort G. v.
Lehmann Karl
Leisner Karl
Der selige Rudolf Aquaviva S. J.
Missionär und Märtyrer in Indien
Von Anton Huonder S.J.
Quellen:
Der selige Rudolf Aquaviva und seine Gefährten. Von P. Herm. Gruber S. J., Regensburg 1894.
Missione al Gran Mogor del P. Rid. Aquaviva d. C. d. G. Descritta dal P. Daniello Bartoli d. m. C., Venesia 1830.
Briefe aus Ostindien. 2. u. 3. TL, Augsburg 1795.
Oriente Conquistado… Delo P. Franc. de Souza, 2. ed., Bombaim 1881.
Fr. Catrou S. J., Hist. générale de l’empire du Mogol... Sur les mémoires Portugais de M. Manouchi, Paris 1705.
Pierre du Jarric, L’hist. des choses plus mémorables advenues tant ez Indes Orientales que autres pays de la découverte des Portugais, Arras 1611 (lateinisch in Köln 1615).
Eine der interessantesten Episoden der älteren indischen Missionsgeschichte bildet unstreitig der Aufenthalt und das Wirken der Jesuiten am Hofe Akbars des Großen. Die Begeisterung und Ausführlichkeit, mit welcher die zeitgenössischen Berichte den Charakter dieser seltsamen Persönlichkeit und die Zustände seines herrlichen Reiches schildern, spiegelt heute noch deutlich die freudigen Hoffnungen wider, die sich damals an die Bekehrung dieses größten aller indischen Fürsten knüpften. Und in der Tat, wäre sie nicht durch Stolz und Sinnlichkeit vereitelt worden, sie hätte den tiefstgreifenden Einfluss auf die Missionsgeschichte Indiens ausgeübt. Zwar täuschte der Ausgang die glänzenden Erwartungen, doch blieb auch der Versuch eine denkwürdige Tat, und es dürfte gewiss am Platze sein, dem Manne eine ausführlichere Darstellung zu widmen, dem bei dieser eigenartigen Mission die Hauptrolle zufiel.
1. Vorleben und Ankunft in Indien
Aquaviva war geboren am 2. Oktober 1550 als Sohn des Joh. Hieronymus, Herzogs von Atri in den Abruzzen, und der Margareta Pia, aus dem Hause der Carpi in Emilien. Beide Familien gehörten zu den vornehmsten Geschlechtern Italiens.
Rudolfs Kindheits- und Jugendleben gleicht fast Zug um Zug demjenigen des etwas später (1568) geborenen hl. Aloysius, der von mütterlicher Seite her ihm verwandt war. Hier wie dort schon in zartester Jugend ein seltener Zug zur Frömmigkeit, Reinheit und Buße; hier wie dort eine heiligmäßige Mutter, die mit treuer Sorge über ihrem Liebling wacht; hier wie dort ein früh erwachter Ordensberuf, der nur im heißen Kampfe gegen den Vater errungen wird. Der zeitweise Aufenthalt des P. Nikolaus de Bobadilla S. J., eines der ersten Gefährten des hl. Ignatius, im herzoglichen Palaste von Atri lenkte zuerst die Aufmerksamkeit und Zuneigung des Knaben auf die Gesellschaft Jesu hin.
Der Eintritt seines Onkels Claudius, des späteren Ordensgenerals, ermutigte Rudolf, seinem längst gehegten Verlangen gleichfalls Folge zu geben. Aber der Vater – die Mutter war im Jahre 1567 gestorben – wollte ihn um keinen Preis ziehen lassen. Umsonst flehte der siebzehnjährige Jüngling zu den Füßen des hl. Franz Borgia um Aufnahme. Auch dieser wies ihn wohl aus Rücksicht auf den Vater zunächst ab. Es sei doch nur, so hielt er Rudolf vor, die Liebe zu seinem Onkel Claudius, die ihn ziehe. „Nein, nein“, rief der Jüngling, „senden Sie mich bis an die Enden der Welt, nach Osten oder Westen, so daß ich niemals wieder eines von den Meinigen sehe; Wenn ich nur der Gesellschaft angehöre, bin ich’s zufrieden.“ Endlich gelang es durch das Dazwischentreten des heiligen Papstes Pius V., den Widerstand des Vaters, der von seinen fünf Söhnen bereits drei dem Dienste des Altares geschenkt hatte (Julius und Ottavio wurden Kardinäle, Horazio Bischof), zu brechen, und überglücklich trat Rudolf am 2. April 1568, bereits im Besitz der Tonsur und der niedern Weihen, ins Noviziat St Andreä zu Rom. Hier traf er unter den beiläufig 60 Novizen aus aller Herren Ländern unter andern in der Folge berühmt gewordenen Männern auch den hl. Stanislaus Kostka, diese süßduftende Lilie, die Gott schon wenige Monate später, am 15. August, in den himmlischen Garten verpflanzte.
Schon früh erwachte in Rudolf das Verlangen nach den äußeren Missionen, und er nährte dasselbe durch eine innige Andacht zum hl. Franz Xaver, dem Apostel Indiens, dessen wunderbare apostolische Taten damals noch frisch im Gedächtnis waren. Dieser Wunsch wurde zur mächtigen Begierde durch die Kunde vom glorreichen Martyrium des seligen Ignatius von Azevedo und seiner Gefährten, welche am 15. Juli 1570 auf der Überfahrt nach Brasilien ihren Glauben mit ihrem Blut besiegelt hatten. Aber seine Bitten fanden keine Erhörung; denn der mit ungewöhnlichen Gaben ausgestattete Fürstensohn konnte nach der Ansicht des Generals P. Everard Mercurian – der hl. Franz Borgia war am 1. Oktober 1572 gestorben – in Europa größeres Wirken, und überdies schien seine zarte, durch Bußwerke geschwächte Gesundheit den Strapazen des Missionslebens keineswegs gewachsen.
Da kam 1576 P. Martin de Silva als Prokurator der indischen Mission nach Europa, um neue Arbeiter zu werben. Fußfällig bat ihn Rudolf, damals schon trotz seiner Jugend Repetitor der Philosophie am Deutschen Kolleg in Rom, sich für ihn zu verwenden, und nun ließ P. Everard Mercurian, durch eine höhere Eingebung erleuchtet, den flehentlich Bittenden ziehen.
In Lissabon empfing Rudolf die heilige Priesterweihe und las kurz vor seiner Abfahrt nach Indien seine erste heilige Messe. An Bord der portugiesischen Flotte, die am 24. März 1578 in See stach, befanden sich 14 Jesuiten, unter ihnen Benedikt Palmio, der spätere Provinzial von Goa, der selige Märtyrer Nikolaus Spinola, Michele Ruggieri und Matthäus Ricci, die Begründer der Jesuitenmission in China.
Die Reise nach den Missionsländern war damals keine Vergnügungsfahrt. „Meine Kammer im Schiffsraum“, so schrieb Rudolf noch aus Lissabon, „kommt mir bald wie ein Kerker bald wie ein Grab vor, da sie bloß zwei Fuß in der Höhe und ebensoviel in der Breite hat, so daß ich weder kniend noch stehend, sondern bloß in sitzender oder liegender Stellung beten kann. Trotzdem ,freue ich mich in dem, was mir gesagt wurde: Ins Haus des Herrn werden wir eingehen’ (Ps 121, 1), zumal ich so dem Kreuze unseres Herrn gleichförmiger werde. Ja ich bin dermaßen mitten in diesem Ungemach zufrieden und erfahre darin solche Süßigkeit, daß ich meinen Beruf auch mit der ganzen Welt nicht vertauschen möchte. Es ist mir dabei klar geworden, daß es etwas sehr Verschiedenes ist, Gott im Elend oder aber frei von jeder Beschwerde zu dienen, und daß manche zu Haus in ihrem Zimmer, wo sie weit von jeder Gelegenheit entfernt sind, ihre Tugend zu erproben, wohl mit Tugenden ausgerüstet zu sein wähnen, die in Wirklichkeit oft mehr ein Schatten als wahre Tugend sind.“
Bei seiner Landung in Goa fiel Rudolf mit Freudentränen in den Augen auf seine Knie und küßte den Boden, der durch das Andenken des hl. Franz Xaver geheiligt war.
Goa, vornehm hingelagert an einer kleinen Meeresbucht der Ranaraküste, war damals noch der machtvolle Sitz der alten Portugiesenherrschaft in Indien. An 200.000 Einwohner soll die Stadt zur Zeit ihres höchsten Glanzes gezählt haben. Zahlreiche Kuppeln und Zinnen von Kirchen und Klöstern verschiedener Orden, eine schöner als die andere, leuchteten in den Strahlen der goldenen Tropensonne.
Hier war seit Franz Xaver auch der Mittelpunkt der Jesuitenmission. Hier stand das herrliche, durch die königliche Freigebigkeit Johanns III. von Portugal fundierte Kolleg und Noviziatshaus vom hl. Paul, hier das vom hl. Franz übernommene Seminar vom heiligen Glauben für einheimische Knaben und Priesterkandidaten, hier das vom hl. Ignatius angeregte Katechumenenhaus, das von Paul von Camerino errichtete große Spital und andere der Erziehung und der Liebestätigkeit geweihte Anstalten.
Von Goa aus hatte sich das Christentum über die übrigen Besitzungen der Krone Portugals ausgedehnt, und aus seinem Hafen segelten alljährlich die aus Europa gekommenen Missionäre nordwärts bis Ormuz im Persischen Golf, südwärts nach Malabar, Cochin, Kap Komorin, Ceylon usw. und ostwärts nach Malakka, den Molukken und Japan.
Mit der Ausdehnung des Missionsgebietes wuchs das Bedürfnis nach neuen Kräften. Freudig wurden daher die neuen Arbeiter begrüßt und in das weite Arbeitsfeld verteilt.
Aquaviva, dessen zarte Gesundheit den Strapazen des Heidenapostolates nicht gewachsen schien, sollte zunächst als Professor der Philosophie für die jüngeren Ordensgenossen in Goa verbleiben. Es war für seinen brennenden Eifer eine harte Enttäuschung. Demütig und ergeben in Gottes Willen fügte er sich und lebte in treuer Pflichterfüllung seinem Berufe, ein Beispiel vollendeter Tugend, zu dem alle bewundernd emporschauten. Was in seiner Seele vorging und wie er den Missionsberuf auffasste, spiegelt sich in einem Briefe, den er damals an seine Mitbrüder in Europa sandte. Er zählt darin die Gründe auf, weshalb er gerade die Mission von Indien so sehr liebe. Der erste Grund sei die Gewißheit, daß Christus der Herr ihn hierher berufen habe, damit er an der Verwirklichung der hohen Ziele mitarbeite, um derentwegen der Heiland Mensch geworden und am Kreuze gestorben sei. – „Der zweite Grund ist, weil das Land hier Überfluß an Mühen und Leiden hat, wie sie zur Nachfolge Christi gehören. – Der dritte, weil ich hier allem entrückt bin, was das Herz an die Erde fesseln und an der freien Hingabe an Gott hindern könnte. Glaubt mir, meine Brüder, solange man in der Heimat, unter Eltern, Verwandten und Freunden und den Bequemlichkeiten des Lebens weilt, glaubt man leicht, von all dem losgeschält zu sein. Kommt man aber in die Lage, dieselben wirklich verlassen und ohne sie leben zu müssen, so erkennt man erst, wie sehr man sich hierin getäuscht hatte. – Der vierte Grund endlich ist, dass man hier buchstäblich das Gebot Christi erfüllen muß: ,Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…’ Hier wird man wirklich wieder zum Kinde und fängt gleichsam von vorne an, indem man eine ganz neue Sprache lernt und in ganz neue Verhältnisse, Sitten und Gebräuche sich einleben muß; denn Klima, Kost, Lebensart, alles ist hier ganz anders als in Europa.“
Schließlich kommt Aquaviva, wie so oft, auf sein Verlangen zurück, für den Glauben sein Blut zu vergießen, wofür Indien gute Aussicht biete, da Idalkan, der unmittelbare Nachbarfürst von Goa, stets auf dem Sprunge sei, über die Christen herzufallen, und die malabarischen Seeräuber beständig das Küstenland bedrohten.
2. Die Gesandtschaft des Großmoguls
Ein Jahr lang hatte so Aquaviva in stiller Zurückgezogenheit gelebt, als ein unerwartetes Ereignis ihm mit einem Schlage einen ganz neuen, vielversprechenden Wirkungskreis eröffnete.
Im September 1579 erschien nämlich in Goa eine Gesandtschaft aus dem Reiche des Kaisers Akbar, unter dessen Zepter damals der größte Teil von Indien vereinigt war. Die Gesandtschaft bestand aus Abdullah, einem der vertrauten Höflinge des Kaisers, einem christlichen Armenier namens Dominikus Perez, der als Dolmetscher diente, und einem zahlreichen Gefolge.
Abdullah brachte Briefe an den Vizekönig, den Erzbischof von Goa und den Provinzial der Jesuiten. Das Schreiben an diesen lautete: „Im Namen Allahs. Ferman (Brief) von Dschelaleddin Mohammed Akbar, dem von Allah auf den Thron erhobenen Padischah. Patres, die Ihr an der Spitze des Kollegs in Goa steht: Ihr möget wissen, daß ich ein großer Freund von Euch bin. Ich schicke meinen Gesandten Abdullah und Dominikus Perez zu Euch mit der Bitte, daß Ihr mit ihnen zwei von Euern Leuten, die in den Wissenschaften bewandert sind, hierher sendet. Dieselben sollen die Bücher Eures Gesetzes, vor allem die Evangelien, mitbringen, damit ich deren Vorschriften und deren Vortrefflichkeit kennenlerne; denn mich verlangt, davon Kunde zu haben. Und die Patres, so kommen werden, sollen wissen, daß ich sie mit allen Ehren empfangen und als mir sehr angenehme Gäste behandeln werde. Nachdem ich aber das Gesetz und dessen Vollkommenheit genugsam kennen gelernt, können die Patres nach Belieben zurückkehren, und sie sollen nicht nur mit allem Notwendigen für die Reise ausgerüstet, sondern auch mit reichen Geschenken beehrt werden. Sie mögen ohne Besorgnis kommen; ich selbst stehe für ihre Sicherheit ein.“
Die Gesandtschaft versetzte ganz Goa in Aufregung. Sie weckte bei den Jesuiten die freudigsten Erwartungen, bei den Portugiesen dagegen einiges Mißtrauen. Man wußte, daß der mächtige Herrscher mehrfach Vertraute unter dem Vorwande einer Gesandtschaft nach Goa geschickt hatte, um über die dortigen Vorgänge und über die Kriegsbereitschaft der Portugiesen genaue Erkundigungen einzuziehen. Insbesondere fürchtete der Vizekönig, der eigentliche Grund, weshalb Akbar Missionäre verlange, sei, um für den Fall von Verwicklungen mit den Portugiesen Geiseln in seiner Hand zu haben.
Indes stellte er die Entscheidung dem Erzbischof Don Fr. Henrique de Tavora e Brito anheim. Dieser versammelte die gerade in Goa anwesenden Bischöfe von Cochin, Malakka und Macao u. a. zu einer Beratung. Einstimmig wurde entschieden, man dürfe eine so günstige Gelegenheit, das Christentum in das weite Reich des Großmoguls zu tragen, nicht unbenutzt vorübergehen lassen, und die Jesuiten sollten dem Verlangen ungesäumt entsprechen.
Der Provinzial musterte also seine Schar. Sein Auge fiel an erster Stelle auf Aquaviva. Er wollte jedoch in einer so wichtigen Sache nicht allein entscheiden und sich vor allem der Erleuchtung von oben versichern.
Er ließ also in dieser Absicht heilige Messen, Bußwerke und Gebete aufopfern. Darauf mußten die zur Wahl herangezogenen Patres auf Zettel die Namen derer schreiben, die sie für die geeignetsten hielten. Die meisten Stimmen fielen auf Aquaviva und P. Anton Monserrat, einen durch Tugend und Wissenschaft hervorragenden Spanier. Diesen beiden gab der Provinzial als Begleiter noch den P. Franz Henriquez mit, der von Geburt ein Perser und vom Islam zum Christentum bekehrt war und durch seine Kenntnis der Sprache und des Korans nützliche Dienste leisten konnte. Aquaviva jubelte über die auf ihn gefallene Wahl, hauptsächlich weil er nun den Weg zum Martyrium vor sich offen glaubte.
„Nach so vielen andern Wohltaten“, so schrieb er am Tag vor seiner Abreise an seinen Onkel, den Ordensgeneral Claudio Aquaviva, „läßt mir Gott nun noch eine ganz außerordentliche zu teil werden. Dieselbe besteht in der Erwählung zu einer neuen Mission, die am Hofe eines mohammedanischen Fürsten eröffnet werden soll. Dieser Fürst heißt Akbar. Er ist König der Mongolen und besitzt eine überaus große Macht. Er ist in hiesigen Gegenden das, was der Großtürke in unsern Ländern. Alle andern Könige Indiens zittern vor ihm. Morgen brechen wir auf. Wir haben 100 Meilen zur See (nach Surate) und 50 zu Land zurückzulegen. Empfehlen Sie uns Gott; wir bedürfen sehr seines Schutzes; denn wir sind abgesandt wie solche, die zum Tode bestimmt sind. Auf das Wort der Mohammedaner kann man sich bekanntlich nicht verlassen, und möglicherweise gehen wir dem Tode entgegen. Und doch sind wir so voll Freude, daß, was mich anbelangt, ich nie eine ähnliche empfunden habe. So werde ich ja endlich etwas für Christus leiden können und nach seinem Beispiele ausziehen zur Rettung der Seelen. Wenn wir nun auch noch unser Blut für Christus vergießen könnten, was in dieser Mission ja leicht möglich ist, so wäre unser Glück voll. Beneiden Sie uns, Pater. Mein Glück ist so groß, daß ich wie außer mir bin, und ich sehne mich so nach jenem großen Tage, an dem ich mein Blut für den Glauben vergießen darf, daß mich der Gedanke daran gar nicht zur Ruhe kommen läßt.“
Nachdem sich die Missionare durch die geistlichen Übungen und durch das Studium der hauptsächlichsten Fragen, welche die mohammedanischen Gelehrten am Kaiserhofe voraussichtlich zur Sprache bringen würden, vorbereitet und sich die von Akbar gewünschten Bücher verschafft hatten, traten sie am 17. November mit den Gesandten des Großmoguls die denkwürdige Reise an.
Sie führte zunächst zu Schiff in zwanzigtägiger Fahrt bis Daman, der nördlichsten portugiesischen Feste an der indischen Westküste. Die Zeit wurde benutzt, um die Anfangsgründe der persischen Sprache zu erlernen. Weiter ging die Fahrt nach Surate, der ersten Stadt auf dem Gebiete des Großmoguls. Von hier aus wurden die Reisenden von den kaiserlichen Statthaltern von Stadt zu Stadt weitergeleitet. Den ganzen Plan der Reise hatte der Padischah selbst genau bis in alle Einzelheiten festgesetzt und entsprechende Weisungen überallhin erlassen.
Fünf Tagesreisen von der kaiserlichen Residenz Fatipur erkrankte P. Monserrat und mußte in Naschitar zurückbleiben. Damit die Ankunft der Patres dadurch nicht verzögert werde, beauftragte der Kaiser den Neffen seines Gesandten, bei dem Kranken zurückzubleiben und für denselben Sorge zu tragen. Aquaviva und Henriquez setzten ihren Weg fort und trafen am 17. Februar 1580 wohlbehalten in Fatipur ein, wo sie sofort zu Akbar geführt wurden.
Ehe wir nun den Aufenthalt und die Tätigkeit der Missionare am Hofe schildern, dürfte es zum Verständnis ihrer Aufgabe nützlich, ja gefordert sein, den Lesern ein möglichst klares Bild von den Verhältnissen im Mogulreiche und zumal von der Person Akbars und seiner religiösen Anschauungen zu vermitteln.
3. Das Reich des Großmoguls und Kaiser Akbar der Große.
Bereits seit der Wende des ersten Jahrtausends begann die welterstürmende Macht des Islams ihr Begehren auf die herrlichen Länder Indiens zu richten. Schon waren die Grenzländer in seinem Besitz. 1387 brausten die turkomanischen Horden des Timurlan [auch Tamerlan und Timur genannt, 1336-1405, mongolischer Eroberer und Gründer der Timuriden-Dynastie] wie ein vernichtender Orkan durch die glücklichen Stromgelände des Indus und Ganges. Aber erst einem späteren Sprossen des furchtbaren Welteroberers war es vorbehalten, den Islam bleibend in Indien zu befestigen. Es war Babur, der Gründer des moslimischen Baburidenreiches (1526–1857), das später irrtümlich als Reich der Großmogulen bezeichnet wurde, weil man den Stammbaum Timurs auf den mongolischen Dschingis-Khan zurückführte und der Name des Mongolen als der berühmteste noch immer im Munde der Völker Asiens fortlebte. Allein das Reich Baburs stand anfangs auf schwachen Füßen. Bereits sein Sohn Humajum hatte es vorübergehend an die mächtigen einheimischen Hindufürsten und die tapfern Afghanenstämme verloren, und erst Akbar (1556–1605), das in der Verbannung geborene „Kind der Not“, der als vierzehnjähriger Knabe die Zügel der Regierung ergriff, gelang es, nicht bloß zu den von ihm übernommenen Millionen auf seinem fast ununterbrochenen Siegeslaufe neue Millionen hinzuzufügen, sondern auch durch eine bewundernswürdige, weise Staatsverfassung dem Reiche eine Festigkeit zu geben, die seinen Bestand auf Jahrhunderte sicherte.
Akbar als Eroberer
Zuerst zwang er die unbotmäßigen mohammedanischen Vasallenfürsten zur Unterwerfung und Heeresfolge, dann brachte er der Reihe nach, teils durch überlegene Waffenführung teils durch kluge Schonung und Bündnisse auch die mächtigen eingebornen Fürsten unter sein Zepter. Mit starker Hand zwang er die festen Burgen und Raubschlösser der stolzen, tapfern Radschputen [auch Rajputen]. 1561 wurde Malwa vom oberen Tschumbul bis zum Rerbuda erobert, 1566 der Pendschab zurückgewonnen, 1572–1573 kam Guzerat dazu, deren wundervoll schöne Hauptstadt Ahmadabad ohne Schwertstreich, Surate durch Erstürmung genommen wurde; 1576 folgten die siegreichen Kämpfe in Bengalen, 1579 wurde die Grenzmark am oberen Indus, wo aus den nordwestlichen Provinzen (Kabul, Lahore und dem Pendschab) die gefährlichsten Rebellionen drohten, durch Erbauung der starken Feste Attok, d. h. Schutzwall, gesichert. Nach blutigen Kämpfen brach Akbar durch die entscheidende Schlacht im Rhaibar-Passe die Macht der trotzigen Afghanenstämme und öffnete den Weg nach Kaschmir, das er 1586 als herrliches Juwel seiner Krone einverleibte. Durch die Einnahme des Sind (1591–1592) und die Wiedergewinnung von Kandahar 1594 hatte der gewaltige Eroberer endlich ein Reich geschaffen, das vom Herzen Afghanistans bis an die Mündung des Ganges und des Brahmaputra und von dem schneebedeckten Himalaya bis an das Hochplateau des Dekhan sich ausdehnte.
Es ist hier nicht der Ort, diesen jugendlichen indischen Alexander auf seinen Eroberungszügen zu begleiten und ihn als Feldherrn näher kennen zu lernen. Rasches, blitzschnelles Handeln und zähe Ausdauer bei Erstürmung auch der festesten Plätze waren mit das Geheimnis seiner Erfolge. Berühmt geworden ist der Fall von Tschitor, eines der ergreifendsten Kriegsbilder jener Zeiten, und die Eroberung des für uneinnehmbar gehaltenen Felsennestes Ratanchur. Es lag wie ein Adlerhorst hoch auf fast unzugänglichen Klippen, die so steil waren, daß nach dem Ausdruck des zeitgenössischen Geschichtsschreibers Badaoni „selbst der Fuß einer emporklimmenden Ameise daran ausgleiten mußte“. Trotzdem brachte Akbar 15 seiner schwersten Belagerungsgeschütze auf einen sichern Felsenvorsprung und erzwang durch ein vernichtendes Feuer die Übergabe. Der Eroberer fühlte richtig die moralische Wirkung solcher Kraftleistungen. Sie trugen den Schrecken vor ihm her und umgaben ihn mit dem Zauber der Unüberwindlichkeit, diesem so mächtigen Bundesgenossen großer Feldherren. Wie sie, war er der Abgott seiner Veteranen, auf die sein persönlicher, oft ans Tollkühne streifender Mut und der eigentümliche Schutz, der ihn mitten im vernichtenden Kugelregen stets unversehrt erhielt und den Glauben an seine Unverletzlichkeit begründete, wie berauschend wirkten.
Akbar als Staatsmann und Politiker
Allein größer noch denn als Feldherr ist Akbar als Staatsmann und Politiker. „Dieser Nachkomme eines Ungeheuers wie Timur“, sagt Adam Müller in seiner Geschichte des Islams, „faßte den für einen Orientalen unglaublichen und auch für viele Abendländer nicht selbstverständlichen Gedanken, Indien nicht bloß für seine eigene Person, nicht für den Islam, sondern für den Indier selbst zu regieren.“ „Er achtete“, betont Ritter, „die indischen Gesetze und die indische Literatur wie keiner seiner Vorgänger und hob dadurch die bisherige Barbarei, das System der Zerstörung und Vernichtung der Muselmänner gegen das Brahmanentum in Hindostan auf“, indem er an Stelle von Siegern und Besiegten gleichberechtigte Bürger eines Vaterlandes setzen wollte. Darum ging von Anfang an sein ganzes Streben dahin, die unterworfenen Völker mit ihrem Schicksal auszusöhnen und zu gewinnen. Dies erreichte er bei den einheimischen Fürstengeschlechtern dadurch, daß er, die Vorurteile der Moslims hintansetzend, eine Hinduprinzessin zur Kaiserin machte und auch andere Familienverbindungen knüpfte, sowie durch Verleihung der einflussreichsten Staatsstellen und Ehrenämter an Hindus und durch Belassung der erblichen Lehen. Auch schmiegte er die neue Reichsverfassung den einheimischen Traditionen und Gewohnheiten an oder setzte dieselben wieder in Kraft. Die Einteilung des Landes geschah nach altindischer Weise in 15 Subahs oder Statthalterschaften, jede mit einem Vizekönig und einem Katual oder obersten Polizeibeamten nach indischer Art.
Namentlich schlugen ihm die Herzen zu, als er die bisher furchtbar drückenden Grundsteuern und die erniedrigende Kopfsteuer aller Nichtmohammedaner, die stets an die Besiegung erinnerte, aufhob. Das indische Steuersystem trat wieder in Kraft, und ein Brahmane, der „alles sehende und alles hörende“ Todar Mal, ein Finanzgenie ersten Ranges, brachte statt der bisherigen Verschleuderung und der Erpressungen der mohammedanischen Beamten wieder Ordnung und Gerechtigkeit in die Verwaltung. Durch diese kluge Politik gewann Akbar an den Hindus die treusten Vasallen und zugleich die Mittel zu seinen großartigen Unternehmungen; stiegen doch seine jährlichen Einkünfte bald auf nicht weniger als 640 Millionen Mark. Dank dieser und ähnlichen Reformen zum Schutz des gemeinen Mannes hob sich auch der traurig daniederliegende Ackerbau und Handel und das Kunstgewerbe rasch zu großer Blüte. Dabei interessierte sich der Kaiser persönlich für alle Einzelheiten des volkswirtschaftlichen Lebens. Er selbst ließ aus Goa europäische Handwerker, Mechaniker, Steinhauer, Emailleure, Goldschmiede, Chirurgen und Ärzte, aus andern Ländern neue Rohstoffe und Muster, fremde Frucht- und Nutzpflanzen kommen, um die einheimischen Gewerbe, die Industrie und die im „Garten Indiens“ so wichtige Obstzucht zu heben. Das Ausland sollte in den verschiedenen Zweigen Lehrer, Akbars Geschmack der Führer sein, und der Padischah hielt es nicht unter seiner Würde, persönlich die Technik der verschiedenen Gewerbe zu studieren und mit eigener Hand in den Werkstätten zu üben.
Den Handel beförderte er durch Anknüpfung neuer Austauschverbindungen mit nah und fern und vor allem durch Anlegung neuer Verkehrswege. Das bereits unter Babur neugeordnete Postwesen wurde zur Vollendung gebracht und Hindustan der Länge und Breite nach durch die großen Kaiserstraßen durchquert, die vom Kabul über Delhi und Agra nach Dacca am Brahmaputra und von Agra bis Mandu im Süden, dem Ausgangspunkt der Heeresstraße nach Malabar, führten. Als Akbar starb, waren Posten durch das ganze Reich eingeführt. Alle fünf Cos (1 Cos = 1,5 englische Meilen) wurden Postpferde und Fußboten gehalten. Die Fußboten liefen so rasch, dass ein Brief von Agra in fünf Tagen nach Ahmadabad in Guzerat (500 englische Meilen weit oder 800 km) gelangen konnte, was schneller ist als die Beförderung der besten englischen Post in Indien vor Einführung der Eisenbahnen. 4000 Rennpferde waren beständig in Dienst. Auf der ganzen Strecke sorgten kleine, je neun Cos voneinander abstehende Festungstürme für die Sicherheit des Verkehrs.
Hochgerühmt wird von den Missionären das Gerichts- und Kriminalwesen des Landes. Akbar wollte, dass auch der letzte Untertan zu seinem vollen Rechte käme, und er war der erste und einzige unter den mohammedanischen Fürsten Indiens, welcher für Brahmanen nur Brahmanen als Richter aufstellte. „Zweimal täglich“, so erzählt P. Petrus Jarric S. J. [1566-1617], „gab der Kaiser persönlich öffentlich Audienz, um Recht zu sprechen. Zwei große, geräumige Höfe im Kaiserpalast dienten diesem Zweck. In beiden stand unter einem Zeltdach ein mit Gold und Edelsteinen geschmückter Thron. Zu dem einen hatten alle ohne Unterschied des Standes, auch der Ärmste, Zutritt, und jedem schenkte der Herrscher gnädiges Gehör. Im andern, dem Mahtabi, einem Prachtzelt mit tausend kostbaren Teppichen, empfing er die Hauptleute, Statthalter, Satrapen und die Gesandten ausländischer Höfe. Hier wurden auch die wichtigsten Staatsangelegenheiten verhandelt. Acht rechtskundige Männer von gesundem Urteil, von denen einer an je einem Wochentage abwechselnd den Vorsitz führte, standen beim Kaiser. Sie führten die Rechtsuchenden beim Padischah ein, unterwiesen sie, wenn es Auswärtige waren, in dem Hofzeremoniell, das sie beim Erscheinen vor dem Kaiser zu beobachten hatten, und untersuchten den Rechtsfall. Die beisitzenden Staatsschreiber führten nach orientalischer Sitte genaues und ausführliches Protokoll. In ähnlicher Weise wurden über das ganze Land hin Gerichtshöfe errichtet; auch Apellationsgerichte fehlten nicht. Die Abstimmung musste stets mündlich, nicht schriftlich geschehen, und Akbar bestand auf gerechter Handhabung des Gesetzes.
Im Kriminalverfahren bewies der Kaiser eine für jene Zeiten große Mäßigung. Nie durfte in der Stadt, wo der Kaiser gerade residierte, ein Verbrecher ohne sein Wissen hingerichtet werden, und gern übte er sein Recht der Begnadigung, selbst gegen seine Feinde aus. Die Strafen selbst waren freilich zum Teil sehr hart. Hochverräter wurden von Elefanten zerstampft; Diebe und Piraten verloren, falls keine Bluttat nachgewiesen war, die Hand; Zauberer wurden nach türkischer Sitte an Pfähle gespießt, Ehebrecher und Raubmörder zum Kreuz, zum Strang oder zur einfachen Erdrosselung verurteilt, leichtere Vergehen durch Auspeitschung bestraft. Manche der altindischen harten und zum Teil unmenschlichen Rechtsgebräuche suchte Akbar zu mildern oder zu beseitigen. Er erlaubte auch die Wiederverheiratung der Hinduwitwen und machte wenigstens den Versuch, die traurige Unsitte der Witwenverbrennung aufzuheben. Es soll hier schon betont werden, dass manche dieser Maßregeln auf den wohltätigen Einfluss der christlichen Missionäre zurückzuführen sind.
Durch die Gewalt der Waffen war das Reich gegründet worden, durch sie war dessen Erhaltung gegenüber den noch immer mächtigen Nachbarstaaten und den beständig gärenden aufrührerischen Elementen bedingt. Darum bildete die Organisation und Verbesserung des Heerwesens naturgemäß eine Hauptsorge des Kaisers. Abul Fazil [Abu 'l-Fazl ibn Mubarak, 1551-1602, Chronist Akbars] schätzt die Kriegsstärke des weiten Mogulreiches auf 4.400.000 Mann waffenfähiger Truppen. Das stehende Heer, d. h. die Truppen des kaiserlichen Hauses, bestand nach Blochmann [Heinrich Blochmann, 1838-1878, Orientalist] aus 25.000 Mann: 12.000 Reiter und 13.000 Musketiere und Artillerie, die aus dem kaiserlichen Schatz besoldet und teils als Leibwache der kaiserlichen Familie, teils als Besatzung fester Punkte verwendet wurden. Dazu kam die Nobelgarde der Ahadis, in welcher die Söhne angesehener Familien unter dem unmittelbaren Befehl des Kaisers oder eines stellvertretenden Emirs standen. Sie erhielten eine sorgfältige Ausbildung und dienten als Stabsoffiziere, Adjutanten, Staatskuriere usw. Die reguläre Armee war trefflich geschult und die verschiedensten Truppengattungen vertreten, Pioniere (Pachilis) nicht ausgeschlossen. Die Hauptstärke lag wohl immer noch in der Kavallerie. Akbar hob sie durch Wiedereinführung des Dagh, d. h. es mussten die für die Heerfolge bestimmten Pferde, Elefanten, Kamele usw., die sonst vielfach aus dem schlechtesten Material ausgewählt wurden, mit einem nach Rasse und Truppengattung verschiedenen Brandstempel gezeichnet werden. Bei den strengen Musterungen wurden bloß gestempelte Tiere angenommen und der Ausfall durch teilweise Entziehung der Einkünfte geahndet. Dadurch wurden jeder willkürlichen Unterschiebung Schranken gesetzt und die Dschagirdare (Vasallenfürsten) genötigt, einen Stamm von guten Dienstpferden zu halten. Durch Einführung und Zucht der besten Rassen aus Turkestan, Kashmir, Badachstan sorgte der Kaiser, der selbst an die 12.000 edle Renner in seinen Marställen stehen hatte, für ein vorzügliches Material. In ähnlicher Weise wandte er sich der Zucht der als Reit- und Lasttiere so wichtigen Kamele und Maultiere und vor allem auch der Elefanten zu. Diese gewaltigen Dickhäuter, die der indische Dichter so begeistert besingt, spielten in den Kriegen eine wichtige Rolle. Mit Stirnpanzern aus Eisen oder dicken Tierhäuten bewehrt, mit einem langen Rapier am Rüssel und zwei scharfen Dolchmessern an den Stoßzähnen konnten die Tiere, deren Kampflust mit süßem Zuckerrohr, mit Wein und andern starken Getränken noch vermehrt wurde, auch abgesehen von den auf ihrem Rücken von kleinen Festungstürmen aus kämpfenden Kriegern, dem Feinde furchtbar werden. Sie standen aber hinten in der Schlachtreihe, damit sie nicht die feindliche Linie verdeckten, noch, wenn verwundet, in ihrer Wut sich umkehrten und Verwirrung und Verderben in die eigenen Reihen trügen. Kamen sie ins Treffen, so stürmten sie wie grimme Widder mitten ins Kampfgewühl, fassten den Feind mit ihrem Rüssel, schleuderten ihn hoch empor und zerstampften ihn dann unter ihren Turmfüßen. Nach P. Jarric führte Akbar in den Krieg gegen seinen Halbbruder Hakim nicht weniger als 50.000 Elefanten. Er allein hatte 5000 – 6000 in seinen Ställen und entwarf persönlich das sehr genaue Reglement für die Wärter, Abrichter usw., und wehe diesen, wenn durch Fahrlässigkeit einer seiner Lieblingselefanten zu Grunde ging! Der kaiserliche Oberstallmeister war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Reiche.
Neben der Kavallerie erlangte unter Akbar die Artillerie eine bisher unerreichte Bedeutung. Er ließ von Surate [Surat: 220 km nördlich von Mumbai; Hafenstadt im Sultanat Gujarat, das Akbar 1576 eroberte] englische Kanoniere kommen, um seine Leute in die Handhabung der schweren Geschütze nach europäischem Muster einzuführen, gründete eine Reihe von kaiserlichen Geschützgießereien und verbesserte durch eigene Erfindung die bisherige Technik. Der Lauf der Geschütze wurde nicht mehr aus zwei rundgebogenen Stücken Eisenblech, sondern aus festgepressten Drahtspiralen geschweißt und auch die Bohrung glühender Stangen mit Erfolg versucht. Die Kugeln der Festungsstücke schwersten Kalibers wogen 12 Mans [das Man oder Maund war eine persische und indische Gewichtseinheit; zur Zeit Akbars entsprachen einem Man etwa 25 kg], und der Transport eines Stückes samt Munition erforderte mehrere Elefanten und 1000 Zugochsen. Die Erfahrung führte Akbar auf die Bevorzugung leichterer Geschütze, die auf einem Elefanten befördert werden konnten. Nach Abul Fazil erfand der Kaiser, der gern in den Waffenwerkstätten arbeitete, eine Art Bergkanone, die auseinander genommen werden konnte, und eine Kugelspritze von 17 Läufen. Er selbst war ein trefflicher Schütze und übte sich viel im Scheibenschießen, wobei er seine 105 Privatgewehre abwechselnd in bestimmter Reihenfolge gebrauchte. Ein glücklicher Schuss aus seinem Lieblingsgewehre, dem Singram, „Löwentöter“, hatte einst Dschagmal, den tapfern Kommandanten der Festung Tschitor [Tschitor, Tschitorgarh, Chittorgarh, 450 nordöstlich von Surat, die stärkste Festung des Rajputenreiches, Region Mewar, 1568 von Akbar erobert] niedergestreckt und dadurch das Los des starken Bollwerkes entschieden.
Akbar als Beförderer von Kunst und Wissenschaft.
 Neben dieser großartigen Tätigkeit für die Hebung und Sicherung des materiellen Wohlstandes seines Reiches wandte sich aber der große Kaiser mit Begeisterung und seinem Verständnis auch den höheren, idealen Gütern der Menschheit zu. Es war nicht bloß Staatsklugheit, dass er die eingeborenen Hindufürsten bevorzugte, um durch sie den ehrgeizigen Plänen seiner mohammedanischen Großen ein Gegengewicht zu schaffen, sondern eine innere Geistesverwandtschaft, die ihn zum milderen, weicheren Denker- und Dichtervolk der Hindus hinzog. [Das Bild zeigt Diwan-i-Khas, die Audienzhalle Akbars in Fatihpur, in der die religiösen Dispute ausgetragen wurden.]
Neben dieser großartigen Tätigkeit für die Hebung und Sicherung des materiellen Wohlstandes seines Reiches wandte sich aber der große Kaiser mit Begeisterung und seinem Verständnis auch den höheren, idealen Gütern der Menschheit zu. Es war nicht bloß Staatsklugheit, dass er die eingeborenen Hindufürsten bevorzugte, um durch sie den ehrgeizigen Plänen seiner mohammedanischen Großen ein Gegengewicht zu schaffen, sondern eine innere Geistesverwandtschaft, die ihn zum milderen, weicheren Denker- und Dichtervolk der Hindus hinzog. [Das Bild zeigt Diwan-i-Khas, die Audienzhalle Akbars in Fatihpur, in der die religiösen Dispute ausgetragen wurden.]
Akbar zeigte seine Größe auch in formvollendeten Prachtbauten und führte der an sich schon hochentwickelten einheimischen Baukunst durch Berufung ausländischer Künstler neue Elemente und Anregungen zu, und aus der Verbindung der einfach edlen Formen des maurischen Stiles mit den zierlichen Motiven indischer Technik erwuchs der eigenartige Stil der Barberidenperiode. Derselbe schuf in unerschöpflicher Fruchtbarkeit jene nicht bloß originellen, sondern vielfach wirklich vollendet schönen Baudenkmale in Agra, Delhi, Lahore, Fatihpur, Sikandra usw., die noch heute die Reisenden zur Entzückung hinreißen und die der alte Hazart nicht mit Unrecht unsern „Thum-(Dom-)Kirchen“ an die Seite stellt, von welchen aber auch die genauste Beschreibung keine richtige Vorstellung geben kann.
„Eine untersättliche Wissensgier“ nennt P. Franz Catrou S. J. [1659-1737] „die Hauptleidenschaft des Fürsten“. Darum war ihm der Umgang mit gebildeten und gelehrten Männern ein wahres Lebensbedürfnis. An seinem Hofe blühte denn auch bald das indische Sängertum wieder auf, dessen Mittelpunkt der fürstliche Mäzen geworden. Hier fand der durch seine Wortspiele und Lieder bekannte Minnesänger Mahesch Das, ein Brahmane aus Kalpi, ein gastliches Heim, gewann die Gunst des Kaisers und wurde unter dem Namen Kab Rai, „Dichterkönig“, einer seiner vertrautesten Freunde. Der Radschputenrhapsode Mian Tansin, dessen Lieder heute noch an den Ufern des Ganges klingen, machte Akbar mit den alten Heldengeschichten der Hindus bekannt und sang zum Ruhme seines Gönners.
Auch Männer der Wissenschaft, Philosophen, Rechtslehrer, Astronomen usw., berief der Kaiser von allen Seiten an seinen Hof. Den größten Einfluß auf ihn gewann der gewandte, geistreiche Abul Fazil, nach Ritter einer der größten Gelehrten seiner Zeit, und dessen Bruder, Abul Feizi in Benares, der erste Mohammedaner, welcher die bis dahin verachteten Sanskritstudien wieder zu Ehren brachte. Die Wißbegierde des Kaisers ließ ihn den Schlaf auf wenige Stunden beschränken, um in der übrigen Zeit sich die Schriftsteller alter und neuer Zeit, die persischen Übersetzungen der alten Heldengedichte, die heiligen Sanskritbücher und später mit Vorliebe das Neue Testament vorlesen und erklären zu lassen. Beständig war eine Schar von Übersetzern an der Arbeit, die aus dem Sanskrit ins Hindi und dann ins Persische, das die Hofsprache war, übertrugen. Der Kaiser übte dabei scharfe Kritik, und Badaoni, der mohammedanische Historiograph, klagt, wie Akbar ihn einst wegen einer schlecht gelungenen Übersetzung einen unnützen Rübenfresser geschimpft habe. In seinem Palaste zu Fatihpur hatte der Fürst nach eigenem Plane eine reichhaltige Bibliothek angelegt mit hindischen, persischen, griechischen, kaschmirischen, arabischen Werken über Literatur: Prosa, Dichtung und Novellen, Philosophie, Medizin, Mathematik usw.
Seltsamerweise hatte Akbar selbst weder lesen noch schreiben gelernt. Doch wurde dieser Mangel durch seine rasche Auffassungskraft, seinen Wissensdurst und ein außerordentlich treues Gedächtnis ersetzt, das ihn z. B. die Namen jedes einzelnen seiner Elefanten und die verwickelsten Details der Staatsgeschäfte mit überraschender Sicherheit behalten ließ. Eine Schar von sorgfältig ausgewählten Vorlesern tat der Reihe nach ihren Dienst. Der Kaiser selbst merkte mit einem Zeichen die Stelle, wo man aufgehört, und belohnte durch reiche Geschenke nach der Zahl der vorgelesenen Seiten. Die alten Quellen heben als merkwürdig seine Liebhaberei für kalligraphische Leistungen und seinen Bestand an europäischen Gemälden hervor, was einen geläuterten Kunstsinn verrät.
Neben den mechanischen Künsten wurden besonders auch die mathematischen, astronomischen und geschichtlichen Studien befördert. Der Kaiser baute Sternwarten in Delhi, Agra, Benares, ließ eine Geschichte des neueroberten Kaschmir nach den alten Quellen des Landes schreiben, das Fabelbuch Hitopadea unter dem Titel Ayari Danisch umarbeiten und verfaßte auch selbst Memoiren über seine Feldzüge.
So oft Fremde an seinen Hof kamen, wurde er nicht müde, dieselben stundenlang über die Sitten und Gebräuche, die sozialen, politischen, wirtschaftlichen und religiösen Zustände anderer Länder und Völker auszufragen, um so seine Kenntnisse zu bereichern und für seine Pläne neue Anregungen zu gewinnen.
Noch fehlt uns ein Bild von der äußeren Erscheinung und Persönlichkeit des merkwürdigen Mannes. Er war von mittlerer Statur, eher groß als klein; seine Brust wölbte sich breit und mächtig. Seine gekrümmten Beine zeigten den echten Dschagatai, der gewohnt war, im Sattel zu sitzen. Trotzdem sein Antlitz den mongolischen Typus trug, ward es von den Missionären und Orientalen als schön bewundert. Sein Sohn sagt in seinen Memoiren, es sei von weizengelber, etwas ins Dunkle neigender Farbe gewesen. Dschahangir erwärmt sich für eine erbsengroße Warze an der linken Nasenseite seines Vaters, die den Physiognomen Hindustans für eine Vorbedeutung unermeßlichen Reichtums und wachsenden Glückes galt. Akbar hatte eine sehr starke Stimme und eine sehr gewählte und gefällige Art zu sprechen. Was aber seine Anziehungskraft besonders ausmachte und zur Bewunderung hinriß, bezeichnet Dschahangir dahin, daß er ganz anders war als andere Menschen und sein Antlitz voller Würde.
Akbar liebte es, in der Kleidung sich von seiner Umgebung zu unterscheiden. War diese in Sammet und Seide, strahlend in Gold- und Juwelenschmuck, so erschien er schmucklos und einfach. Nur um den Hals trug er eine Schnur kostbarer Perlen, desgleichen am rechten Handgelenk. Um seinen Finger der Schwerthand blitzte der kaiserliche Siegelring, und eine Edelsteinagraffe, an der eine Reiherfeder nickte, schmückte den Turban oder die schwarze persische Sammetmütze, welche die Missionäre als Tiara bezeichnen. Die europäische Kleidung gefiel ihm so gut, daß er in seinem Palast sich gerne in der spanischen Tracht aus schwarzer Seide zeigte, nur daß er die engen Beinkleider, welche die krummen Beine des Padischah zu auffällig gemacht, mit bauschigen vertauschte. Obgleich er an seinem Hofe auf seine Küche hielt und Köche aus aller Herren Ländern an seinen Hof berief, lebte er selbst sehr mäßig. Etwas Wein oder Milch, mit heiligem Gangeswasser gemischt und mit Eis von den Patanbergen gekühlt, war sein liebster Trank, einige Früchte seine liebste Wahl. Gewöhnlich aß er nur einmal des Tages. Dabei war seine Arbeitskraft eine erstaunliche.
Den Charakter Akbars zeichnet P. Jarric in folgenden Zügen. Er war sehr klug und berechnend, hatte ein scharfes Urteil und verband mit gewaltiger Tatkraft große Güte und Selbstbeherrschung. Er war ein angenehmer Gesellschafter, voll geistreichen Witzes und liebenswürdiger Heiterkeit, ohne aber jemals im geringsten etwas seiner Würde zu vergeben. Er hatte sich so in der Gewalt, daß er mitten im Spiel und der Erholung sogleich abbrechen und den wichtigsten Staatsgeschäften sich zuwenden konnte. Selbst seine Feinde behandelte er schonend, so daß er z. B. einem des Hochverrats schuldigen Großen zweimal verzieh und ihn erst beim dritten Rückfall mit dem Tode bestrafte. Er besaß einen offenen, weiten Blick für alles Gute und Schöne und anerkannte ohne engherzige Befangenheit die Vorzüge fremder Nationen. Von Temperament war er stark melancholisch und zeitweise epileptischen Anfällen unterworfen. Darauf führt Jarric seinen unruhigen Drang nach aufregenden, zerstreuenden Spielen, wie Kämpfen zwischen wilden Tieren und Gladiatoren, und seine Begier, stets Neues und Pikantes zu erfahren und zu planen, zurück.
Eines und für uns das Wichtigste fehlt noch in diesem Charakterbild, die Stellung Akbars zur Religion und zum Christentum. Sie wird uns im folgenden beschäftigen. Allein bereits aus dem Gesagten wird man die freudigen Hoffnungen begreifen, welche die Missionäre an die Gesandtschaft knüpften, die sie 1580 an den Hof des mächtigsten und größten Monarchen Indiens berief.
4. Akbars religiöser Entwicklungsgang
Akbar war von seinem Vater in der sunnitischen, d. h. der streng orthodoxen Form des Islams, erzogen worden und trat im ersten Jahrzehnte seiner Eroberungslaufbahn, teils vielleicht noch aus Überzeugung teils aus Rücksicht auf seine mohammedanischen Heerführer und Kerntruppen, äußerlich wenigstens ganz als rechtgläubiger Moslem auf. So unternahm er z. B. wiederholt als demütiger Pilger, zu Fuß, in schlichtem Kleid, den Stab in der Hand, die Kürbisflasche an der Seite, Wallfahrten zu den berühmten Grabstätten mohammedanischer „Heiligen“, ließ zur Erleichterung solcher Wallfahrten am Wege freie Karanwansereien errichten, Brunnen graben, Moscheen usw. bauen und machte reiche Stiftungen zugunsten der mohammedanischen Geistlichkeit. Doch traten bei ihm schon frühe an Stelle des engherzigen mohammedanischen Fanatismus freiere, tolerantere Anschauungen. Der Grundsatz seines hochverehrten persischen Lehrers Mir Abdullatif: „Friede mit allen und Duldung für alle“, war sein eigener geworden. Tatsächlich war Akbar nach dem übereinstimmenden Zeugnis aller, auch der christlichen Quellen eine tief religiös angelegte Natur, und so konnte es bei seinem unersättlichen Durst nach Wahrheit, seinem unbefangenen, für alles Gute und Schöne empfänglichen Sinn und seiner Hinneigung zu religiös-philosophischen Grübeleien nicht ausbleiben, daß er über die starren Formen des Islams hinaus sich nach etwas Besserem umschaute. Das Interesse, mit dem der Kaiser die verschiedenen Religionssysteme zu studieren begann, wurde zugleich von einem politischen Gedanken getragen. Wie oben schon gesagt, ging seine leitende Staatsidee dahin, die scheinbar unversöhnlichen Gegensätze, welche die verschiedenen Völker seines Reiches trennten, nach Kräften auszugleichen. Nichts aber greift tiefer in das ganze geistige und soziale Leben der Nationen ein als die Religion. Hier war also vor allem eine Einigung oder Versöhnung zu erstreben. Die ungeheure Mehrheit seiner Untertanen (5 : 1) bekannte sich zur Hindureligion, einem Gemisch von Brahmanismus und Buddhismus, andere Bruchteile zur Religion des Zoroaster usw. Im schroffen Gegensatz zur Religion der Inder stand der Islam, die Religion der Eroberer, nach innen zerrissen in eine Reihe sich grimmig befeindender Sekten, nach außen starr und unduldsam gegen jedes fremde Bekenntnis. Ihn den unterworfenen Völkern aufdrängen, hieß etwas Unmögliches versuchen und widersprach auch dem eigenen Toleranzgrundsatz und Gefühl des Kaisers. So scheint in Akbar allmählich der Plan erwacht zu sein, aus den verschiedenen religiösen Systemen eine neue Religion zu bilden, in welcher seine Völker sich einigen sollten. „Mohammed“, so läßt Manouchi den Kaiser in einer späteren Periode sagen, „war ein Mensch wie ich und weniger mäßig als ich. Er hat aus seiner Phantasie eine Religion erfunden, die ein Gemisch von Judentum, Christentum und den Produkten seines eigenen Geistes war. Dadurch hat dieser vermeintliche Prophet seinen Namen verewigt und große Herrscher zu seinen Schülern gemacht. Es ist aber gleicherweise auch in meinem Interesse und zu meinem Ruhme, das Haupt und der Gründer einer neuen Religion zu werden. Meine Untertanen sind ein buntes Gemisch von Mohammedanern, Heiden und Christen. Ich will sie alle zu einem gemeinsamen Bekenntnis führen. Ich verbinde die Taufe des einen und die Beschneidung des andern mit dem Kult des Brahma. Ich behalte die Seelenwanderung, die Vielweiberei und zugleich die Verehrung Jesu Christi. Indem ich so beibehalte, was jedem der verschiedenen Bekenntnisse das teuerste ist, mache ich aus allen eine Herde, deren Hirt ich bin.“
„Der Kaiser“, so schrieben später die Missionäre über Akbar, „ist kein Mohammedaner, sondern er schwankt zwischen allen Religionen hin und her und hält keine einzige lange für das göttliche Gesetz, weil er in allem etwas findet, was seine Vernunft stört. Er glaubt nämlich, alles könne mit der Vernunft begriffen werden“ (De rebus Iaponicis, Indicis... Epistolae recentiores a Jo. Hayo S. J. in librum unum coacervatae, Antv. 1605, 705). Entsprechend dieser Gesinnung spielte er bald die Rolle eines mohammedanischen, bald eines indischen Aszeten und „Heiligen“, ahmte gelegentlich die Übungen tibetanischer Lamas nach, legte sogar die Tika, das Abzeichen der Brahmanen, an, kurz: sammelte „von allen Rosenblättern den Duft“.
Sein Plan religiöser Einigung führte den Kaiser auf religionsvergleichende Studien, als deren ersten Vertreter ihn Max Müller [Friedrich Max Müller, 1823-1900, bedeutender Indologe] feiert. Er schloß sich den Schiiten an, um die Perser, den Brahmanen, um diese zu gewinnen und von ihnen zu lernen.
Seine religiösen Zweifel und Forschungen weckten in Akbar den Wunsch, Gelehrte und Vertreter der verschiedenen Religionen an seinen Hof zu ziehen. Er ließ in Sikri Fatihpur, der neuen, in einsamer, öder Gebirgsgegend erbauten Residenzstadt, einen prachtvollen Hallenbau, die Ibadat Chana, aufführen. Sie bestand aus vier Hallen und sollte den Versammlungen der Gelehrten dienen, die hier jeden Donnerstag abend zusammenkamen, um über die wichtigsten religiösen Streitfragen zu verhandeln. Die westliche Halle war für die Sajjids, die Nachkommen des Propheten; die südliche für die Ulemas und Mollas, die geistlichen Vertreter des orthodoxen Islams; die nördliche für die Scheiks und die Arbabihal, „die Männer der Verzückung“; die östliche endlich für die hohen Militär- und Hofbeamten bestimmt. Die Sitzungen währten bis zum Morgen, und Akbar besuchte einen der Räume nach dem andern und nahm oft lebhaft an den Disputationen teil. Von allen Seiten und aus allen Ländern kamen jetzt Forscher und Gelehrte und „heilige Männer“ nach Sikri. Selbst in der Stille der Nacht, wenn dunkle Fragen den Kaiser nicht schlafen ließen, wurde Debi, der weise Brahmane, an der Mauer des Schlosses in einem Charpai sitzend, emporgezogen und unterhielt sich, zwischen Himmel und Erde schwebend, mit dem wahrheitsdurstigen Großherrn. Von den Indern übernahm Akbar wohl u. a. den Glauben an die Seelenwanderung. Auch Parsis aus Guzerat, Anhänger des Zoroaster, tibetanische Lamas, mogulische „Heilige“, indische Aszeten der verschiedenen Richtungen ließ er an seinen Hof bescheiden, um von allen einige Elemente für seine neue Religion zu gewinnen. Auf den Inhalt der neuen, von ihm geplanten Religion des „göttlichen Glaubens“ (Dini Ilahi) näher einzugehen verbietet uns der Raum (Sie ist auf Grund der besten Quellen ausführlich dargelegt von P. Herm. Gruber S. J., Der selige Rudolf Aquaviva und seine Gefährten, Regensburg 1894, 8.-11. Kapitel). Sie wollte auf rein rationalistischer Grundlage die besten und reinsten Lehren und Formen aller andern Religionen zusammenfassen und in ihrem äußeren Kult vor allem den Sonnen- und Feuerdienst pflegen, da die Sonne und das Licht das reinste und vollkommenste Abbild Gottes in der sichtbaren Schöpfung sei. Übrigens scheint die neue Religion, über welche die Missionäre nur spärlich berichten, zunächst bloß nach Art einer Geheimsekte am Hofe bestanden zu haben. Erst später, nach Manouchi sogar erst nach der Rückkehr der Missionäre, nahm Akbar den offenen Kampf gegen den Islam auf, um ihn durch die neue Religion zu ersetzen, die aber nur ein kurzes Dasein fristete.
Bei dem großen Interesse, welches Akbar hatte, gelehrte Vertreter aller Religionen an seinen Hof zu ziehen, war seine Aufmerksamkeit gewiß schon längst auch auf die christliche Religion gelenkt worden, deren Ruf durch den hl. Franz Xaxer, den berühmten Wundertäter, auch in das Innere von Indien gedrungen war. Bis darum 1578 der portugiesische Gesandte Anton Cabral an seinen Hof kam, beobachtete er heimlich sehr genau die Lebensweise und die sittliche Aufführung des Gesandten und seines Gefolges, um sich daraus ein Urteil über das Christentum zu bilden. Dasselbe fiel so günstig aus, daß sich der Kaiser bei Cabral angelegentlich nach den Hauptpunkten der christlichen Lehre erkundigte. Seine Hochschätzung stieg, als er von dem wohltätigen Einfluß vernahm, den zwei damals in Bengalen wirkenden Jesuitenmissionäre auf die Bevölkerung ausübten. Sie hatten unter anderem die Pflicht, die schuldigen Abgaben zu entrichten, eingeschärft und dadurch eine erkleckliche Mehreinnahme des Fiskus bewirkt. Akbar machte daraus einen Schluß auf die Heiligkeit und Wirksamkeit des christlichen Gesetzes. Bald darauf drückte er einem andern Portugiesen, namens Tavarez, dem Kommandanten eines bengalischen Seehafens, sein Verlangen aus, die heiligen Bücher der christlichen Religion und durch Priester derselben genaueren Unterricht zu erhalten. Tavarez riet ihm, zu diesem Zweck sich Jesuiten aus Goa kommen zu lassen. Denselben Rat gab ihm Ägidius Pereira, ein frommer, aber wissenschaftlich nicht sehr gebildeter Priester, den Akbar an seinen Hof beschieden hatte. Der Kaiser, so erzählt Jarric, bat Pereira, er möge ihm sagen, welche Religion die bessere sei, die mohammedanische oder die christliche. In schlichter Weise stellte der Priester dem Kaiser die innere Unwahrheit und die Widersprüche des Islams vor Augen, worauf Akbar noch in derselben Nacht die Mollas zu sich beschied und ihnen erklärte, er wolle den Lehren des christlichen Priesters folgen und zu Gott beten, Er möge seinen Geist erleuchten, damit er die Wahrheit und den rechten Weg des Heiles erkenne. Darauf habe ihm der Oberste der Mollas gesagt: „Ew. Majestät beobachtet ein gutes Gesetz und hat deshalb nicht nötig, sich nach einem andern umzusehen oder an dem alten zu zweifeln“, worauf Akbar, von seinem Sitze aufspringend, zu wiederholten Malen ausgerufen habe: „Daß mir Gott helfe!“ wodurch er deutlich zu erkennen gegeben habe: daß ihm die Religion der Seinigen nicht genüge und er nach einer besseren suche.
Auf wiederholtes Drängen Pereiras, sich an seiner Statt Jesuiten aus Goa kommen zu lassen, die, in den heiligen Wissenschaften besser bewandert, ihn gründlicher unterrichten und all seine Zweifel töten würden, entschloß sich endlich Akbar im September 1579, eine feierliche Gesandtschaft nach Goa abzuordnen. Sie hatte, wie bereits erzählt, die Sendung des. P. Aquaviva und seiner Genossen zur Folge.
5. Ankunft in Fatihpur
Akbar erwartete die Missionäre mit solcher Ungeduld, daß er sich täglich durch Eilboten von ihrer Annäherung berichten ließ und ihnen ein fürstliches Gefolge aus Pferden, Kamelen und Elefanten zur Begrüßung und zum Weitergeleite entgegensandte. Er empfing sie in glänzender Audienz, umgeben von seinen Söhnen und einem Kranz von mehr denn zwanzig Vasallenkönigen. Wohl mochten die Ankömmlinge staunen über die märchenhafte Pracht dieser Paläste und Hallen, wo überall in goldenen und silbernen Gefäßen die feinsten Rauchwerke brannten oder süßduftende Blumen in herrlichen, kunstvollen Schalen die köstlichsten Wohlgerüche ausströmten.
Nach dem offiziellen Empfang unterhielt sich der Kaiser mit den Missionären bereits am ersten Abend bis tief in die Nacht hinein und ließ sie dann in eine vornehm ausgestattete Herberge bringen. Dominikus Perez, ein christlicher Armenier am Hofe, erhielt den Auftrag, für alle ihre Bedürfnisse zu sorgen. Ein reiches Geldgeschenk, das der Kaiser ihnen nachschickte, wies Aquaviva mit dem Hinweis auf sein Armutsgelübde höflich, aber entschieden zurück. Der Kaiser bewunderte diese ihm bei den Dienern seiner Religion so unbekannte Uneigennützigkeit und sprach sich wiederholt vor seinen Großen und Höflingen rühmend darüber aus. Drei oder vier Tage später überreichten die Patres bei einem zweiten Besuch die für den Kaiser bestimmten Bücher des Alten und Neuen Testamentes. Es war die geschmackvoll eingebundene und goldverzierte, in vier Sprachen bei Plantin in Antwerpen für Philipp II. gedruckte achtbändige Polyglotte. Bei ihrem Anblick setzte Akbar seinen Turban ab, nahm einen Band nach dem andern in seine Hand, küßte ihn, legte ihn sich zum Zeichen seiner Ehrfurcht aufs Haupt und fragte jedesmal, ob dies das Evangelium sei. Als er dasselbe endlich in Händen hielt, schaute er es genauer an, drückte es mit dem Ausdrucke tiefster Ehrfurcht an sein Herz, küßte es wiederholt und legte es sich gleichfalls aufs Haupt. Und zwar geschah dies in Gegenwart der hohen Würdenträger und Beamten seines Reiches, die zum Teil Moslemin waren. Darauf führte er Aquaviva an seiner Hand in das innerste der königlichen Gemächer und verschloß hier die heiligen Bücher in einem eigenen kostbaren Schrein.
Als der Kaiser hörte, dass die Missionäre in ihrer Herberge durch das Geschrei der Vorübergehenden gestört wurden, ließ er ihnen in seinem Palaste selbst eine Wohnung bereiten, so daß er sie beständig in seiner umittelbaren Nähe hatte. Die Patres richteten nun eines der Zimmer zu einer bescheidenen Kapelle ein, wo sie das heilige Opfer feiern konnten. Über dem Altare hing ein Bild Unserer Lieben Frau vom Schnee (Maria Maggiore), eine der sechs Kopien, welche der hl. Franz Borgias hatte anfertigen lassen. Eine andere Kopie hatte der selige Ignatius von Azevedo [1527-1570] sterbend in seiner Hand gehalten. Akbar wünschte das Bild zu sehen. Beim Eintreten in die Kapelle wurde er durch die Majestät, die aus dem Bildnis strahlte, so ergriffen, dass er ihm unwillkürlich seine Huldigung darbrachte, und zwar zuerst nach mohammedanischer Sitte, aufrecht stehend, mit über der Brust gekreuzten Armen sich verneigend, dann nach christlicher Art, mit entblößtem Haupte und gefalteten Händen kniend, und endlich nach heidnischem Brauche sich auf den Boden werfend. Denn man müsse, so bemerkte er, die göttliche Majestät mit allen Ehrfurchtsbezeigungen verehren, die bei verschiedenen Völkern gebräuchlich seien. Nachdem er sich dann zu den Patres auf die Teppiche am Boden gesetzt, unterhielt er sich mit ihnen noch lange über Christus und seine heilige Mutter.
Acht Tage später kam Akbar unversehens, diesmal mit seinen drei Söhnen, drei hochstehenden Würdenträgern des Reiches und dem Obersten der mohammedanischen Mollas, zu einem zweiten Besuche in die Kapelle der Patres. Vor der Türe legten alle nach mohammedanischem Brauche ihre Fußbekleidung ab.
Bei dieser Gelegenheit machte Aquaviva dem Kaiser ein anderes, kunstvoll gemaltes Madonnabild zum Geschenk, das dieser mit großer Ehrfurcht küßte und auch seinen Söhnen und Begleitern zum Kusse reichte. Er wies demselben später in seinem Palaste einen Ehrenplatz an. Und da er es gleichsam als eine Schande für sich erachtete, daß so erhabene Wesen wie Christus und Maria – dies waren seine eigenen Worte – in seinem weiten Reiche nirgends verehrt würden als in jener ärmlichen Kapelle, während Mohammed ja viele Moscheen und Brahma so viele Pagoden besäßen, versprach er, dem Erlöser und seiner heiligen Mutter kostspielige Tempel zu bauen, wo und so viele die Missionäre wünschten.
Nach Jarric gab der Kaiser, wie es scheint bei derselben Gelegenheit, einem Goldschmied den Auftrag, nach dem Muster eines bronzenen Reliquiars, das die Patres in ihrer Kapelle hatten, ein würdigeres aus Gold zu verfertigen und mit ziselierten Darstellungen Jesu und Mariä zu schmücken. Ebenso ließ er von dem Altargemälde und andern Heiligenbildern durch seinen Hofmaler Kopien machen, wobei wohl auch seine große Vorliebe für europäische Malerei mit im Spiele war.
Akbar wandte den Missionären eine wahrhaft väterliche Fürsorge zu. So ließ er z. B. P. Monserrat, der, durch eine Krankheit aufgehalten, erst später eintraf, durch seinen eigenen Leibarzt behandeln, besuchte ihn persönlich, setzte sich an sein Krankenlager und sandte ihn zu einer Luftveränderung nach Agra, wo der Pater auch bald wiederhergestellt wurde.
Hocherfreut über diese guten Gesinnungen des Kaisers, dachten die Missionäre daran, ohne Verzug mit der Predigt des Evangeliums im Reiche zu beginnen. Allein bevor Akbar die Erlaubnis dazu gab, wünschte er, zunächst selbst im Christentum unterrichtet zu werden. Aquaviva erklärte sich bereit und bat, da die Staatsgeschäfte dem Kaiser nicht viele Zeit ließen, einen Tag in der Woche zu bestimmen. Akkbar setzte hierfür den Samstag fest, wünschte aber zugleich, damit ihm, wie er sagte, das Verständnis der vorgetragenen Wahrheiten erleichtert würde und weil es ihm so besser zusage, daß die christliche Religion auch bei den öffentlichen Disputationen in der Ibadat Chana zur Sprache käme. Demgemäß befahl er den gelehrtesten mohammedanischen Ulemas und Mollas, sich wohlvorbereitet zum Religionsstreit in Fatihpur einzufinden. Sie gehorchten und kamen in großer Zahl. Manche unter ihnen waren Männer von nicht geringem Geist und großer Gelehrsamkeit und traten, da sie sich als Vertreter des herrschenden Glaubens im eigenen Hause fühlten, mit großer Zuversicht auf. Ihnen stand als Verteidiger des christlichen Glaubens zunächst allein Aquaviva gegenüber. Denn P. Henriquez, der nur wegen seiner Vertrautheit mit der persischen Hofsprache mitgekommen, war kein Mann der Wissenschaft, P. Monserrat aber meist entweder krank oder von Fatihpur abwesend. Aquaviva hatte sich seinerseits bereits in Goa durch das Studium des Korans auf seine Aufgabe vorbereitet und schon auf der Reise die Anfangsgründe der persischen Sprache sich angeeignet. Eine portugiesische Übersetzung des Korans, die man von Goa mitgenommen, leistete gleichfalls gute Dienste. Ausgerüstet mit solidem theologischem Wissen, den scharfen Waffen scholastischer Dialektik und vor allem mit der machtvollen Überzeugung der Wahrheit und einem glühenden Verlangen, für die Wahrheit seines Glaubens zu kämpfen und zu sterben, trat Aquaviva auf den Kampfplatz.
6. Die Religionsgespräche
In der ersten Disputation kam im Anschluß an die feierliche Übergabe der heiligen Bücher des Alten und Neuen Testamentes die Frage über den göttlichen Charakter der religiösen Schriften beider Bekenntnisse zur Verhandlung. Aquaviva bewies siegreich den göttlichen Ursprung der Heiligen Schrift und stellte daneben in grellsten Gegensatz den lügnerischen und unheiligen Charakter des Korans. Er betonte unter anderem auch namentlich, daß das Evangelium in all seinen Teilen mit dem Alten Testament, sowohl in seinen sittlichen Vorschriften wie in seinen Vorbildern, die sich zu ihrer Erfüllung im Neuen Testament wie Abbild zum Urbild verhielten, völlig übereinstimmte, während der Koran dieser Übereinstimmung mit dem Alten Testament gänzlich entbehre.
Akbar, der von der Haltlosigkeit der Bücher des falschen Propheten längst überzeugt war, freute sich über die Niederlage der Mollas. „Wenn die Bücher Moses' und die Psalmen“, so führte er das Argument selbst weiter aus, „inspiriert sind, wie Mohammed selbst zugesteht, weshalb verbietet er dann deren Lesung?“ Auch stehe im Koran, daß das Evangelium Jesu Christi zu den wahren Offenbarungsschriften gehöre. Und doch stelle der Koran Lehrsätze und Vorschriften auf, die im vollsten Gegensatz zu jenen heiligen Büchern ständen. Der Ewige könne sich aber nicht widersprechen. Da nun beide Parteien darin übereinkämen, daß das Evangelium heilig sei, während die Christen dies vom Koran nicht einräumten, so verlange die Vernunft, letzteren zu verwerfen und das Evangelium anzuerkennen [1].
Drei Tage nach der ersten Disputation folgte die zweite. Die Patres brachten diesmal die Vorstellungen und Schilderungen des Paradieses zur Sprache, welches Mohammed seinen Anhängern verheiße, und brandmarkten den lüsternen und unreinen Charakter dieses Prophetenhimmels, der eher für Tiere als für unsterbliche Menschenseelen passe. Beschämt schwiegen die Mollas. Als der Kaiser ihre Verlegenheit gewahrte, griff er selbst ein und suchte ihre Sache zu retten, was ihm aber schlecht gelang.
Bei der dritten Besprechung hoben die Missionäre den Gegensatz hervor, der zwischen Mohammed und Christus in Bezug auf ihre göttliche Beglaubigung und ihren Charakter bestehe. Es war die glänzendste Disputation, von der wir Kunde haben. Für die Ankunft Mohammeds, betonten die Missionäre, für sein Gesetz und für sein angebliches Erlösungswerk sei auch nicht die leiseste Spur eines prophetischen Zeugnisses in den heiligen Schriften zu ermitteln, während Christus als Messias und Erlöser des Menschengeschlechtes von allen Propheten ohne Ausnahme so viele Jahrhunderte vor seiner Ankunft mit Erwähnung zahlreicher und genauer Umstände aus seinem Leben und Wirken, bis in geringfügige Einzelheiten hinein, vorherverkündet worden sei. Und Mohammed selbst müsse der Wahrheit Zeugnis geben, indem er Christus im Koran einen „Propheten“ und „Heiligen“ nenne. Darauf stellten sie den Stolz, die Anmaßung, das verbrecherische und sittenlose Leben des Propheten von Mekka dem wundervoll makellosen, heiligen, demutsvollen Leben des Heilandes gegenüber und verglichen dessen reine, erhabene, durch zahlreiche unumstößliche Wunder und durch die Heiligkeit seiner Glaubensboten beglaubigte Lehre mit den Fabeln, Lügen, lächerlichen Erfindungen des Korans, dessen Lehre den niedersten Leidenschaften schmeichle, den Geist des Hasses atme und durch Feuer und Schwert verbreitet worden sei.
Die Niederlage der Mollas war vollständig und ihre Verwirrung so groß, daß sie nach Jarric sich weigerten, mit den Patres noch ferner öffentlich zu disputieren. Doch dauerten die Religionsgespräche fort, und es kamen in der Folge noch verschiedene Glaubenswahrheiten zur Sprache, so besonders die allgemeine Auferstehung der Toten, das jüngste Gericht, die hinreichende und die wirksame Gnade u. a. m. Nicht im Stande, die ruhigen, klaren, teils aus der Vernunft, teils aus dem Alten Testament, teils endlich aus den sich widersprechenden Stellen des Korans geschöpften Beweisgründe zu entkräften, mit denen Aquavivas scharfe Dialektik sie in die Enge trieb, verwickelten sich die Mollas fortwährend in lächerliche Widersprüche, indem sie jetzt in Abrede stellten, was sie kurz zuvor zugegeben, später aber das Geleugnete abermals zugaben und schließlich unter sich selbst in Zank und grimmen Wortstreit gerieten, so daß Akbar sie wiederholt wegen ihres unwürdigen Benehmens scharf zurechtwies. Nicht selten verstummten sie auch plötzlich wie auf Verabredung und baten sich Zeit aus, um über die zu gebende Antwort zu beraten, oder sie gingen mit einer wegwerfenden, nichtssagenden Erklärung stolz erhobenen Hauptes von dannen.
7. Akbars schwankende Haltung
Sowohl die öffentlichen Disputationen wie der Privatunterricht, besonders aber das lebendige Beispiel der Patres machten auf den Kaiser unverkennbar einen tiefen Eindruck. Er erklärte offen, die christliche Religion sei die beste, die er bis jetzt kennen gelernt. Auch räumte er bereitwillig den übermenschlichen, durch Wunder beglaubigten Charakter Jesu Christi als eines göttlichen Gesandten ein. Nur die zwei Grundgeheimnisse der christlichen Lehre, die Dreipersönlichkeit Gottes und die Menschwerdung des Sohnes Gottes, wollte sein rationalistischer Geist nicht anerkennen. Immer und immer wieder verlangte er deren Erläuterung. Aquaviva hielt ihm entgegen, daß das volle Verständnis des Unendlichen naturgemäß sich dem beschränkten Menschengeist entziehe und daß die göttliche Religion deshalb notwendig unerfaßliche Geheimnisse enthalten müsse. Diese Lösung gefiel dem Kaiser, ohne ihn jedoch ganz zu befriedigen. Trotz seiner Verwerfung des Islams und seiner ungeheuchelten Bewunderung der christlichen Glaubens- und Sittenlehre kam er aus seinem eigentümlichen Schwanken nicht heraus. Schließlich meinte er, es sei überhaupt fraglich, ob der Himmel eine einzige bestimmte Religion geoffenbart habe und ob Gott nicht gerade deswegen uns im Dunkeln gelassen, weil er durch verschiedene Religionsformen verehrt werden wolle. Den inneren Widerspruch dieser Ansicht wollte er nicht einsehen, und er meinte, nur Wunder würden im Stande sein, ihn zur Unterwerfung unter ein bestimmtes Glaubensbekenntnis zu zwingen.
Als daher die Mollas, um die Scharte auszuwetzen, zur Entscheidung des Religionsstreites in echt mohammedanischer Gauklerweise eine Art Gottesurteil durch Feuerprobe vorschlugen, griff Akbar lebhaft den Gedanken auf und bat die Patres dringend, darauf einzugehen. Er wolle schon sorgen, daß der Molla zuerst ins Feuer müsse. Aquaviva wies die Zumutung mit edlem Stolze zurück, da die Wahrheit seines Glaubens hinlänglich durch Wunder bezeugt sei, wie Akbar selber zugebe, und solcher freventlicher Herausforderung Gottes nicht bedürfe. Er selber sei jeden Augenblick bereit, für seinen Glauben in den Tod zu gehen. In der Tat durfte Aquaviva hier, wo es sich bloß um die Befriedigung eines zweifelsüchtigen Königs und seines Hofes und um ein Zugeständnis an die wilde Leidenschaft der hinterlistigen Mollas handelte, nicht anders antworten. Er dachte an seinen göttlichen Meister vor Herodes und blieb fest bei seiner Weigerung.
Im Bewußtsein der eigentlichen Aufgabe seiner Sendung drängte Aquaviva dem ihm aufrichtig ergebenen Padischah wiederholt zu einer bestimmten Entscheidung. Der Kaiser wich aus. Ein so wichtiger Schritt wolle überlegt sein; doch höre er nicht auf, Gott um Erleuchtung zu bitten, da er selber nichts sehnlicher wünsche, als die Wahrheit zu erkennen. Deutlicher eröffnete er den Patres sein Herz bei einem gelegentlichen Besuche in deren Kapelle. „Ihr kennt die Gefühle der Hochachtung, die ich der Religion, so ihr mich gelehrt, entgegenbringe. Alles spricht zu ihren Gunsten. Die Wunder des Herrn, durch den Koran selbst bezeugt, die gesunde, reine Sittenlehre des Evangeliums, seine wunderbare Verbreitung auf dem Wege der Demut und Leiden führen mich mit unwiderstehlicher Beweiskraft zur Überzeugung, daß Jesus Christus wahrhaft ein gottgesandter Prophet ist. Erklärt mir die ewige Zeugung des Wortes aus dem Schoße des Vaters und seine wunderbare Menschwerdung in der Zeit, und ich will ohne Anstand alle Artikel unterschreiben, die ihr mir zu glauben vorhaltet.“
Die Missionäre blieben die Antwort nicht schuldig. Die Geheimnisse erklären hieße ihre Natur als göttliche Geheimnisse aufheben. Man müsse also von der Grundwahrheit ausgehen, die der Fürst selbst zugegeben, und aus ihr die entsprechenden Folgerungen ziehen.
„Ew. Majestät geben zu, daß Christus seine göttliche Sendung genugsam durch Wunder bewiesen hat, so daß selbst der Koran für die Wahrheit seiner Lehre Zeugnis ablegt. Er ist also ein gottbeglaubigter Gesandter des Himmels; folglich müssen wir seinem Worte Glauben schenken. Nun aber bezeugt er von sich, daß er vor Abraham war, daß er ewig, Gott dreipersönlich sei usw. Durch Wunder hat er die Geheimnisse, die er lehrte, göttlich beglaubigt. Sie müssen also wahr sein, auch wenn wir sie nicht begreifen können.“ Der Kaiser fühlte die Kraft dieser Beweisführung. Er war ergriffen und brach mit Tränen in den Augen die Unterredung ab, indem er wiederholt schmerzlich ausrief: „Ein Christ werden! Die Religion meiner Väter ändern! Welche Gefahr für einen Kaiser! Welche Schwierigkeit für einen Menschen, der in der Weichlichkeit und der Zügellosigkeit des Korans aufgewachsen!“
Diese Erklärung bewies den Patres jedenfalls, daß die bereits gewonnene Erkenntnis auf den Fürsten einen tiefen Eindruck gemacht hatte [2]. Sie mochten hoffen, durch genaueren Unterricht, durch Gebet und geduldiges Ausharren die letzten, freilich nicht geringen Schwierigkeiten zu überwinden. Aber es kam anders.
Schon längere Zeit hatte es in den Provinzen gegärt. Ende 1581 brach in Bengalen ein bedenklicher Aufstand los, der zu einem allgemeinen Religionskrieg auszuwachsen drohte. „Der Kaiser“, so lautete der Aufruf, „sei ein Abtrünniger vom Glauben des Propheten und deswegen jeder Rechtgläubige verpflichtet, ihm den Gehorsam aufzukündigen.“ Das Feuer der Empörung war durch die vom Kaiser gedemütigten Ulemas geschürt worden.
Ihr Grimm hatte sich anfangs namentlich auf die Missionäre entladen. „Diese verfluchten Mönche“, so macht z. B. Badaoni seinem Unmut Luft, „wandten die Beschreibung des Satans und seiner Eigenschaften auf Mohammed, den besten aller Propheten, an – Gottes Segen bleibe bei ihm und seinem ganzen Hause! - etwas, was die Teufel selbst nicht tun würden.“ Die Lage der Missionäre war zeitweise so bedrohlich geworden, daß der Kaiser Aquaviva eine Schutzwache beigeben wollte. Doch dieser schlug das Anerbieten standhaft aus. „Nein“, sagte er, „ein Apostel Christi ist genugsam geschützt durch das Vertrauen, das er auf Gott setzt. Besser ist es, zu sterben, als dagegen zu fehlen.“
Durch sein freimütiges Urteil über die Unsitte der Witwenverbrennung hatte sich Aquaviva auch den Haß der Hindus zugezogen. Seine Briefe aus dieser Zeit sind denn auch voll von Märtyrergedanken. „Mein größter Trost hier“, so schreibt er unter anderem an den General P. Mercurian, „ist, der Märtyrerkrone so nahe zu sein. Denn wir haben öffentlich vor den ersten Würdenträgern des Reiches unser Bekenntnis abgelegt und unsern Glauben nicht verleugnet; wir haben öffentlich erklärt, daß Mohammed ein Lügenprophet und Christus der wahre Sohn Gottes ist. Und so sind wir auf den Tod gefaßt, der uns nach ihrem Gesetze treffen muß.“ Freilich hielt die Furcht vor dem Zorn des Kaisers die Meuchelmörder zurück. Allein die öffentlich zur Schau getragene Abneigung des Padischah gegen den Islam und seine Hinneigung zum Christentum, infolgedessen das Gerücht seines Übertritts in weite Kreise gedrungen war, gab den Ulemas und den unzufriedenen mohammedanischen Großen die erwünschte Gelegenheit, durch Schürung des religiösen Fanatismus einen allgemeinen Aufstand aller Unzufriedenen im Reiche zum Sturze Akbars vorzubereiten. Der ehrgeizige Halbbruder des Kaisers, Mohammed Hakim [1553-1585], stellte sich an die Spitze der Bewegung.
Die Lage war gefahrvoll genug, und die Mollas benutzten die ernste Stimmung des Kaisers, um ihre verlorene Stellung wiederzugewinnen und die verhaßten Fremdlinge und deren Religion in Mißkredit zu bringen. Offenbar, so sagten sie, sei der Aufstand eine Strafe Gottes. Der Himmel würde eine solche Auflehnung nicht zulassen gegen einen Fürsten, den er bislang so sehr begünstigt, wenn dieser sich nicht von der Religion des Propheten abgewandt hätte. Diese allein habe ihn groß gemacht. Ihr solle er sich wieder zuwenden, und alles werde in Ordnung kommen. Die Folgte zeigte, daß diese Vorstellungen nicht wirkungslos geblieben waren. Zwar gelang es Akbar, teils durch seine Feldherren teils selber den Aufstand niederzuschlagen und seinen Halbbruder zur Unterwerfung zu zwingen.
Doch war seine Haltung zu den Missionären seit dieser Zeit auffallend verändert. Er vermied ihren Verkehr, ließ sie z. B., als sie ihm wegen der Ereignisse in Bengalen ihre Teilnahme aussprechen wollten, gar nicht vor. Nun fragten sie durch Abul Fazil beim Kaiser an, ob Seine Majestät fürder noch weiter sich in der christlichen Religion unterrichten lassen wolle oder nicht. Da dies der eigentliche Zweck ihres Kommens gewesen, hielten sie jeden Augenblick, den sie nicht dieser Aufgabe widmeten, für verloren.
Jetzt beschied sie der Kaiser zur Audienz, ließ es aber nicht zu einem ernsten Gespräch kommen, sondern vergeudete die Zeit mit unnützen, neugierigen Fragen. Auch fand der Vorschlag, die Disputationen wieder aufzunehmen, wenig Beifall, weil Akbar die Unruhen der Mollas fürchtete. Doch setzte er schließlich den folgenden Samstag dafür an. Aber wer nicht kam, war der Kaiser, der sich entschuldigen ließ und dann die Disputation, um nicht wortbrüchig zu erscheinen, auf den Montag festsetzte. Die Mollas hatten von allen Seiten ihre besten Kräfte herbeigezogen. Der ganze Hofstaat war zugegen und war Zeuge des glänzenden Sieges, den Aquaviva davontrug. Da griff der Kaiser persönlich ein und suchte durch einige Witze die Niederlage der Mollas zu vertuschen. Aber Aquaviva trieb auch ihn durch seine schlagende Beweisführung in die Enge. Trotzdem wurde die veränderte Stellungnahme des Kaisers so auffällig, daß nunmehr selbst am Hofe Zweifel an der Aufrichtigkeit des Kaisers laut wurden. Der Kaiser, so hieß es, habe die Patres nur aus wissenschaftlichem Interesse und zugleich in der Absicht an seinen Hof gezogen, um durch sie den Weg zu Handelsbeziehungen mit den Portugiesen zu eröffnen u. dgl. m. Richtiger und den eigenen vertrauten Äußerungen Akbars sowie den späteren Ereignissen entsprechender ist die Annahme, daß der Kaiser bloß äußerlich mit Rücksicht auf die drohenden politischen Unruhen seine Haltung änderte.
Es entstand nun für die Missionäre die Frage, ob sie das undankbare Arbeitsfeld nicht besser wieder verlassen sollten. Schon früher hatte der Provinzial Vicente Ruiz [Provinzial von 1574 bis 1583], dem Aquaviva über die Verhältnisse am Hofe genau Bericht erstattete, die Patres nach Goa zurückziehen wollen, davon aber auf die Vorstellung Aquavivas wieder Abstand genommen. Die veränderte Sachlage legte den Gedanken der Rückkehr von neuem nahe. Dieselbe war schon beschlossen, als Abul Fazil die Missionäre zurückzuhalten suchte. „Der Kaiser sieht euch gern am Hofe“, sagte er. „Bloß die Staatsklugheit hindert ihn, sich jetzt schon öffentlich für eure Religion zu erklären. Noch gestern sah ich ihn das heilige Evangelium voll Ehrfurcht auf sein Haupt legen, ein Zeichen der Verehrung, das er dem Koran nicht erweist. Harret also aus und gebt dem Plan, der durch euer Bemühen so weit gediehen, Zeit zu reifen.“
Wahrscheinlich hatte Abul Fazil dem Kaiser den Entschluss der Missionäre, sein Reich zu verlassen, mitgeteilt. Jedenfalls begann Akbar ihnen allmählich seine Gunst wieder voll und ganz zuzuwenden. Er besuchte sie häufig und sprach auch wieder viel von Religion. Früher schon hatte er ihnen seinen Lieblingssohn Pahari zum Unterricht übergeben; jetzt ließ er auch Selim, den Thronfolger, an demselben teilnehmen. Allein diese Beweise kaiserlicher Huld vermochten Aquaviva über die Untätigkeit, zu der er sich verurteilt sah und die seinen Eifer einem andern, fruchtbareren Arbeitsfeld entzog, nicht zu beruhigen. Er hatte von neuem an seinen Obern geschrieben, dass jetzt ein einziger Missionär beim Großmogul genüge, um die Augenblicke günstiger Stimmung auszunutzen und nebenbei die auswärtigen Schriften zu besorgen. In der Tat gab Akbar bald danach offen zu verstehen, dass er von der Bekehrung noch weit entfernt sei. „Ich bin“, sagte er, „an den Mohammedanismus mit Banden gekettet, die ich nicht zerreißen kann. Die Mollas des Palastes, die Sultanin und meine Mutter hören nicht auf, die Religion zu schmähen, welche ich beschütze. Noch härtere Kämpfe habe ich mit den andern Frauen zu bestehen. Aus Furcht, sie möchten alle entlassen werden, sobald mich die Annahme des christlichen Gesetzes an eine einzige Gemahlin gebunden, bieten sie alles auf, um mir Jesus Christus wieder aus dem Herzen zu reißen. Kurz, das Evangelium ist zu heilig, und meine Sitten sind zu verdorben.“
Aquaviva benutzte dieses offene Geständnis als Anlass, um die Erlaubnis zu seiner Rückkehr abermals zu erbitten. Der Kaiser empfand dies sehr. „Weißt du nicht, mein Vater, wie sehr mir deine Gegenwart notwendig ist? Je schwerer es mir wird, meine Fesseln abzustreifen, desto nötiger ist mir eine Hand, die allmählich den Knoten löst. Willst du mich verlassen, jetzt, da ich deiner am notwendigsten bedarf?“
Solch rührender Bitte konnte Aquaviva nicht widerstehen. Er ließ also seine beiden Gefährten allein ziehen. Nach andern Berichten war P. Henriquez schon früher nach Goa zurückgekehrt, während P. Monserrat die glänzende Gesandtschaft begleitete, die Akbar 1582/83 an den König Philipp von Spanien und Portugal und zugleich an den Papst und den General der Jesuiten abgeordnet hatte, die aber leider durch unerwartete Zwischenfälle in Goa zurückgehalten wurde. Aquaviva blieb also allein am Hofe zurück. Dass er immer noch hoffte, den Fürsten der Sache Gottes und dem großen Werk der Christianisierung Indiens zu gewinnen, beweist sein Brief an den Pater General Claudius Aquaviva, seinen Oheim (General seit 1581), vom April 1582, in welchem er fünf Gründe angibt, die Mission beim Großmogul noch zu halten.
„Erstens“, so schreibt er, „erweckt die Haltung des Kaisers jetzt größere Hoffnungen als je zuvor. Derselbe ist sehr begierig, das christliche Gesetz kennen zu lernen, und zeigt beim Unterricht über dasselbe viel größeren Eifer denn früher. Es gibt sich bei ihm auch wirkliche Hinneigung zum Christentum kund, obschon ihm große Hindernisse im Wege stehen. Die Liebe, die er uns erweist, und das Vertrauen, das er uns entgegenbringt, sind derart, dass er gar nicht weiter gehen könnte.
Zweitens hoffen wir, dass der jetzt dreizehnjährige zweitgeborne Sohn des Kaisers, namens Pahari, der von uns Unterricht in der portugiesischen Sprache und daneben auch in der christlichen Religion erhält, für die er Neigung zeigt, aus diesem Unterricht Frucht ziehen wird, da er einen sehr guten Charakter und große Anlagen hat. Früher war P. Monserrat sein Lehrer; jetzt bin ich es.
Drittens haben wir einen neuen heidnischen Volksstamm entdeckt, welchen man Bottan nennt. Derselbe hat seinen Wohnsitz jenseits Lahor, dem Indus zu. Es ist ein sehr gutmütiger Menschenschlag, welcher sich zu frommen Werken geneigt zeigt. Die Hautfarbe dieser Menschenrasse ist weiß. Es wohnen keine Mohammedaner unter ihnen. Deshalb glauben wir, dass bei Absendung zweier eifrigen Missionäre eine reiche Ernte unter ihnen und unter andern Heiden zu erwarten sein wird.
Viertens ist hier ein Greis, der Vater des kaiserlichen Sekretärs (Wahrscheinlich ist Scheik Mubarak von Ragor, der Vater Abul Fazils, des Günstlings Akbars, gemeint) auf welchen der Fürst alles Vertrauen setzt. Dieser Greis hat sich von der Welt (d.h. vom Hofe und weltlichen Verkehr) zurückgezogen, zeigt sich sehr tugendhaft und ist der Betrachtung göttlicher Dinge sehr ergeben. Er erscheint daher in guter Verfassung, den Samen des Glaubens in sich aufzunehmen. Er ist uns sehr zugetan und hört gern vom christlichen Glauben reden. Wir haben ihn wiederholt in seiner Wohnung besucht und aus seinem Umgang großen Trost geschöpft.
Fünftes befinden wir uns hier im wahren und eigentlichen Indien; denn dieses Reich ist gleichsam das Herz Indiens und der Durchgangsort für alle andern Teile Indiens und für viele Länder Asiens. Da nun die Gesellschaft Jesu in demselben einmal Fuß gefasst hat und von einem so mächtigen Kaiser und dessen Söhnen mit so großem Wohlwollen behandelt wird, so erscheint es nicht angezeigt, diesen Posten aufzugeben, bevor alle zu Gebote stehenden Mittel für seine Bekehrung versucht sind. Die bisherige Missionstätigkeit unserer Patres beschränkt sich auf das indische Küstenland.“
Das waren in der Tat Gründe, die zum Bleiben und geduldigen Ausharren dingend einluden.
8. Aquavivas Leben am Hofe Akbars
Es war kein geringes Opfer, das sich Aquaviva durch sein Verweilen am Hofe auflegte. Schon dessen sinnlich üppige Atmosphäre musste seiner reinen Seele gar balb zum Ekel werden. Aber dazu kam so vieles andere.
Der blutige Bekennertod, nach dem er so sehr verlange, so schrieb er bereits im September 1580 an P. Rugno Rodriguez, den Rektor des Jesuitenkollegs in Goa, liege freilich noch in weiter Ferne, „so ferne nämlich als der Tod des Kaisers selbst. Während aber der Martertod sich verzögert, fehlt es uns nicht an tausenderlei Gelegenheiten zu leiden. Wir sind mit inneren und äußeren Trübsalen so überhäuft, dass mir das Leben manchmal eine Last wird. Es gefiel dem Herrn, mir in dieser Mission noch nicht den Kelch zu reichen, der berauscht, sondern jenen, der voll des Mischtrankes (plenus misto) ist, da wir noch nicht bis aufs Blut widerstanden haben. Bei alledem bin ich zufrieden, jedoch so, dass wenn der Gehorsam die Bürde des Obern dieser Mission mir abnähme, meine Freude voll wäre, soweit man überhaupt von Freude sprechen kann inmitten eines verderbten Volkes, wo unsere Augen nur Sünden sehen und unsere Ohren nichts anderes hören als den widerwärtigen und fluchwürdigen Namen Mohammeds. Ich schreibe dies Ew. Hochwürden unter Tränen. In der Umgebung, in der wir leben, vernimmt man nur jenen teuflischen Namen, von dem alles widerhallt; der süße Name ,Jesus, Sohn Gottes´ aber wird fast niemals ausgesprochen. Denn die Mohammedaner betrachten Jesus nur als einen Propheten, nicht als den Sohn Gottes. Ich aber kenne keinen solchen Jesus und kann nur sagen: ,Jesus, der Sohn Gottes.´ Spreche ich ihn aber gelegentlich vor Auswärtigen aus, so bringt mir dies nur neues Leid und größere Betrübnis. Denn sobald einer dieser Muselmänner es hört, ruft er mir sogleich zu: Sta furlah! d.i. ,Gott verhüte es!´ Das ist der bei den Mohammedanern gebräuchliche Ausruf des Abscheus und des Entsetzens. Andere halten sich die Ohren zu, noch andere lachen höhnisch oder brechen in Flüche aus. Komme ich dann nach Hause, so wünschte ich, dass von den wenigen christlichen Seelen, die ich hier, gleichsam in der Arche Noes, finde, ja dass von den Wänden selbst mir nichts anderes entgegentönte als ,Sohn Gottes´, ,Sohn Gottes´. Aber es scheint mir dann, als ob mir nur zur Antwort würde: ,Wie sollen wir in fremden Landen das Lob des Herrn singen?´ (Ps 136, 4.)
Gehen wir zum Kaiser, um ihn zu unterrichten, so finden wir ihn in einem mühsamen Gebet begriffen, welches diese Mohammedaner mit solchem Eifer und mit solcher Sammlung und äußerer Ehrfurcht verrichten, dass man sich nicht genug darüber wundern kann. Aber alles das ist bloß Äußerlichkeit. Müssen wir doch selbst mit unsern Augen die Abscheulichkeiten mit ansehen, denen sich diese übertünchten Gräber hingeben. Kurz, hier gilt Mohammed alles.
Dieser Antichrist führt hier das Zepter. Zu Ehren dieses höllischen Ungeheuers wirft man sich auf die Knie, streckt sich auf die Erde aus, erhebt die Hände zum Himmel. Ob man Almosen gibt oder sonst ein Werk tut, alles geschieht in seinem Namen.
Und wir dürfen aus Rücksicht auf den Kaiser uns nicht einmal frei über solche Greuel aussprechen. Denn würden wir in der Kundgebung unserer Gefühle im Geringsten zu weit gehen, so brächten wir das Leben des Kaisers in Gefahr. So sterben wir nicht, weil man uns nicht zu töten wagt, leben aber auch nicht, weil unser Eifer uns verschmachten macht.“
Man lebe nur von Hoffnungen, und diese seien nicht wie die der armen Seelen von der Erwartung einer sichern Erfüllung getragen, sondern recht ungewiss. Zumal gelte dies von der Bekehrung des Kaisers. Gott allein, der Erforscher von Herzen und Nieren, wisse es. Indessen tröste der Gedanke, dass nichts, was im Dienste Gottes geschehe, verloren sei.
Ein weiterer Trost sei, dass sie das Glück hätten, alle Tage das Opfer ihres Lebens Gott dem Herrn darzubringen, „da wir uns an einem Orte befinden, wo Gott uns diese Gnade leicht zuwenden kann“.
„Es ist schwer zu sagen“, meint Manouchi, „von welcher Seite der Pater mehr zu leiden hatte, durch die Gunst des Fürsten oder durch die bittern Enttäuschungen, welche das unbeständige und ausschweifende Leben Akbars ihm bereitete. Die Freundschaft des Padischah weckte den Neid der Höflinge, seine offene, siegreiche Sprache den Hass des Mollas, der wiederholt sein Leben in Gefahr brachte.“
Besonders zu Zeiten, da Akbar abwesend war, hatte der Missionär viel auszustehen. Bei seinen Ausgängen in der Stadt schrien ihm ungezogenen Kinder, böse Weiber und andere mohammedanische und heidnische Lästermäuler Fremdling, Christ und noch öfters Feind Mohammeds oder Brahmas nach. Dabei stießen sie die heftigsten Drohungen aus, von deren Ausführung nur die Furcht vor der Rache des Kaisers sie abhielt. Aquaviva ertrug alles freudig aus Liebe zu Christus. „Ich habe hier“, so schrieb er schon früher einmal, „herrliche Gelegenheit, in der Heiligkeit Fortschritte zu machen. Wir sind hier der Gegenstand allgemeinen Hasses. Alle überschütten uns mit Unbilden und Drohungen. Das Messer sitzt uns gleichsam an der Kehle und wir sind ein Auswurf geworden für alle. Beten Ew. Hochwürden, dass wir uns all dieser Gnaden zu unserem geistlichen Nutzen bedienen.“
Inzwischen lebte er möglichst zurückgezogen ganz dem Gebet und dem Studium, das er bedurfte, um auf die Schwierigkeiten der Mollas zu antworten, da die Disputationen, solange der Kaiser in Fatihpur weilte, oft bis in die Nacht hinein fortdauerten. Die häufige und lange Abwesenheit des Fürsten ließ Aquaviva in großer Einsamkeit. Er benutzte die unfreiwillige Muße, um ganz seiner eigenen Vervollkommnung zu leben. Er ging nur aus, wenn ein Liebeswerk es verlangte. Fast Tag und Nacht brachte er im Gebete zu. Oft fand ihn die aufgehende Sonne noch da, wo er abends sich hingekniet. Nur wenige Stunden genoss er, auf einer Strickmatte ausgestreckt, der Ruhe. Seine Nahrung bildete fast bloß im Wasser gekochter Reis.
Noch später am Hofe sprach man bewundernd von den unerhörten Strengheiten des Padri Radalf, wie Abul Fazil nennt, und der Prinz Selim erzählte voll Rührung, wie er selbst Zeuge blutiger Geißelungen gewesen. Selbst der jesuitenfeindliche Graf v. Noer [Friedrich August von Noer, Orientalist, 1830-1881] stellt der Persönlichkeit Aquavivas in seiner Weise ein ehrenvolles Zeugnis aus. „Dieser Jesuit muss ein hochbegabter, sehr unterrichteter Mann, ein begeisterter Schwärmer gewesen sein. Akbar schätzte ihn sehr hoch und erleichterte ihm seinen Aufenthalt nach Möglichkeit. Er war ein strenger Büßer, ergriffen von der Heiligkeit seines Berufes, von Hindus und Moslim verehrt und ,ein Engel´ genannt.“ In der Tat flößte Aquavivas hohe sittliche Würde, die feine Liebenswürdigkeit seiner Umgangsformen, die Bescheidenheit und Höflichkeit, die er selbst mitten in der Hitze bei den Disputationen mit der größten Schlagfertigkeit zu vereinen wusste, auch seinen bittersten Gegnern Achtung und Ehrfurcht ein. Akbar selbst aber fand sich, je näher er den Mann Gottes, sein edles, selbstloses Wesen und seine Tugenden kennen lernte, immer mehr zu ihm hingezogen, so dass sich zwischen den beiden so ungleichen Männern eine Art Freundschaftsverhältnis herausbildete. Dennoch wurde es Aquaviva zu seinem Schmerze immer klarer, dass seine Hoffnungen auf die Bekehrung des Fürsten sich nicht erfüllten.
Als Akbar, berichtet Manouchi, von seinem siegreichen Feldzuge zurückkehrte, kannte ihn Aquaviva kaum wieder. „Der Sieg, der das Herz aufbläht, ließ den Kaiser die Demut des Kreuzes verachten, und die Zerstreuungen des Feldzuges hatten die guten Eindrücke wieder verwischt, die er aus dem täglichen Umgang mit dem Gottesmanne gewonnen.“ Aquaviva machte dem Kaiser, der ihm persönlich das größte Wohlwollen und Vertrauen bewahrte, die eindringlichsten Vorstellungen. Akbar hörte ihn freundlich an; aber aus seiner Antwort ersah Aquaviva, dass der Fürst von der Bekehrung weiter entfernt war denn je. Solange die Mohammedaner, so erwiderte er später auf Aquavivas erneutes Drängen, so mächtig seien und Mohammed selbst solche Ehren genieße, wie dies jetzt noch der Fall sei, bestehe nicht die geringste Aussicht, dass das Christentum in seinem Reiche festen Fuß fasse. Und wenn er, um das Gesetz Mohammeds zu Fall zu bringen, in dem einen oder andern Punkte die Hindus begünstige, so geschehe dieses nur, um sich ihrer treuen Anhänglichkeit zu versichern. Denn könnte er sich nicht auf die Heiden stützen, so würde ihm sein Vorgehen gegen die Mohammedaner den Thron kosten. Aus einem solchen siegreichen Aufstand gegen ihn würde schließlich nur der Mohammedanismus neu gekräftigt hervorgehen. Würde er aber gleichzeitig den religiösen Anschauungen der Mohammedaner und der Hindus entgegentreten, so setze er sich der Gefahr aus, dass beide vereint gegen ihn zu den Waffen griffen, und dann wäre eine Unterdrückung der Empörung nur durch ein Wunder möglich. Darum vertröstete der Kaiser Aquaviva auf günstigere Zeiten und wies auf die Hoffnungen hin, die dem Christentum im Prinzen Pahari, den sie ja christlich erzögen, heranwüchsen.
9. Rückkehr nach Goa und neuer Wirkungskreis auf Salfette.
Immer mehr wurde es Aquaviva klar, dass die persönliche Freundschaft, die ihn dem Fürsten so nahe gebracht, die tiefe Kluft nicht zu überbrücken vermochte, die zwischen dem Stolz und Wankelmut Akbars und der Annahme des christlichen Glaubens lag. Dazu kam das turmhohe Hindernis, das der kaiserliche Harem mit seinen Hunderten von Frauen und seinen sittlichen Ausschweifungen bildete. Nie und nimmer, so hielt der Gottesmann mit apostolischem Freimut dem Kaiser vor, dürfe er hoffen, ein ungetrübtes Auge für das reine Licht der Wahrheit zu erlangen, solange er ein Sklave unlauterer Lüste bleibe. Akbar entschuldigte sich mit der Sitte seines Volkes und der menschlichen Schwachheit, erklärte aber, dass weder der Harem noch irgend eine andere Rücksicht ihn aufhalten werde, das Christentum anzunehmen, sobald er einmal dessen Wahrheit voll und ganz erkannt hätte. Er stellte sogar in Aussicht, dass er unter dem Vorwand einer Pilgerreise nach Mekka sich in einem christlichen Lande taufen lassen werde und ähnliches. War es dem Kaiser ernst damit? Wir wissen es nicht. Sicher ist, dass der Same des Heiles auf dem harten und dornigen Boden nicht gedieh.
Gewissenhaft gab Rudolf seinem Provinzial über den Stand der Dinge Kunde. Das Missfallen des Kaisers, auf welchen der Provinzial Rücksicht zu nehmen geheißen habe, sei beim besten Willen nicht zu umgehen. „Im Übrigen sehe ich wohl ein, dass ich hier unnütz bin … Mein fester Entschluss ist, nur den Willen Gottes zu erfüllen. Und dieser muss mir durch Ihre Weisungen kund werden. Wie ich auf Ihren Befehl mein Zelt hier aufgeschlagen habe, so bin ich bereit, dasselbe auf Ihren Wink hin wieder abzubrechen.“
Endlich traf von Goa der bestimmte Befehl zu seiner Rückkehr ein. Erst jetzt zeigte sich, wie sehr Akbar an dem heiligen Manne hing. Aufs lebhafteste widersetzte er sich der Abreise, bat und beschwor Aquaviva, zu bleiben. Auf sein Haupt falle die Verantwortung, wenn er, der Kaiser, sich selbst überlassen, verloren gehe. Merkwürdigerweise bestürmten nun auch alle Würdenträger am Hofe und selbst die Mollas den Kaiser um die Wette, dem so ausgezeichneten Manne die Erlaubnis zur Abreise um jeden Preis zu verweigern. War das aufrichtig gemeint, so ersieht man daraus, welche Hochschätzung sich Aquaviva selbst bei seinen Feinden zu erwerben gewusst hatte. Der Missionär verwies auf den Befehl seines Obern, der keine Widerrede dulde, und erinnerte den Kaiser an sein fürstliches Versprechen freier Rückkehr. Akbar verlangte die feierliche Zusage, dass Aquaviva später, wenn immer möglich, an der Hof zurückkehre oder andere Missionäre zum Ersatze sende. Rudolf versprach es. Der Kaiser wollte dem Scheidenden reiche Geschenke aufdringen. Der Missionär wies sie zurück. Als Akbar darauf bestand, dem Freunde wenigstens ein Zeichen seiner Huld zu geben, benutzte Aquaviva die Gelegenheit, um einige unsterbliche Seelen zu retten. Er bat um die Erlaubnis, einen Russen aus Moskau samt seiner polnischen Frau und zwei Kindern, die zum kaiserlichen Haushalte gehörten und deren Seelenheil in der giftigen Atmosphäre äußerst gefährdet war, nach Goa mitzunehmen. Die Sultanin, welcher der Vater und die beiden Söhne sehr teuer wahren, widersetzte sich. Allein Akbar wollte diese einzige Bitte des verehrten Mannes nicht abschlägig bescheiden. Es war der einzige Reichtum, den Aquaviva nebst seinen Verdiensten vom Hofe des Großmoguls mitnahm. Die beiden Männer, die trotz so gewaltiger Gegensätze sich so nahe getreten, sollten sich nicht wiedersehen. Beide gingen zu neuen, aber himmelweit verschiedenen Kämpfen und Siegen auseinander, Akbar zu neuen Eroberungen und irdischen Triumphen, Aquaviva, um die Märtyrerkrone zu erlangen, die er im Reiche des Großmoguls umsonst gesucht hatte.
Im Mai 1583 traf Rudolf wieder in Goa ein, von seinen Mitbrüdern, die ihn wie einen Heiligen verehrten, mit lautem Jubel begrüßt. Rudolf dachte anders. Als er die Kunde vom Martertod der sel. PP. Edmund Campion und Alexander Briant S.J. in England erfuhr, rief er seufzend aus: „Das, ja das waren Männer! Wir armselige Wichte sind solcher Gnade nicht wert.“ Er war ihr näher, als er ahnte; noch im selben Jahre 1583 sollte seine Sehnsucht nach der Märtyrerpalme sich erfüllen.
Es galt nun, dem ausgezeichneten Arbeiter ein neues, würdiges Feld der Tätigkeit anzuweisen, und ein solches hatte sich eben gefunden.
Drei Meilen südlich von Goa lag die kleine, aber volkreiche Halbinsel Salsette (wohl zu unterscheiden von der gleichnamigen Insel nördlich von Bombay). Sie war 1543 vom König von Bejapoor [Bijapur] an die Portugiesen abgetreten worden und zählte in 66 Ortschaften bei 88000 Einwohner, meist Hindus. Nirgends hatte sich das alte Heidentum hartnäckiger gezeigt als hier; zählte doch die Halbinsel bis 1560 kaum mehr als 100 Christen. In diesem Jahre wurde die Missionierung der Halbinsel vom Vizekönig Konstantin de Braganza den Jesuiten übertragen. Aber trotz ihrer Anstrengungen stieg die Zahl der Bekehrten in zehn Jahren kaum auf 2000. Noch standen überall die zahlreichen prächtigen Pagoden, und stolz schauten die Heiden auf die schmucklosen hölzernen Kirchen der Christen. Braganza drängte auf die entschiedene Ausführung der königlichen Verordnungen, die in den neueroberten Ländern die Zerstörung und Ausrottung des heidnischen Götzendienstes als eine der ersten und heiligsten Pflichten betonten. Man hat diese Politik der alten katholischen Seemächte als unduldsamen Vandalismus verdammen zu müssen geglaubt. Sie ging aber hervor aus den Anschauungen jener strenggläubigen Zeit, die den unsittlichen, schändlichen, der Vernunft und dem Naturgesetz widerstrebenden Gebräuchen und Kulthandlungen des Heidentums nicht gleichgültig und untätig gegenüberzustehen vermochte.
Die neuen Verordnungen schürten den heidnischen Fanatismus zu hellen Flammen auf. Es kam zum Kampfe, und die siegreichen Portugiesen ließen in dem einen Jahre 1567 an 280 größere und ungezählte kleinere Pagoden in Trümmer sinken. Es war die Pflügearbeit einer neuen, hoffnungsvollen Saat. Das Christentum gewann nun mehr und mehr an Boden. In Rachol, dem Hauptorte von Salsette, erstand ein Kolleg der Jesuiten; überall wurden oft in unmittelbarer Nähe der noch heidnischen Dörfer und Kultstätten Kreuze und Kapellen errichtet. 1583 zählte die Halbinsel bereits 25 Kirchen und 8000 Christen unter 15 Jesuitenmissionären. Freilich waren diese Erfolge nur unter fast beständigem Kampf mit dem Heidentum errungen worden, das seine frühere Stellung nicht verschmerzen konnte. Was Gewalt nicht vermochte, sollte List erreichen. Durch Geld wussten sich die Indier am portugiesischen Hofe mächtige Gönner zu erwerben, die für eine Zurückziehung der früheren königlichen Verordnungen wirkten. Wirklich war bereits ein Dekret zu ihren Gunsten ausgefertigt, als P. Alfons Pacheco S. J. [1551-1583, 1893 seliggesprochen], der damals als Prokurator von Indien in Europa weilte, durch persönliche Vorstellung bei Philipp II. (Portugal war seit 1580 mit Spanien vereinigt) die Intrige vereitelte. Dies gab auf Salsette das Zeichen zu einer neuen Empörung. In eilig erbauten Tempeln feierten die Heiden ihre Orgien, verweigerten die Steuern, verbrannten die Wohnungen und Kirchen mehrerer christlicher Gemeinden. Der Vizekönig Don Franzisco Mascarenhas unterdrückte den Aufruhr mit Waffengewalt, und wieder zerstörten die Portugiesen unter Anführung des feurigen P. Peter Berno S. J. [1552-1583] eine Reihe von Götzentempeln. Bei dieser Gelegenheit tötete letzterer in seinem heiligen Eifer mit eigener Hand eine den Brahmanen heilige Kuh und warf ihre Eingeweide in ein zu götzendienerischen Verrichtungen bestimmtes Waschgefäß. Durch Vermittlung P. Pachecos wurde zwar der Friede hergestellt, und scheinbar herrschte auf Salsette wieder volle Ruhe; Aber unter der Asche glomm der Funke des Hasses. Es bedurfte nur eines leichten Luftzuges, um ihn zu hellen Flammen wieder anzufachen.
So war die Lage, als Aquaviva Anfang Juli 1583 nach Salsette kam, um sein neues Amt als Rektor des Kollegs von Rachol, im Mittelpunkte der Mission, anzutreten. Kein Mann schien so geeignet, die schwierigen Verhältnisse zu regeln und eine allmähliche bleibende Versöhnung der Geister herbeizuführen, als Aquaviva, der mit einem glühenden Seeleneifer große Selbstbeherrschung verband und dem die Kunst, durch seinen Umgang die Menschen zu gewinnen, in hohem Grade eignete.
Nachdem der neue Obere in stiller Zurückgezogenheit frische geistige Kraft geschöpft, beriet er sich mit den versammelten Patres über die zu treffenden Maßregeln. Man beschloss, die wichtigsten Punkte der Insel zu besuchen, um an Ort und Stelle die Bedürfnisse der Mission kennen zu lernen, die Christen im Glauben zu festigen, die Heiden durch Güte und Milde, die Rudolf vor allem betonte, zu gewinnen und zugleich die geeignetsten Plätze ausfindig zu machen, wo nach der Sitte der damaligen Missionäre weithin sichtbare Kreuze errichtet und neue Kirchen gebaut werden sollten. Als Begleiter wählte Aquaviva die PP. Alfons Pacheco, Peter Berno, Anton Francisco und den Laienbruder Franz Aranha. Lernen wir diese Männer, die, ohne es zu ahnen, am Vorabend ihres Martertods standen, etwas näher kennen.
Alfons Pacheco stammte aus eine altadligen spanischen Familie, die in Minaya im Katalonischen ihre Stammgüter besaß. Als achtzehnjähriger Jüngling trat Alfons 1567 in die Gesellschaft Jesu ein. Lange hatte er seine Obern umsonst gebeten, ihn nach Indien zu schicken. Als endlich der Provinzial mit seinen Räten über die endgültige Bestimmung Pachecos zu entscheiden hatte, rief der junge Ordensmann sämtliche Mitbrüder des Kollegs in die Kapelle zusammen, wo sie dem Heiland ein „wichtiges Anliegen“ empfehlen sollten. Inzwischen klopfte, wie der alte Biograph sich ausdrückt, Alfons selbst durch eine blutige Geißelung an der Himmelspforte an, und zwar mit Erfolg. Freudestrahlend eilte er in die Kapelle und flüsterte seinen betenden Mitbrüdern zu: „Nun könnt ihr wieder an die Arbeit gehen, die Sache ist gewonnen.“ In Goa versah er zuerst das Amt des „Hauswirtschafters“ (Ministers) und längere Zeit das des Vizerektors. Dann wurde er Sekretär und Gehilfe des Provinzials. Dieser sandte ihn 1580 als Mann seines Vertrauens zur Erledigung wichtiger Geschäfte nach Europa. „Ew. Paternität“, so lautete das Begleitschreiben des Provinzials an den General P. Mercurian, „können sich auf ihn verlassen, als ob ich persönlich käme; denn er besitzt eine außerordentliche Klugheit und Erfahrung… Vor allem aber ist er ein echter Jesuit. Ich bitte und beschwöre daher Ew. Paternität, ihn mir um jeden Preis wieder zurückzuschicken. Ich würde es als ein schweres Unglück für unsere Provinz (von Goa) betrachten, wenn dieselbe ihn verlieren würde.“ In der Tat kehrte Pacheco 1581 nach Erledigung seiner Geschäfte mit 13 neuen Missionären nach Indien zurück. Er wurde dort Seelsorger und „Vater der Christen“ auf der Insel Salsette, deren Liebe er sich in hohem Grade erwarb.
P. Peter Berno, geboren am 2. Juli 1552 zu Ascona am Locarnosee im heutigen Schweizerkanton Tessin, trat nach Vollendung seiner Studien im Deutschen Kolleg zu Rom als neugeweihter Priester 1577 in die Gesellschaft Jesu und wurde vom Ordensgeneral Mercurian im selben Jahre noch der für Indien bestimmen Schar beigesellt. Er war eine außerordentlich feurige, tatkräftige Natur. Rasch lernte er die Landessprachen und wirkte seit mehreren Jahren schon auf Salsette mit rastlosem Eifer. Auf seinen Wanderungen setzte er gewöhnlich schwimmend über die Flüsse. Keinen hassten die Heiden so wie ihn, da er an der Zerstörung ihrer Götzentempel am eifrigsten mitgeholfen und einen göttlich verehrten riesigen Ameisenhaufen unbarmherzig zerwühlt hatte. Wie prophetisch äußerte er von Coculin, einem Hauptneste des Heidentums, dort sei der Boden noch zu hart und müsse erst durch Märtyrerblut befeuchtet werden. Sein eigenes Blut sollte bald als fruchtbarer Tau dort niederfallen.
P. Anton Francisco, ein Portugiese, wurde noch als Universitätsstudent zu Coimbra durch das Martyrium des seligen Azevedo und Genossen für die Mission begeistert. Seit jener Zeit hatte er täglich im Augenblick der heiligen Wandlung um die Gnade des Martyriums gebeten. Er war unter den 13, die Pacheco nach Indien mitgebracht, vollendete in Goa seine Studien, wurde Priester und ward dann für die so schwierige Mission auf den Molukken bestimmt, als ein furchtbarer Sturm ihn wieder zurücktrieb. Er wirkte erst seit drei Monaten auf Salsette in der Christengemeinde von Orlim, als er die Märtyrerkrone erlangte.
Der fünfte im heiligen Bunde war der portugiesische Laienbruder Franz Aranha, Neffe des früheren Erzbischofs von Goa, Don Gaspar Aranha, dem er nach Goa gefolgt war. Obgleich er Studien gemacht hatte, wollte er aus Demut in den Stand der Laienbrüder aufgenommen werden. P. Aquaviva hatte ihn als Begleiter verlangt, da der Bruder als geschickter Baumeister die Plätze für die neu zu errichtenden Kirchen auswählen und deren Bau leiten sollte.
10. Der Tod des Bekenners.
Coculin, der Hauptherd der Empörung, sollte zuerst besucht werden. War hier die Sache gewonnen, so dachte man, würde der übrige Teil der Insel leicht nachfolgen. P. Anton Francisco, der Coculin zunächst wohnte, hatte die Ankunft der Patres in einem auf Palmblatt geschriebenen Briefe den Vornehmen des Ortes angezeigt. Ein Mann von großer Tugend und Fähigkeit, der kürzlich erst von einer Reise zum Großmogul zurückgekehrt, sei Oberer von Salsette geworden. Er komme, um alle Streitigkeiten beizulegen, den angerichteten Schaden nach Kräften gutzumachen und Frieden und Trost zu bringen. Man möge ihn also gut aufnehmen; der Vizekönig werde dies als eine Genugtuung für die neuliche Empörung ansehen. Die mündliche Antwort lautete kurz und kalt: Man sei in Coculin nicht in der Lage, die Patres nach Gebühr zu empfangen, da die Einwohnerschaft wegen eines kürzlich geschehenen Mordes aufgeregt und entzweit sei. Doch stehe es den Patres frei, zu tun, was sie wollten, da ja Coculin und ganz Salsette im Besitz des Königs von Portugal sei. Diese Antwort zeigte deutlich die feindselige, drohende Stimmung. Allein der feurige P. Berno rief aus: „Was liegt uns daran, wie wir empfangen werden? Gehen wir, errichten wir das Kreuz und die Kirche, und wenn sie uns am Bauen sehen, werden sie selbst mit Hand anlegen!“
P. Francisco hatte über den Fluss eine Brücke schlagen und in der Nähe von Coculin eine Nothütte errichten lassen, wo man gegen den tropischen Regen – es war gerade die Regenzeit – Schutz finden konnte.
So brach der denkwürdige 15. Juli an, der Gedächtnistag des seligen Ignatius de Azevedo und Genossen. (Nach dem gregorianischen Kalender war es der 26.) Die Patres lasen in der Kirche von Orlim der Reihe nach die heilige Messe und machten sich bei schon vorgerückter Tageszeit auf den Weg nach Coculin. In ihrer Begleitung waren zwei Portugiesen, darunter der Schreiber des Kommandanten von Rachol, und etwa 50 eingeborne Christen. Auf dem Wege unterhielten sich die Missionäre von ihren Hoffnungen, zeigten fröhlich auf die Ruinen der zerstörten Pagoden und sahen sich nach einem günstigen Platze um, wo die Tempel des wahren Gottes sich erheben sollten. In der Nähe von Coculin herrschte eine unheimliche Stille. Niemand kam ihnen entgegen, sie zu begrüßen. Da plötzlich sahen sie einen ungeordneten Haufen von halbnackten schreienden Weibern und Kindern aus dem Dorfe kommen, unter Anführung eines Götzendieners, der wild mit Armen und Beinen um sich schlug und mit den Händen Erde und Staub in die Luft warf. Drohende Rufe wie: „Auf, da sind sie, der Augenblick der Rache ist nahe!“ drangen an das Ohr der Missionäre. Diese wussten nicht, was das bedeuten sollte, zogen sich in die für sie bereitete Hütte zurück und schickten einen Boten in das Dorf, der ihre Grüße überbringen und um die Erlaubnis bitten sollte, an Stelle jener Hütte ein Haus zu errichten. Der Bote fand unfreundliche, drohende Mienen. Man wisse sehr gut, was die Patres vorhätten, und werde sich danach richten. Doch kam nun einer der Gazari (Vornehmen) zu den Missionären hinaus und gab heuchlerisch seinem Bedauern Ausdruck, dass man sie so wenig gastfreundlich empfangen. Auf die Frage, was jener drohende Lärm bedeuten sollte, gestand er, dass Pondu, ein berühmter Götzenpriester, die Menge gegen die Patres aufgehetzt. Doch werde es ihm gelingen, das Volk zu beruhigen. Sie sollten inzwischen ruhig ihre Mahlzeit einnehmen. Auf das Anerbieten Aquavivas, zwischen den streitenden Parteien vermitteln zu wollen, gab der Gazari zur Antwort, er wolle darüber mit seinen Stammesgenossen reden.
Nach seinem Weggang wurde der Lärm im Dorfe immer bedrohlicher und ließ das Schlimmste befürchten. Man beschloss also, nach Hause zurückzukehren und das Vorhaben zu verschieben, bis die Aufregung sich etwas gelegt habe. Da aber ein Platzregen niederrauschte, suchten die Missionäre wieder Schutz in der Hütte, nahmen hier ihr einfaches Mahl und besprachen den Plan, an der Stelle einer nahen Tempelruine die Kirche zu bauen. Einige ihrer Begleiter gingen auch gleich dahin, um den Platz auszumessen. Spione aus dem Dorf hatten das Gespräch der Missionäre belauscht. Ihr Bericht verursachte im Dorf eine furchtbare Aufregung. Wüster Lärm drang in die Hütte herüber. „Was ist das?“ fragten die Missionäre. Scherzend rief einer der christlichen Indier, der den wegeilenden Spionen zum Trotz das Zeichen der Erlösung auf das Dach gepflanzt hatte: „Das ist der Teufel, der merkt, dass er weichen muss!“ Allein bereits brachte ein anderer indischer Begleiter der Patres, der ins Dorf auf Kundschaft gegangen war, die Nachricht, man habe dort auf Anstiften der Zauberers soeben den Tod der Missionäre beschlossen. „Man müsse die fünf Hähne (d.h. die fünf Patres)“, so habe der Götzenpriester wie besessen geschrien, „schlachten; bloß ihr Blut könne die Götter besänftigen.“ Im selben Augenblick kam auch ein wohlgesinnter Heide, der am Morde keinen Anteil haben wollte, herbeigestürzt und rief den Patres zu, sich rasch zu flüchten. Dieselben beschlossen denn auch, der Gewalt zu weichen. Allein es war bereits zu spät.
Auf dem Wege zum Flusse hörten sie hinter sich das Geschrei der nachstürzenden Menge, welche die christlichen Indier, die sich ins Dorf gewagt hatten, mit Lanzen und Pfeilen verfolgten. Beim Anblick der Missionäre erhob sich der Mordruf: „Nieder mit den Feinden unserer Götter!“ Angefeuert durch den rasenden Pondu, wälzte sich die Menschenflut von drei Seiten – denn zwei Abteilungen hatten heimlich den Weg zum Flusse verlegt – auf die wehrlosen Missionäre. Umsonst warfen sich die treuen eingebornen Christen händeringend ihren heidnischen Stammesgenossen entgegen, um sie von dem Morde abzumahnen. Die Patres sahen, dass ihre Stunde gekommen, erhoben ihre Hände gen Himmel zum letzten Gebet und erwarteten ruhig ihre Mörder. Gonzalez Rodriguez, der portugiesische Staatsschreiber, legte auf die vordersten Angreifer seine Muskete an. Pacheco aber fiel ihm in den Arm und riss die brennende Lunte fort mit den Worten: „Wir sind nicht gekommen, um zu töten, sondern um zu retten.“ Einer der Indier bot Aquaviva sein Pferd an. Noch war Rettung möglich. Freundlich lehnte Rudolf ab. „Jetzt ist nicht die Zeit zu fliehen“, sagte er mild, „sondern zu kämpfen und zu siegen“, und zu seine Gefährten gewandt, rief er aus: „Wohlan, lasst uns Auge und Herz zum Himmel erheben und ihn um seine Gnade bitten für die Stunde der Entscheidung!“
Nach dem Bericht der Augenzeugen, denen wir die genauen Umstände verdanken, traf die Mörderhand alle fünf Bekenner fast zur selben Zeit. Rudolf war der erste, der fiel. „Wo ist der große Vater (der Obere)?“ schrien die Heiden. Als man auf Rudolf hinwies, sauste auch schon ein indischer Säbel nieder, der ihm die Kniesehnen durchschnitt. Der Getroffene stürzte in betender Stellung nieder. Bereitwillig beugte er sich nach vorn, öffnete mit eigener Hand den Kragen seines Ordensgewandes und bot seinen Hals zum Todesstreich. In dieser Stellung hatte er schon früher zu knien sich gewöhnt, wenn er Gott im Gebete das Opfer seines Lebens brachte. Ein zweiter Hieb traf seinen Nacken, ein dritter löste den einen Arm fast ganz von der Schulter, ein Pfeil, der seine Brust durchbohrte, brachte die Todeswunde. Seine letzten Worte waren: „Oh Herr, verzeihe ihnen! Heiliger Franz Xaver, bitte für mich! Herr, nimm auf meine Seele!“ Noch später sprachen einige der Bekehrten, die damals unter seinen Mördern waren, mit Rührung von der heiligen Bereitwilligkeit, die der Märtyrer im Sterben gezeigt.
In ähnlicher Weise fielen die andern. P. Berno, der den Hass der Heiden am meisten heraufgerufen, wurde grässlich verstümmelt und sein Leichnam in der schmählichsten Weise entweiht. Sehr schön starb P. Pacheco, der mit ausgebreiteten Armen seinen Feinden entgegen ging. Als ein Lanzenstich ihn in die Brust traf, rief er aus: „O Herr! Auch du wolltest aus Liebe zu uns von einer Lanze dich durchbohren lassen. Durch deine heilige Seitenwunde bitte ich dich, verzeihe diesen Ungläubigen und sende ihnen andere Glaubensboten.“ Ein Stich in die Kehle erstickte seinen letzten Liebesseufzer: „Jesus!“
Mit fanatischem Jubel tanzten die Heiden um ihre Opfer. „Jetzt kommt“, riefen sie höhnisch, „taufet uns und macht uns zu Christen; auf, errichtet Kreuze und Kirchen und zerstört unsere Tempel und Götterbilder!“ Dabei ließen sie ihre Wut an den blutigen Leichen aus.
Mit den Missionären erlitten noch 15 Christen den Tod; darunter zwei indische Knaben, Domenico und Alonso, die den Patres als Ministranten und Begleiter gedient hatten. Domenico, der aus Coculin selbst gebürtig war, hatte die Wut der Heiden besonders auf sich gezogen, weil er dem P. Berno die Orte gezeigt, wo sie ihre Götzen und Heiligtümer versteckt gehalten. Sein eigener Onkel stach ihn nieder. Alonso trug das Brevier P. Pachecos. Umsonst suchten die Heiden es ihm zu entreißen; er ließ es nicht los, bis ein Säbelhieb ihm beide Hände abschlug. Auch zwei vornehme indische Jünglinge, Paolo Acosta und Francisco Rodriguez, starben mit ihren Vätern. Letzterer, ein lebhafter Charakter, hatte den Patres, so oft sie ihn ermahnten, stets geantwortet: „Nur Geduld, ich werde einst noch ein Märtyrer und löse dann mit einer einzigen Zahlung alle meine Schulden.“
Freudetrunken kehrten die Heiden in ihr Dorf zurück, umringten ihre Götzen, legten ihre bluttriefenden Waffen huldigend zu deren Füßen nieder und bestrichen die Götterfratzen mit dem Blute der Märtyrer. Dann ging man zurück, um die Leichen aus Furcht vor dem Zorn des Vizekönigs zu verbergen. Eine fehlte. Es war Br. Aranha, der noch lebend sich todesmatt in ein nahes Gebüsch geschleppt hatte und dort sich auf den Tod vorbereitete. Er wurde im Triumph ins Dorf getragen, vor das Götzenbild gebracht und aufgefordert, ihm zu huldigen. „Bin ich etwa ein unvernünftiges Tier“, erwiderte der Sterbende in heiligem Zorn, „dass ich wie ihr ein Stück Holz oder Stein anbeten soll?“ Ein Axthieb spaltete seinen Kopf; dann wurde er an einen Pfahl gebunden und mit Pfeilen so durchschossen, dass sein Leib nach dem alten Bericht einem Sieb glich.
Die Leichen wurden dann in eine Pfütze versenkt und Baumstämme und Reisig darüber aufgeschichtet.
Die Trauer und Bestürzung, welche die erste Nachricht vom Tode der Bekenner in Goa bei den Mitbrüdern hervorrief, ging rasch in freudige Begeisterung über, galt doch jener Zeit die Märtyrerkrone als höchstes Ziel des Missionsberufes. Die Bevölkerung aber geriet in solche Aufregung, dass der Vizekönig nur mit Mühe den allgemeinen Ruf zu den Waffen beschwichtigte.
Nicht ohne Schwierigkeit wurde die Auslieferung der Leichen durchgesetzt. Dieselben wurden feierlich erhoben, in glänzender Prozession zunächst in die Kapelle des heiligen Anton, dann in die Kirche U. L. F. vom Schnee in Rachol gebracht und in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli in einer Gruft am Seitenaltar beigesetzt. 14 Jahre lang hüteten die Einwohner von Salsette, wo das Christentum jetzt rasch und fröhlich aufzublühen begann, diesen teuren Schatz. Bereits acht Jahre nach dem Tode der Bekenner erhob sich auf dem Schauplatz des Martyriums die Kirche U.L.F. von den Märtyrern. 1597 wurden die ehrwürdigen Überreste in die Paulskirche in Goa, 1793 zeitweise in das Seminar von Thorar und 1863 in die Kathedrale übertragen. Die öffentliche, durch wunderbare Erhörungen genährte Verehrung in Indien und Europa begann gleich nach dem Tode der Bekenner, und Teile ihrer heiligen Überreste wurden mit Gutheißung Roms in Italien und Spanien in verschiedenen Kirchen ausgestellt, bis die neuen strengen Bestimmungen Urbans VIII. 1638 dem öffentlichen Kulte Einhalt geboten. Benedikt XIV. ließ den Prozess der Seligsprechung wieder aufnehmen; derselbe blieb aber, wie so mancher andere, infolge der Aufhebung der Gesellschaft Jesu liegen. Erst Papst Leo XIII. erhob Aquaviva und seine Genossen am 16. April 1893 auf die christlichen Altäre.
Doch wenden wir jetzt den Blick noch einmal zurück nach dem glanzvollen Hofe Akbars, wo Aquaviva drei Jahre lang einst geweilt. Als die Nachricht vom Tode des Seligen dorthin gelangte, war die Trauer, selbst bei den grimmigsten Mohammedanern, eine allgemeine. Akbar brach in lautes Schluchzen aus und gab seinem Schmerze mit den Worten Ausdruck: So werde er also nie mehr diesen Engel an seinem Hofe wiedersehen. Er bedauerte bitterlich, dass er den herrlichen Mann habe ziehen lassen.
Die Erinnerung an Aquaviva lebte am Hofe fort, und sie war es, die nicht lange danach, 1591 und 1594-1759, zur Wiederaufnahme der Mission im Reiche des Großmoguls führte, deren Mittelpunkt später die herrlichen kaiserlichen Residenzstädte Agra, Lahor und Delhi wurden.
Freilich, der nächste Zweck wurde auch diesmal nicht erreicht. So huldvoll sich Akbar gegen die Missionäre auch zeigte, und obschon er sich zum Christentum stärker wie jemals hingezogen fühlte, zum letzten entscheidenden Schritte fand er den Mut nicht. Fast plötzlich raffte der Tod den gewaltigen Herrscher am 27. Oktober 1605 hinweg. Kein Missionär wurde ins Sterbezimmer zugelassen.
Unter Akbars Nachfolgern dehnte sich das Großmogulreich vorerst noch weiter aus, um dann seit 1700 rasch wieder zu zerfallen. Der tiefste Grund seines Niedergangs und seiner Schwäche war gerade die religiöse Spaltung, die Akbar einst durch Einführung einer Einheitsreligion zu heben gedachte. Dass er diese Rolle statt dem Christentum der Ilahi-Religion, diesem wunderlichen Gebilde seiner eigenen Phantasie, zuwies, war eine traurige Verirrung.
„Allerdings hätte Akbar“, so schreibt Müllbauer, „bei einem Übertritte zum Christentum viel gewagt, aber ihm, welcher die Liebe der vielen Millionen, die er beherrschte, besaß, wäre es immerhin möglich gewesen, den Mohammedanismus mit dem Christentum zu vertauschen, ohne die Ruhe des Reiches wesentlich zu gefährden.“ Und so hat die Hoffnung, die zeitweise die Missionäre belebte, es möchte Indien in Akbar seinen Konstantin oder Karl den Großen finden, sich nicht erfüllt.
Anmerkungen:
[1] Ausführlich handelt über diese Disputationen Souza, Do Oriente Conquistado c.1, dir. 2, n. 61 ff. Ihm lagen die genauen Berichte der Missionäre über die Vorgänge am Hofe vor. Der Dabistan (The Dabistan, transl. by Shea and Troyer, Paris 1848), die ausführlichste einheimische Quelle, die über diese Religionsgespräche berichtet, faßt das Ergebnis der Disputationen zwischen „Muselmann“ und „Nazarener“ (Jesuiten) in die Worte zusammen: „Der Muselmann wurde zu Schanden gemacht.“ Nach ihm hatten auch Juden, Parsis, Hindus und der Hofphilosoph Akbars an den Disputationen teilgenommen. „Dem Padri Radalf (Aquaviva)“, so bezeugt Abul Fazil in seiner Geschichte Akbars, „war keiner der christlichen Lehrer an Geist und Wissen gleich. Einige nörgelnde Eiferer suchten zwar ihn zu widerlegen, allein er zerriß ihre Einwürfe in Fetzen und beschämte sie.“ Vgl. Fanthome, Reminiscences of Agra. 2. ed., Calcutta 1895, 53.
[2] Daß die so hoch über allen andern stehende christliche Religion den Kaiser machtvoll ergriffen und zeitweise nahe an die Schwelle des Glaubens geführt hatte, bezeugen auch einheimische, unverdächtige Quellen. „Es kamen“, so berichtet Badaoni, der als streng orthodoxer mohammedanischer Gelehrter am Hofe Akbars weilte und die Verhältnisse genau kannte, „aus Europa gelehrte Mönche, die ‘Padri’ genannt werden. … Sie brachten das Evangelium mit und legten dem Kaiser Beweise für die Dreipersönlichkeit Gottes vor. Seine Majestät glaubte fest an die Wahrheit der christlichen Religion, wünschte die Lehren Jesu zu verbreiten, befahl dem Prinzen Murad (gemeint ist der zweite Sohn Akbars, Pahari, dem der Vater später den Namen Murad gab), einige Lektionen in der christlichen Religion zu nehmen, da dies ihm Glück bringen werde, und trug Abul Fazil auf, das Evangelium zu übersetzen.”
Angamali:
Eine Episode aus der Geschichte der Thomaschristen
Personen
(Auswahl)
Lewis C. S.
Malagrida G.
Marescotti J.
Manning H. E.
Marillac L.
Maritain J.
Martin Konrad
Massaja G.
Meier H.
Mieth Dietmar
Mixa Walter
Mogrovejo T.A.
Moltke H. v.
Montalembert
Montecorvino J.
Moreno E.
Moreno G. G.
Mosebach M.
Müller Max
Muttathu-padathu
Nies F. X.
Nightingale F.
Pandosy C.
Paschalis II.
Pieper Josef
Pignatelli G.
Pius XI.
Postel M. M.
Poullart C. F.
Prat M. M.
Prümm Karl
Pruner J. E.
Quidort
Radecki S. v.
Ragueneau P.
Rahner K.
Ratzinger J.
Reinbold W.
Répin G.
Rippertschwand
Rudigier F. J.
Ruysbroek
Salvi Lorenzo
Sanjurjo D. S.
Saventhem E.
Schamoni W.
Schreiber St.
Schynse A.
Sierro C.
Silvestrelli C.
Simonis W.
Solanus
Solminihac A.
Spaemann C.
Spaemann R.
Stein Karl vom
Steiner Agnes
Sterckx E.
Stern Paul
Stolberg F. L.
Talbot Matt
Therese
Thun Leo G.
Tolkien J.R.R.
Tournon Ch.
Vénard Th.
Vermehren I.
Vianney J. M.
Walker K.
Wasmann E.
Waugh E.
Wimmer B.
Windthorst L.
Wittmann G. M.
Wurmbrand R.
Xaver Franz







