zur katholischen Geisteswelt
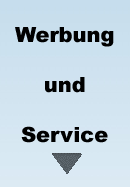
|
Zum
Inhalts- verzeichnis |
|
Zum
Rezensions- bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im biographischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
Datenschutzerklärung
|
Zum philosophischen Bereich
|
|
Zum
liturgischen Bereich |
Personen
(Auswahl)
Albert d. Große
Allouez C.
Amadeus v. L.
Auden W. H.
Bacon Francis
Bain James
Balmes J.
Barón R.
Barbarigo G. Baronius C.
Basset J.
Bataillon P. M.
Bélanger Dina
Bellarmin R.
Benninghaus A.
Benno v. M.
Bernanos G.
Billot Louis
Billuart C. R.
Bobola A.
Böhm D.
Borghero F.
Borja Franz v.
Boscardin B.
Brendan
Brisson L.
Calvin J.
Capestrano J.
Capitanio B.
Cassian v. N.
Castro A. de
Chambon M.M.
Chaumonot
Claret A.M.
Cornacchiola B.
Dawkins R.
Deku Henry
Delp Alfred
Döblin Alfred
Döring H.
Duns Scotus
Ebner F.
Eltz Sophie zu
Ferrero
Ferretti G.
Fesch Jacques
Flatten Heinrich
Focherini O.
Gallitzin A.v.
Geach P. T.
Gerlich M.
Green Julien
Haecker Th.
Hasenhüttl G.
H. d. Seefahrer
Hengelbrock W.
Hildebrand D. v.
Hochhuth Rolf
Höffner Joseph
Hönisch A.
Homolka W.
Hopkins G. M.
Husserl E.
Ignatius v. L.
Innozenz XI.
Jakob Max
Janssen A.
Jogues Isaak
Jones David
Jörgensen J.
Kaltenbrunner
Knox R. A.
Konrad I.
Kornmann R.
Kutschera U.
Lamy J. E.
Laurentius v. B.
Le Fort G. v.
Lehmann Karl
Leisner Karl
Pierre Joseph Marie Chaumonot S. J.
Von Anton Huonder S. J.
Die alte Jesuitenmission in Kanada oder Neufrankreich gehört unstreitig zu den ergreifendsten Episoden der neueren Missionsgeschichte. Ihre hervorragenden Apostel, wie Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, Paul Le Jeune, Anton Daniel, Gabriel Lallemant, Karl Garnier, Franz Joseph Bressani, sind jedem Kenner der Missionsgeschichte bekannt.
Neben ihnen finden sich aber viele andere, die den Genannten an apostolischem Opfermut nicht nachstanden, jedoch weniger in den Vordergrund traten.
Unter diesen verdient P. Peter Joseph Maria Chaumonot besondere Erwähnung. Sein Leben ist eine Kette seltsamer Fügungen und Schicksale und um so interessanter, als der Missionar selbst bereits als gebrochener Greis seine Lebensschicksale im Auftrag seiner Oberen niederschrieb.
Diese eine köstliche Frische und Naivität atmende Selbstbiographie und die Briefe Chaumonots bilden denn auch die Hauptquelle der folgenden Darstellung.
I. Vorleben
Das Vorleben unseres Helden ist so eigenartig und abenteuerlich, dass wir es etwas eingehender nach den Aufzeichnungen Chaumonots schildern müssen.
1. Der Vagabund
Peter Chaumonot wurde am 9. August 1611 in einem Dörfchen bei Châtillon-sur-Seine in Burgund geboren.
“Mein Vater war ein kleiner Weinbauer in Frankreich und meine Mutter die Tochter eines armen Schullehrers. Als ich sechs Jahre alt war, schickten mich die Eltern zu meinem Großvater, der fünf bis sechs Stunden von unserem Dorf wohnte, damit ich dort Lesen und Schreiben lernte. Dann holten sie mich wieder nach Hause, aber nur für kurze Zeit; denn ein Onkel von mir, der Pfarrer in Châtillon an der Seine war, hatte die Güte, mich in sein Haus aufzunehmen, damit im dortigen Kolleg studieren könne.
Nachdem ich nun ein bißchen Latein gelernt hatte, wünschte mein Onkel, dass ich bei einem Mitschüler aus derselben Klasse, einem guten Musiker, auch Unterricht im Choralgesang nähme. Dieser Bursche überredete mich, auch Châtillon zu entfliehen und ihm nach Beaume, einer anderen französischen Stadt, zu folgen, wo wir unsere Studien bei den Oratorianern fortsetzen könnten.
Nicht gewillt, diese Reise ohne Geld zu machen, stahl ich meinem Onkel, während er gerade in der Kirche weilte, 100 Sous. Mit diesem Zehrpfennig ausgerüstet, traten wir die Reise an. Sie führte auf Umwegen über Dijon nach Beaume. Hier nahmen wir bei einem Bauer Quartier. Da aber meine Finanzen knapp waren, schrieb ich heimlich an meine Mutter, sie möge mir etwas Geld und Kleider schicken, damit ich meine Studien in Beaume fortsetzen könne; hier hoffte ich größere Fortschritte zu machen als in Châtillon.
Der Brief fiel aber unglücklicherweise meinem Vater in die Hände. Der schlug meine Bitte rundweg ab und befahl mir, sogleich nach Hause zurückzukehren. Er wolle dann versuchen, zwischen mir und dem Onkel wieder Frieden zu stifen.
Die Antwort schlug mich nieder. Zu meinem Onkel zurückzukehren heiß ja, mich offen als Dieb zu bekennen. Das brachte ich nicht über mich. Anderseits konnte auch von einem längeren Aufenthalt in Beaume nicht mehr die Rede sein. Ich beschloß also, als Vagabund mich umherzutreiben, lieber als die Schande zu tragen, die meine Tat mir zugezogen.
Ohne einen Pfennig in der Tasche, brach in von Beaume auf in der Absicht, nach Rom zu pilgern. Den ersten halben Tag zog ich allein dahin; dann begegnete ich zwei Burschen aus Lothringen. Sie grüßten mich und fragten, wohin ich ginge. ‘Nach Rom’, lautete meine Antwort, ‘um den Ablaß zu gewinnen.’ Der Plan gefiel den beiden, und sie nannten mir das Ziel ihrer eigenen Reise. Es war Lyon.
Während wir nun zusammen die Straße zogen, war ich stets mit dem Gedanken beschäftigt, was wohl aus mir werden und wovon ich auf der weiten Reise leben möchte. Betteln schien mir zu erniedrigend, durch Handarbeit meinen Unterhalt zu verdienen, wollte mir auch nicht recht in den Sinn. Es bot auch wenig Aussicht, da ich an Arbeit nicht gewöhnt war und zudem nichts davon verstand. Was tun? Meine beiden Lothringer, die mit Geld nicht besser versehen waren, zeigten es mir.
In der ersten Stadt, die wir erreichten, begannen sie gleich von Tür zu Tür zu betteln. Ich war anfangs ganz verblüfft, sie dieses Handwerk treiben zu sehen. Aber nach kurzer Zeit entschloß ich mich, ein gleiches zu tun, da es immer noch besser war als verhungern. So hatte das Beispiel mir leicht gemacht, was mir vorher undenkbar erschienen. Da ich aber in dem Bettlergewerbe noch Anfänger war, fiel das Ergebnis recht kümmerlich aus.
Ich schmeichelte mir jedoch, bei der Ankunft in einer so großen Stadt wie Lyon würde sich mir irgend ein unverhofftes Glück auftun. Aber schon gleich am Tor der Stadt erlebte ich eine bittere Enttäuschung. Die Torwache ließ nämlich meine beiden Reisegesellen unbehindert durch, da sie einen Paß hatten; mich hielt sie an, weil ich natürlich keinen besaß.
So wußte ich gar nicht, was aus mir werden und wo in aller Welt ich ein Unterkommen finden sollte. Da sah ich vor mir so viele große Gebäude und durfte mir doch nicht den kleinsten Winklel darin als Nachtherberge erbitten. Endlich erspähte ich einer Glashütte gegenüber einen armseligen Bretterverschlag und kroch hinein.
O mein Gott, hätte ich doch damals wenigstens daran gedacht, meine Leiden und Entbehrungen als Buße für meine Sünden hinzunehmen und meine Armut und Verlassenheit mit derjenigen meines Heilandes im Stall von Bethlehem zu vereinigen! Aber solche Gedanken kamen mir damals nicht in den Sinn.
Am nächsten Morgen sah ich Leute in ein Boot steigen, das unten am Flusse lag, um auf das jenseitige Ufer der Rhône zu fahren. Ich bat den Fährmann, mich aus Barmherzigkeit mitzunehmen. Das tat er denn auch, hatte er doch keinen Schaden davon, da er von der Stadt selbst bezahlt und beauftragt war, alle Bettler, die keinen Einlaß in die Stadt erhielten, über den Fluss zu schaffen.
Als ich auf der anderen Seite der Rhône ans Land stieg, traf ich einen jungen Mann, der sich gleich bereit erklärte, die Reise nach Italien mitzumachen.
Kaum hatten wir den Weg angetreten, als uns ein Priester begegnete, der gerade von Rom zurückkehrte. Dieser bot alles auf, um uns von der geplanten Pilgerfahrt abzuraten, und riet uns, lieber nach Hause zurückzukehren. Unter anderem machte er geltend, dass wir, weil ohne Pässe, in keiner einzigen Stadt auf dem Wege Einlaß erhalten würden.
Ich fragte ihn, ob der denn selbst einen Paß besitze. Als er mir denselben zeigte, bat ich ihn gleich um Erlaubnis, ihn abschreiben zu dürfen, was ich auch auf der Stelle tat, nur dass ich an Stelle seines Namens den meinigen und den meines Gefährten setzte ...
Unter großen Entbehrungen und Leiden wurde nun die Reise ostwärts nach Savoyen fortgesetzt.
In Chambéry ging ich zum Kolleg der Jesuiten und bat an der Pforte auf lateinisch um ein Almosen. Ein Pater, der gerade vorbeiging, hatte mit meinem elenden Aussehen solches Mitleid, dass er mir gleich ein Abendessen vorsetzen ließ und mir sogar versprach, mich nach Lyon, wohin zu reisen er im Begriffe stand, mitzunehmen, damit ich von dort aus in meine Heimat zurückkehre.
Zuerst dankte ich ihm, so gut ich konnte, und versprach, sein Anerbieten anzunehmen. Kaum aber hatte er das Zimmer verlassen, ergriff ich die Flucht. Was mich schreckte, war die Erinnerung an das gestohlene Geld und die Scheu, mich als Dieb vor meinen Eltern wieder sehen zu lassen. Wie beklagenswert war doch die Verblendung meines stolzen Sinnes, dass ich es vorzog, lieber unzähligen Gefahren und Entbehrungen zu trotzen, als mich einer so wohlverdienten Züchtigung zu unterziehen!
In einem savoyischen Dorf trafen wir einen mitleidigen Pfarrer, der uns in sein Haus aufnahm und uns nach einem guten Abendessen erlaubte, im Bett seines Dieners zu schlafen, der gerade nach Chambéry gegangen war.
Der Pfarrer selbst schlief in einer über dem Zimmer seines Haushälters gelegenen Kammer, zu welcher man auf einer Leiter hinaufstieg und die durch eine Falltüre geschlossen wurde. Diese Falltüre vergaß unser Wirt beim Schlafengehen zu schließen. Gegen Mitternacht geriet eine dem Mäusefang obliegende Katze zufällig an die Falltür. Sie schlug zu, und das Geräusch weckte den Pfarrer. Er argwöhnte, wir hätten versucht, in böser Absicht zu ihm hinaufzusteigen, sprang aus dem Bett, lief halb angekleidet ans Fenster und schrie so laut er konnte: ‘Mörder, Mörder!’
Nicht weniger beunruhigt als der Hauswirt selbst, eilte ich die Leiter hinauf und gab mir Mühe, den Pfarrer über die unschuldige Ursache des Lärmes aufzuklären. Jedoch umsonst. Zu unserem Glück schliefen die Nachbarn so fest, dass sie die Hilferufe nichit gehört hatten. So kamen wir glücklich davon.
Teurer zu stehen kam uns ein anderes Abenteuer. In einem Städtchen des Veltlin fanden wir eine französische Besatzung, die auf eine sehr kleine Zahl Soldaten zusammengeschmolzen war, weshalb die Offiziere eifrig in uns dragen, bei ihnen in Dienst zu treten. Ich hätte mich schon wegen des großen Hungers, den ich litt, dazu bereit finden lassen, mein klügerer Kamerad wollte aber nichts davon hören. Das einzige, was sie uns abpreßten, war die Zusage, die Ankunft des Kommissars, der täglich erwartet wurde, abzuwarten. Dabei machten sie uns Hoffnung, dass wir den gleichen Sold wie wirkliche Soldaten erhalten würden.
Inzwischen wünschte der Offizier einmal zu sehen, welche Figur wir auf der Parade machten. Es fiel nicht schwer, meinen Kameraden in einen Uniform zu stecken, war er doch ein stämmiger Bursche. Bei mir aber, der ich noch ein Knabe und obendrein von schmächtigem Körperbau war, kostete es Mühe, ein Schwert zu finden, das mir paßte. Dasjenige, das man endlich gefunden zu haben glaubte, steckte in einer Scheide aus Aal- oder Schlangenhaut. In Ermangelung eines Gehänges oder einer Schärpe banden sie es mir mit einem Eselshalfter um die Lenden. Ich machte in dem Aufzug eine so klägliche Figur, dass man beschloß, mich bis zur Ankunft des Kommissars als krank ins Bett zu legen.
Während wir dessen Ankunft erwarteten, zehrten wir von des Königs Brot. Mein Gefährte aber lebte in beständiger Angst, als Überläufer betrachtet oder gegen unseren Willen zurückgehalten zu werden. Er malte die Gefahr so grell aus, dass ich seinem Drängen nachgab und mit ihm die Flucht ergriff.
Eines schönen Morgens rissen wir in aller Frühe aus, entschlossen, unsere Pilgerfahrt nach Rom fortzusetzen. Wir hatten aber erst anderhalb Stunden Weges hinter uns, als wir von einigen Soldaten, die auf Deserteure aufzupassen hatten, angehalten wurden. ‘Was’, rief ich mit Tränen in den Augen, ‘sehe ich denn aus wie ein Soldat? Ich bin bloß ein armer Student, der eine Pilgerfahrt nach Rom gelobt hat.’
Mein Reden und Tun war so kläglich, dass die Soldaten genug erweicht wurden und uns unbehelligt ziehen ließen.
Gott weiß, was aus uns geworden wäre, hätte er den Wachleuten nicht dieses Mitleid eingeflößt. Aber der Allgütige rettete uns noch aus einer anderen Gefahr.
Kurz nach Betreten des italienischen Bodens sahen wir gegen Abend ein Gasthaus an der Straße, wo wir zu übernachten gedachten. Aber wir hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Kaum war unser spärliches Abendessen, das wir teuer bezahlen mußten, verzehrt, als uns der Gastherr trotz unserer flehentlichen Bitte, uns wenigstens in einem der Ställe schlafen zu lassen, unbarmherzig von dannen jagte.
Das wäre noch nicht so schlimm gewesen, hätten wir nur beim Sternenschein ein Schlafplätzchen suchen können. Aber kein Stern ließ sich sehen, und der Himmel hing voll schwerer Wolken, die bald darauf einen wahren Sintflutregen auf uns herabgossen. Unsere Kleider waren im Nu durchnäßt und, was noch schlimmer, der Weg so voller Löcher und Gräben, dass wir in der Dunkelheit fast ebenso viele Purzelbäume als Schritte machten.
Wir standen am Ende unserer Kraft, als ein Lichtschimmer uns endlich einen Stall ausfindig machen ließ. Wir krochen darauf zu und fanden ganz nahebei einen großen Strohschober. Wir klommen hinauf und machten uns oben im Stroh eine Höhlung, um hineinzuschlupfen.
Durch und durch kalt, besonders an den Füßen, steckten wir uns diese gegenseitig unter die Achseln und lagen so, dass mein Kopf dem meines Genossen gerade gegenüberlag.
Eben begannen wir etwas warm zu werden, da kamen mehrere große Hunde, die uns gewittert, unter fürchterlichem Kläffen auf uns zugerannt. Auf den Lärm hin eilten die Leute des nahen Wohnhauses herbei und suchten uns mit Steinwürfen zu vertreiben.
Der Steinhagel drohte unseren Posten unhaltbar zu machen, doch wagten wir aus Furcht vor den Hunden nicht, uns zu rühren. Jetzt hielt ich es an der Zeit, das Schweigen zu brechen. Mein Talent, durch Tränen zu rühren, hatte sich, wie erzählt, schon mehrfach bewährt. Ich begann also auf lateinisch in kläglichem Ton zu rufen: ‘Nos sumus pauperes peregrini’ (Wir sind arme Pilger).
Da das letzte Wort auch italienisch ist, so verstanden die Leute, was ich sagte. Sie bekamen Mitleid, riefen die Hunde zurück und ließen uns den Rest der Nacht im Frieden schlafen.
Nach vielen Leiden und Beschwerden erreichten wir endlich Ancona. Aber wer vermag zu beschreiben, in welch armseligen Zustand mich mein Vagabundenleben gebracht hatte! Alles an mir, vom Scheitel bis zu den Zehen, flößte Abscheu ein. Ich war barfuß, da ich die zerrissenen Schuhe, die mir nur die Füße wund rieben, längst weggeworfen hatte. Mein Hemd war mir am Leibe verfault, meine zu Lumpen gewordenen Kleider voll Ungeziefer, mein ungekämmter Kopf mit einem häßlichen Ausschlag bedeckt, der einen ekelhaften Geruch verbreitete.
Wie weit das Übel fortgeschritten war, kam mir erst hier in Ancona zum Bewusstsein, als mir beim Reiben des Kopfes ein Wurm in der Hand hängen blieb. Bei diesem Anblick war ich ganz gebrochen.
‘So muß ich denn’, sage ich bei mir selbst, ‘zur Strafe für mein Vergehen lebendig von Würmern und Ungeziefer zerfressen werden.’
Nun wunderte es mich nicht länger, dass, so oft ich grüßend meinen Hut abnahm, die Leute erstaunt und entsetzt mich anschauten. Was wird aus mir werden? Bin ich nicht eine krankhafte Erscheinung vor aller Welt? O schreckliche Strafe meines Hochmutes!
Sobald wir uns aber dem heiligen Hause von Loreto näherten, faßte ich wieder Vertrauen. Vielleicht, so dachte ich, wird die allerseligste Jungfrau, die von dieser Stätte aus so viele Wunder zum Troste der Unglücklichen wirkt, auch mit meinem Elend Mitleid haben ...
Ich betete also zu ihr, freilich kalt genug. Dennoch erwies sie sich trotz meine Unwürdigkeit als erbarmungsreiche Mutter. Wie es aber die besondere Pflicht der Mutter ist, nach der Reinlichkeit der Kinder zu sehen, so sah sie offenbar auch mich in diesem Lichte an.
O seligste Jungfrau, wie unwert war ich und bin ich heute noch, als dein Kind angesehen zu werden! Aber du warst es, die jenem jungen Manne, den ich nie wieder ausfindig machen konnte, den Willen und die Macht gegeben hat, meinen Kopf zu heilen. Du weißt besser als ich, wie es eigentlich zuging. Aber zum Zeichen meiner Dankbarkeit will ich nicht versäumen, hier niederzuschreiben, was ich weiß.
Als ich aus dem heiligen Hause wieder heraustrat, stand ein Unbekannter da - es schien ein junger Mann zu sein, oder war es vielleicht sogar ein Engel? - sah mich mitleidig an und sagte teilnehmend: ‘Mein lieber Knabe, was hast du da für einen schlimmen Kopf? Komm, ich will sehen, ob ich dir nicht helfen kann.’ Ich folgte ihm. Er nahm mich hinter einen dicken Pfeiler, wo niemand vorüberging. Hier ließ er mich niedersitzen und meinen Hut abnehmen. Ich tat so. Darauf schnitt er mir mit einer Schere all meine Haare ab, rieb meinen kranken Kopf mit einem weißen Tuch ab und entfernte so, ohne dass ich irgend welchen Schmerz empfand, jede Spur der Krankheit und ihrer widerwärtigen Begleitschaft. Sodann setzte er mir den Hut wieder auf. Ich dankte, und der junge Mann verschwand. Bis zur Stunde müßte ich erst den Arzt finden, der ein so schlimmes Übel in so kurzer Frist zu heilen wüßte ...
Nach dreitägigem Aufenthalt in Loreto nahmen mein Gefährte und ich den Weg nach Rom wieder auf. Aber der Herr fügte es, dass ich zu Terni in Umbrien fesgehalten wurde und mein Vagabundenleben ein Ende fand.
Wie gewöhnlich ging ich dort bettelnd von Tür zu Tür. Da traf ich auf der Straße einen ehrwürdigen alten Herrn, einen Doktor der Rechte. Er begann ein Gespräch mit mir und trug mir schließlich an, bei ihm in Dienst zu treten. Ich war meines Bettlerlebens so herzlich überdrüssig, dass ich sofort auf das Anerbieten einging und des Doktors Lakai wurde.
Ich machte die niedrigsten Ansprüche, denn es gab nichts, was mir nicht angenehm und ehrenvoll vorkam im Vergleich zu den Entbehrungen und Erniedrigungen, die mir mein Landstreicherleben zu Ekel gemacht.
So blieb ich einige Zeit in Terni. Da ich noch nicht gut genug Italienisch sprach, um in dieser Sprache zu beichten, tat ich es bei einem Pater der Gesellschaft Jesu auf lateinisch.
Nach der Beichte befragte er mich über meine Studien. Ich sagte, ich sei in der Rhetorik gewesen, als ich mich hätte verleiten lassen, durchzubrennen.
Er äußerte sein Bedauern darüber, dass ich nach einem so guten und vielversprechenden Anfang nicht standgehalten und jetzt zu einer so niedrigen Stellung herabgesunken sei, und drängte mich, meine Studien wieder aufzunehmen. Wenn ich wollte, würde er sorgen, dass ich ins Kolleg aufgenommen würde und so Gelegenheit fände, in Tugend und Wissenschaft fortzuschreiten.
Ich argwöhnte jedoch, er wolle einen Jesuiten aus mir machen, und lehnte ab.
In Wirklichkeit hatte der Ordensmann, wie ich später herausfand, nur die Absicht, mir die Stelle eines jungen weltlichen Lehrers zu verschaffen, der die untersten Klassen des Kollegs leitete. Wollte Gott, ich hätte damals gleich angenommen; wie viele Sünden und Torheiten hätte ich mir erspart!
Ich grübelte nach und wollte nach zwei Tagen den Pater aufsuchen, um ihn an seinen Vorschlag zu erinnern.
Da ich aber seinen Namen nicht kannte, war ich so dumm und fragte nach ‘dem Pater, der meine Beicht gehört’. Die Studenten im Hof, an die ich diese Frage stellte, lachten hell auf, und dies reichte hin, mich schneller wieder fortzubringen, als ich gekommen.
Ich fragte nun den Doktor, bei dem ich diente, was für Leute diese Jesuiten eigentlich seien. Er erwiderte gleichgültig, sie nähmen nur Leute von Rang und besonderen Talenten auf. Der Orden sei auch weniger streng als andere, und man könne ihn wieder verlassen, auch wenn man die Gelübde schon abgelegt habe ...
Die beiden letzten Dinge gefielen mir nicht übel. So für einige Zeit hätte ich es ganz gern bei den Jesuiten versucht. O wie wenig paßte ich damals noch für das Reich Gottes, da ich zurückschaute, noch ehe ich die Hand an den Pflug gelegt!
Als ich allmählich das Italienische besser verstand, begann ich auch Erbauungsbücher in dieser Sprache zu lesen, unter anderem ‘Das Leben der Väter in der Wüste’. Das weckte in mir den Wunsch, ein Einsiedler zu werden. Ohne jemand zu Rate zu ziehen, verließ ich heimlich das Haus meines Herrn in der Absicht, mich in Frankreich irgendwo in eine Wildnis zu begraben. Zuvor jedoch wollte ich Rom besuchen. Beim Austritt aus der Stadt begegnete mir des Doktors Tochter. Ich teilte ihr mein Vorhaben mit, damit man sich über mein plötzliches Verschwinden nicht ängstigte.
Als ich einige Stunden marschiert war, kam mir der Gedanke, es einmal zu versuchen, ob ich wohl von wilden Kräutern leben könnte, wie ich es von den Vätern der Wüste gelesen. Ich pflückte also einige noch grüne Weizenähren, steckte sie in den Mund und kaute daran, ohne sie aber herunterzubringen. Ich sah, davon konnte ich nicht satt werden. So mußte ich denn auf mein altes Bettlerhandwerk zurückgreifen. Aber auch das schützte mich nicht vor Hunger, auch nicht in Rom; denn ich wußte nichts von den Ordenshäusern, wo an gewissen Tagen Almosen an die Armen verteilt werden. Das Noviziatshaus St. Andreas der Jesuiten war das einzige, das ich kennen lernte.
Meine Berufung zum Einsiedlerleben war durch die gemachten Erfahrungen einigermaßen erschüttert worden. Doch wollte ich in jedem Falle nach Frankreich zurückkehren und brach in dieser Absicht von Rom auf. Dieselbe Straße wandernd, die ich gekommen, erreichte ich bald wieder mein altes Terni.
Da ich aber ich den Mut hatte, bei meinem ehemaligen Herrn vorzusprechen, kehrte ich bei einem Seifensieder ein, den ich kannte, und brachte die Nacht bei ihm zu. Derselbe benachrichtigte am nächsten Morgen den Doktor von meiner Ankunft, und dieser war so gut, mir wieder die alte Stelle anzubieten. Ich griff sofort zu und entsagte damit endgültig dem Bettlerberuf, gegen den ich einen größeren Abscheu gefaßt hatte als je zuvor.
Mein lieber Herr hatte einen guten Freund, Signore Capitano. Dieser sprach kurze Zeit nach meiner Ankunft in Terni dem Doktor gegenüber den Wunsch aus, mich in seinem Haus zu haben, damit ich seine beiden Söhne beaufsichtigte. Beide studierten bei den Jesuiten. Mein Herr war einverstanden, und so kam ich Signore Capitano, wo ich mit offenen Armen empfangen wurde.
Gleich am folgenden Tag stellte er mich den Jesuitenvätern vor, und diese steckten mich ohne weiteres in die Rhetorik. Als ich eine Zeitlang unter ihrer Leitung studiert hatte, fühlte ich in mir das Verlangen, auch das Tugendbeispiel dieser würdigen Diener Gottes nachzuahmen, das mich mit Bewunderung erfüllte.
Aber eines hinderte damals meine offene Aussprache gegen meinen Beichtvater. Ich konnte es nicht über mich bringen, meine Armut und niedere Herkunft einzugestehen; denn bisher hatte ich stets damit geprahlt, dass mein Vater ein procureuer du roi (königlicher Verwalter) sei, und ich schämte mich, das zu widerrufen. Dieser Kampf zwischen Natur und Gnade dauerte mehrere Monate. Diese drängte mich, alles zu offenbaren, jene versperrte mir den Mund. Gott selbst, der mir die Gnade der Berufung in die Gesellschaft Jesu zugedacht, bereitete mir in seiner Güte die Wege vor. Ein junger Geistlicher hielt damals, von den Patres besoldet, die unteren Klassen ab. Derselbe war aber bald seines Amtes müde und bat um seine Entlassung. Nun fiel das Auge der Patres auf mich, und sie versprachen mir das gleiche Gehalt. Da Signore Capitano zustimmte, rückte ich zum Reggente oder Klassenlehrer auf.
Gott der Herr gab mir die Gnade, mit dem verdienten Geld sparsam umzugehen, und als ich ein ordentliches Sümmchen zusammen hatte, verteilte ich dasselbe zwischen den Kirchen und den Armen. Ja, ich verstieg mich sogar dazu, im kleinen den Sankt Nikolaus zu spielen, und warf eines Nachts Geld in ein Haus, wo eine junge Person sich in Not befand. Gott der Herr lohnte mir diese Freigebigkeit reichlich, indem er mir nun wirklich die unverdiente Gnade zum Ordensberuf schenkte.
2. Chaumonot wird Jesuit
Eines Tages - es war gerade das Fest des seligen Franz Borgia [Franz Borgia wurde 1671 heiliggesprochen] - wurde ich durch die Predigt eines Jesuiten innerlich so getroffen, daß ich in der Absicht, das Beispiel des großen Heiligen in etwa nachzuahmen, das Gelübde machte, die Welt zu verlassen und in einen Orden einzutreten, und zwar bei den Jesuiten, falls sie mich aufnähmen, andernfalls bei den Kapuzinern oder Rekollekten."
Der Wunsch, Jesuit zu werden, erfüllte sich. Als nämlich der Provinzial nach Terni kam, stellten die Patres dem jungen Chaumonot ein so günstiges Zeugnis aus, daß er ohne Anstand aufgenommen und mit den besten Empfehlungen versehen ins Noviziatshaus St. Andreas nach Rom gesandt wurde. Er war 21 Jahre alt, als er dort am 18. Mai 1632 eintrat.
Inzwischen hatte ein Adeliger ein Noviziat in Florenz gegründet, und Chaumonot siedelte mir einigen anderen Novizen dahin über. Bis dahin hatte der Novize das Geheimnis seiner Herkunft immer noch nicht verraten. Die Strenge des römischen Novizenmeisters schreckte ihn von der Eröffnung ab; erst die Güte des neuen Novizenmeisters in Florenz gab ihm den Mut dazu.
"Eine der ersten Bitten", so erzählt Chaumonot, "die ich an meinen neuen Novizenmeister stellte, war, er solle mich, um meinen Stolz zu strafen, öffentlich über die Verhältnisse meiner Eltern, über meine Reise nach Italien und meine Erlebnisse als fahrender Schüler befragen. Auf diese Weise hoffte ich in etwa meine Fehler wieder gutzumachen, vorab die Unwahrheit, deren ich mich bedient hatte, um die Armut meiner Eltern zu verdecken. Er versprach es und hielt Wort.
Als eines Tages alle Novizen versammelt waren, fragte er mich über alle diese Punkte aus. Und Gott gab mir die Kraft, die Demütigung, die er mir so nahe legte, tapfer anzunehmen. Offen gestand ich, wer ich war, weshalb ich Frankreich verlassen, und erzählte alle meine Erlebnisse in Italien.
Der fromme Mann aber benutzte meine gute Stimmung und fügte noch einen neuen Akt der Selbstbeschämung hinzu, auf den ich nicht gefaßt war. Er gab mir auf, nun auch eines der Vagantenlieder zu singen, wie sie bei solchen Landstreichern üblich sind, und hieß mich gleich auf einen Baumstamm als improvisierte Bühne hinaufsteigen.
Ich gehorchte und tat mein Bestes. Aber das Konzert dauerte nicht lange. Mein Gedächtnis konnte nur noch ein Tanzlied aufbringen. Ich begann es zu singen. Aber schon bei der ersten Strophe gab mir der Pater ein Zeichen, indem er rief: ‘Pfui, welch ein garstiges Lied! Wenn Sie kein besseres wissen, dann lassen Sie das Singen ein für allemal sein.’ Damit war die Prüfung zu Ende.
Die freiwillige Verdemütigung trug reiche Frucht. Seit jener Zeit bis zum Jahre 1688, da ich dies schreibe, d.h. seit etwa 55 Jahren, habe ich in meinem Gebet nie wieder Trockenheit, Kälte oder Widerwillen verspürt. Die göttliche Güte verfuhr mit mir so, wie es eine kluge Mutter macht, die den kleinsten und schwächsten ihrer Kinder größere Sorge und Rücksicht zuwendet als den größeren und stärkeren.”
Doch blieben die Prüfungen nicht aus. Einige Monate später holte sich Chaumonot oder Calvanotti, wie sein Name in italienischer Umformung lautete, bei einem Bettelgang durch die Straßen von Florenz (wie sie die Novizen der Gesellschaft Jesu zur Übung machen) eine starke Erkältung und Lungenentzündung.
In seine Fieberträumen sah er Löwen, Tiger und andere Raubtiere aus sich losstürzen. Aber der Blick auf das Tabernakellicht, das der Kranke von seinem Bette aus sehen konnte, tröstete ihn und half ihm in seinen Ängsten. Mit einer in dickes Öl getauchten Feder holte ihm der Rektor den giftigen Schleim aus der Kehle heraus, worauf sofort Besserung eintrat.
Schlimmer war das heftige Kopfweh, das Chaumonot gegen Ende des Noviziats befiel. Das Übel wurde so arg, dass man an seine Entlassung dachte. In seiner Not wandte sich der arme Novize an den hl. Joseph, das Haupt der heiligen Familie, und bat ihn, er möge doch die Konsultoren, von deren Entscheid sein Verbleiben in der ihm so teuer gewordenen Ordensfamilie abhing, günstig stimmen.
Da die Konsultoren sich nicht einigen konnten, wurde der Hausarzt gerufen. Dieser fragte den Kranken in Gegenwart der Patres, wie es mit seiner Betrachtung stehe und ob er sie trotz seines Kopfwehes machen könne.
Der Wahrheit gemäß erwiderte Chaumonot, beim Beginn hindere ihn zwar sein Kopfweh, sobald er sich aber in die frommen Gedanken eingearbeitet, danke er nicht mehr an seinen Schmerzen.
“Nun, meine Patres”, so enschied der gute Doktor, “ich meine, wer als Novize imstande ist, eine gute Betrachtung zu machen, der wird wohl auch später als Lehrer Unterricht halten können.”
Bald darauf brachte der Rektor dem angstvoll harrenden Novizen die frohe Kunde, dass seiner Aufnahme in den Orden nichts mehr entgegenstehe.
Nachdem Chaumonot im Mai 1634 seine ersten Ordensgelübde abgelegt hatte, wurde er nach Rom und von hier aus als Magister in das Kolleg von Fermo [ca. 180 km nordöstlich von Rom] geschickt.
Dankerfüllt machte er von hier aus eine Wallfahrt nach dem nahen Loreto. Dort fand er einen französischen Jesuiten, den Beichtvater der aus Frankreich kommenden Pilger, und erhielt vonihm französische Bücher, um seine Muttersprache, die er fast vergessen hatte, wieder aufzufrischen.
Bedeutungsvoller noch war für Chaumonot das Zusammentreffen mit einem anderen Landsmann, dem P. Joseph Anton Poncet de la Rivière, mit dem Chaumonot im Römischen Kollegt die höheren Studien machte. Poncet hatte bereits seine Bestimmung für die kanadische Mission erhalten und gab seinem Freunde die ergreifenden Berichte von der Hand eines P. Jean de Brébeuf zu lesen. Das heroische Opferleben, das sie schilderten, machte auf Chaumonot den tiefsten Eindruck. Das war es, was ihm als Ideal vorgeschwebt hatte. Bereits im Noviziat hatte er sich dem P. General Mutius Vitelleschi für die Heidenmission angeboten. Jetzt erwachte dieses Verlangen mit doppelter Gewalt. Obschon noch in den Studien und ohne Priesterweihe, wagte er es, seine Bitte durch Vermittlung des französischen Assistenten, P. Charlet, dem Ordensgeneral vorzulegen.
Er solle das Anliegen erst acht Tage lang Gott im Gebet empfehlen, lautete der Bescheid. Nun gab sich Chaumonot, unterstützt von Poncet, daran, den Himmel zu bestürmen.
Am achten Tag, am Matthiasfest 1637, stellte sich Chaumonot an der Türe der Kapelle auf, in welcher der Ordensgeneral Vitelleschi die heilige Messe zu lesen pflegte. Als dieser beim Heraustreten Chaumonot erblickte, sagte er gleich: “Lieber Frater, Sie haben das Spiel gewonnen.” Darauf legte er dem jungen Apostel die Hände aufs Haupt und spracht mit väterlicher Güte: “Mein liebes Kind, Sie gehen nach Kanada.” Chaumonot jubelte. Sein Herzenswunsch war erfüllt.Es war wohl um diese Zeit, als er eines Tages bei der Vorbereitung auf die heilige Kommunion sich an Maria, die Mutter Jesu, wandte und sie bat, ihm etwas einzugeben, womit er ihrem göttlichen Sohne, den zu empfangen er im Begriffe stehe, eine besondere Freude machen könne. Sofort glaubte er im Innern deutlich die Antwort zu hören: “Mache das Gelübde, in allen Dingen stets Gottes größere Ehre zu suchen.” Chaumonot erklärte sich bereit, vorausgesetzt, dass seine himmlische Mutter ihm zur treuen Ausführung behilflich sein wolle.
Als er dem Ordensgeneral sein Vorhaben mitteilte und um die nötige Erlaubnis bat, fragte Vitelleschi: “Sind Sie skrupulös?” - “Nein.” - “Gut, dann dürfen Sie das Gelübde machen; warten Sie aber eine Gelegenheit ab, bis Sie an einer besonders heiligen Stätte weilen.”
Die Gelegenheit bot sich bald. Poncet hatte nämlich die Erlaubnis erhalten, vor seiner Abreise von Rom noch einmal eine Wallfahrt nach Loreto zu machen und Chaumonot als Begleiter mitzunehmen.
Am ersten Tage der Pilgerreise bereits stellten sich bei diesem heftige Knieschmerzen ein. Aus Angst, die erhaltene Missionsbestimmung möchte zurückgenommen werden, wagte Chaumonot nicht, nach Rom umzukehren, sondern schleppte sich, auf seinen Stock gestützt, mühsam weiter, bis er am Grabe der unlängst im Ruf der Heiligkeit gestorbenen Francisca da Serone, deren Überreste im Barnabitenkloster von S. Severino ruhten, plötzlich Heilung fand.
Im heiligen Hause von Loreto machte dann der junge Apostel sein Gelübde und fügte demselben das Gelöbnis hinzu, zu Ehren der heiligen Familie in Kanada einHeiligtum von Loreto zu errichten. Den ersten Baustein dafür schenkte eine vornehme römische Dame, ein Beichtkind von P. Poncet, in der Gestalt von 25 Skudi.
Als Chaumonot erfuhr, dass Kanada sich den hl. Joseph zum Landespatron erwählt habe, erbat und erhielt er die Erlaubnis, sich zu Ehren der heiligen Familie künftig Joseph Maria nennen zu dürfen [1].
Der junge Apostel benützte dann den Aufenthalt in Rom, um sich in gekürzter Form die notwendigen theologischen Kenntnisse als Vorbereitung für die heilige Priesterweihe zu erwerben. Seine erste heilige Messe las er in einer kleinen, dem hl. Joseph geweihten Kapelle.
Bald darauf reiste er in Begleitung des P. Poncet nach Frankreich, um von dort aus sich nach dem Ziel seiner Wünsche einzuschiffen.
II. Das Missionsleben in Kanada.
Ehe wir P. Chaumonot auf sein neues Arbeitsfeld begleiten, dürfte ein kurzes Wort über die kanadische Mission von damals nicht überflüssig sein.
1. Die Mission in Kanada.
Die Evangelisierung Neu-Frankreichs, wie Kanada damals genannt wurde, war 1615 durch französische Rekollekten eröffnet und seit 1626 durch französischen Jesuiten weitergeführt worden. Aber die unsichere Lage der nur schwach bevölkerten Kolonie [2], die seit 1629 vorübergehend sogar in die Gewalt der Engländer fiel, ließ das Missionswerk anfangs nicht recht gedeihen. Erst als 1632 Kanada wieder französisch und der tapfere Samuel Champlain Statthalter wurde, konnte auch die Mission erfolgreich einsetzen. Sie wandte sich zunächst den mit den Franzosen verbündeten Huronen (Wandats, Wyandots) zu, die in drei Hauptstämme: Huronen, Petuns, Neutrale, gegliedert, in dem Gebiete wohnten, das von dem Ontario-, Erie- und Huronensee umschlossen wird. Das ganze Volk mochte ungefähr 80000 Seelen zählen, von denen etwa 20000 bis 30000 auf die eigentlichen Huronen, 20000 auf die Petuns oder Tabakindianer und 35000 auf die Neutralen entfielen. Letztere wurden so genannt, weil sie in dem furchtbaren Vernichtungskampfe zwischen Huronen und Irokesen sich neutral zu halten suchten. [Weitere Infos über die Entwicklung der Mission in Kanada enthält der Beitrag über Allouez.]
Die eigenartige Lebensweise dieser Völker, die, obschon keine Nomaden, doch einen großen Teil des Jahres auf Fischfang und Jagd oder auf dem Kriegspfad zubrachten, also fern von ihren Dörfern weilten, zwang zu einer entsprechenden Missionsweise. Der Weg ständiger Residenzen mit geregelter Gemeindeordnung war vorläufig ausgeschlossen; man mußte sich, wie der Missionsobere P. Hieronymus Lallemant 1640 ausführte, zu dem ungleich beschwerlicheren Weg der Wandermission entschließen.
Zwei- bis viermal im Jahr versammelten sich alle Missionare um ihren Oberen in Sainte Marie (an der Mündung des heutige Rye River in die Gloucester Bay, Huronensee), der einzigen etwas besser eingerichteten Station, um sich hier durch gemeinsame Beratung und Besprechung wieder zu stärken und zu ermutigen. Dann zogen die Missionare paarweise aus, um ihre Rundfahrten durch die weit entlegenen Dörfer und Weiler zu machen. Das geschah gewöhnlich um Allerheiligen, also im Winter, wo das Wandern doppelt mühsam, wo aber die von Jagd und Fischfang heimgekehrten Wilden am sichersten in ihren Dörfern anzutreffen waren. Hier mußte das Evangelium von Hütte zu Hütte getragen werden. Um keine zu übergehen, hatten die Patres im Sommer 1640 eine vorläufige Zählung aller Dörfer, Weiler, Hütten und Herdfeuer und nach Möglichkeit ihrer Bewohner vorgenommen und im Gebiet der fünf Huronenclans im ganzen 32 Dörfer mit zusammen 700 Hütten, etwa 2000 Herdfeuer und gegen 12000 Seelen vorgefunden. Genauere Zählungen späterer Zeit hoben die Gesamtziffer auf 30000 bis 35000 Seelen (vgl. die Relations des Jésuites aus den Jahren 1653 und 1656).
Die weiten Märsche durch die tief im Schnee liegenden Wälder, mit dem Gepäck auf dem Rücken, auf Pfaden, die immer wieder spurlos im Schnee verschwanden, stellten an Gesundheit und Ausdauer die größten Anforderungen. Im übrigen waren die Missionare ganz auf die Gastfreundschaft der Wilden angewiesen. Ein anderes Unterkommen gab es nicht.
Die Huronen wohnten nicht in schlechten Wigwams oder Zelten wie die Nomadenindianer, sondern in festen Hütten. Dieselben hatten Ähnlichkeit mit den Laubgängen unserer Gärten. Ihre Wände bestanden aus deiner Doppelreihe junger starker Bäume, deren obere Enden zusammengebogen und mit Stricken aus Lindenbast verbunden waren. Wie Dachschindeln übereinandergelegte Stücke Eichen- oder Fichtenrinde bildeten das Dach und bekleideten die Wände. Ein solcher Bau hatte gewöhnlich eine Länge von 10 bis 12 m; es gab aber auch Huronenhütten von 80 m Länge. Eine solche Gemeinschaftshütte beherbergte oft 20 Familien; je zwei Familien lagerten sich im Winter um einen Herd, so dass zehn in einer Reihe lodernde und qualmende Feuer die Wohnung mit Rauch erfüllten, der nur teilweise durch eine Dachluke abziehen konnte und das Innere mit einer dicken Rußschicht überzog. Die Dachluke und eine schmale Tür zu beiden Seiten waren die einzigen Öffnungen, durch welche Licht und Luft Zutritt hatten. Man mußte diese rauchgeschwängerte Atmosphäre von Jugend auf gewohnt sein, um sie erträglich zu finden, und auch so erzeugte sie oftmals schlimme Augenübel, ja selbst Erblindung.
In der Sommerzeit lagerten sich die Huronen auf Pritschen, die längs der Wände liefen und, aus Pflöcken und Flechtwerk hergestellt, mit Matten und Tierfellen bedeckt waren. Unter den Lagerstätten bewahrten sie ihren Vorrat an Brennholz auf. Darüber hingen an Stangen ihre Waffen, ihre Wampungürtel, Maiskolben, getrocknete Fische, gedörrtes Büffelfleisch usw.
In diesen Wohnungen voll beißenden Rauches und quälenden Ungeziefers, mitten unter den Gruppen kochender, schwatzender Squaws, rauchender Krieger, spielender Kinder, heulender Hunde mußten die Missionare Platz nehmen und den vom flackernden Herdfeuer phantastisch beleuchteten Gruppen das Evangelium Christi predigen.
Die Aufnahme in diesen Hütten war anfänglich zumeist nichts weniger als gastlich. Stolze Sprödigkeit und argwöhnische Kälte von seiten der alten, rohe Spottlust von seiten der jüngeren Krieger empfingen nur zu oft den Fremdling, und die zügellose Ausgelassenheit bei den Gelagen und mehr noch der fast gänzliche Mangel an Schamhaftigkeit machte den Aufenthalt in diesen Gemeinschaftshütten für die Glaubensboten oft auch zu einer seelischen Qual sondergleichen. Dazu kamen die entsetzlichen Szenen unmenschlicher Grausamkeit und fast teuflischer Rachsucht gegen feindliche Kriegsgefangene, deren Zeugen die Missionare sein mußten. Kurz, es war ein hartes, mühseliges Leben, für welches Chaumonot sich gemeldet hatte und dem er nummehr entgegenging.
2. Ankunft Chaumonots in Kanada und erste Eindrücke
Am 4. Mai 1639 lichtete die französische Flotte, die wieder frische Mannschaft und Kolonisten nach Neu-Frankreich bringen sollte, von Dieppe in der Normandie aus die Anker. An Bord befanden sich die Jesuitenmissionare Bartholomäus Vimont, J.A. Poncet, J. Chaumonot, J. Bargon, Karl Lallemant und ein Laienbruder, daneben eine Schar französischer Ursulinen [unter ihnen die sel. Marie de l’Incarnation] und Hospitaliterinnen, die Erstlinge jener heldenhaften Schar gottgeweihter Jungfrauen, die Frankreich seit der Zeit in die Missionen geschickt hat.Kaum auf offener See, zwang ein furchtbarer Sturm die Schiffe zur schleunigen Rückkehr in den sicheren Hafen. Ein zweites Mal auslaufend, sah sich die Flotte schon bald von spanischen Kriegsschiffen - es war Krieg zwischen Spanien und Frankreich - bedroht und mußte ihr Heil in schneller Flucht suchen. Das übrige erzählt uns Chaumonot in einem Brief aus Quebec vom 7. August 1639 an den Ordensgeneral Vitelleschi: “Am 1. August bin ich mit den Patres Vimont und Poncet und einem unserer Laienbrüder in Neu-Frankreich eingetroffen nach einer recht schwierigen Seefahrt von drei Monaten. Infolge des Nebels, der uns drei Wochen lang einhüllte, waren wir in großer Gefahr, an einem der auf diesem Meer treibenden Eisberg zu scheitern. Das Admiralschiff der Flotte (auf dem sich die Schwestern und P. Vimont befanden. Anmerkung Huonder) war drauf und dran, an einem dieser Eisblöcke zu zerschellen. Es war am Dreifaltigkeitsfeste [19. Juni], gerade während der Messe, als ein auf Deck auf und ab gehender Matrose trotz des dichten Nebels bloß zwei Fadenlängen vor sich das Schimmern des Eises gewahrte und laut aufschrie: ‘Barmherziger Gott, wir sind verloren!’ P. Vimont machte das Gelübde, zwei heilige Messen zu lesen, eine zu Ehren der allerseligsten Jungfrau, die andere zu Ehren des hl. Joseph, falls sie uns aus der Gefahr befreiten. Und siehe da, fast im selben Augenblick drehte sich der Wind und ließ uns wie durch ein Wunder dem Verderben entgehen. Auch die erfahrensten Seeleute gestanden, dass eine so rasche Drehung des Windes sich natürlicherweise nicht erklären lasse, und dass, wäre sie nicht im gegebenen Augenblicke eingetreten, wir unfehlbar verloren gewesen wären.” [vergleiche dazu den Bericht, den die selige Maria von der Menschwerdung vom selben Ereignis in ihrer Selbstbiographie gibt: Zeugnis bin ich dir, Stein am Rhein 21981, S. 215 f.]
Den Lorenzostrom aufwärts fahrend, erreichte man Quebec, den Hauptort der jungen Kolonie. Bei dem großen Mangel an Arbeitern war aber zum Ausruhen keine Zeit, und so sehen wir Chaumonot schon acht Tage nach der Ankunft auf der Fahrt ins Land der Huronen, 300 Stunden weiter landeinwärts.
“Am Vorabend des Festes vom hl. Lorenz [9. August] schiffte ich mich auf einem Kanoe (Birkenkahn) der wilden Huronen auf dem großen Strom ein, der den Namen des glorreichen Märtyrers Laurentius trägt und an einigen Stellen 10, 13 bis 20 Stunden breit ist. Auf eine Strecke von 100 Stunden bleiben seine Wasser salzig und machen Flut und Ebbe sich geltend. Darum ist er auch bei seiner Breite denselben Stürmen ausgesetzt wie das Meer.
Die Boote fuhren, von je sechs Wilden gerudert, tagsüber getrennt, trafen sich aber jeden Abend an einer verabredeten Stelle. Hier wurde gemeinsam gelagert und hin und wieder vor der Abfahrt am Morgen die heilige Messe gelesen. Die Fahrt dauerte volle 30 Tage und war außerordentlich beschwerlich.” (Autobiographie Chaumonots)
Endlich am 10. September stieß das Boot am Endpunkte des kleinen Sees Tsirargi (heute Mud-Lake) ans Land [bei Midland, Ontario, Luftlinie gut 700 km von Québec entfernt; die Länge der heutigen Autoroute beträgt über 900 km]. Man war am Ziel. Am Ufer erhob sich eine schlichte Hütte, das Missionshaus von Sainte Marie. Im Augenblick der Landung trat aus der Tür eine ehrwürdige Gestalt. Es war der Missionsobere P. Hieronymus Lallemant. “Freudig eilte er auf mich zu, umarmte mich zärtlich und führte mich in die Hütte, indem er mir sagte, eine innere Stimme habe ihn aufgefordert, mir entgegenzugehen” (Brief an P. Philipp Nappi, Oberer des Profeßhauses in Rom).
Wie sah es in der neuen Heimat aus?
“Unsere elf Patres hier”, so schrieb P. Chaumonot am 26. Mai 1640, “sind gegenwärtig auf drei Residenzen verteilt, damit sie so den bedeutenderen Dörfern, die sie unterrichten und zivilisieren wollen, näher wohnen. Unsere Wohnungen bestehen aus Baumrinde, wie die der Indianer, und sind ohne Zwischenwände im Innern; nur für die Kapelle ist ein eigener Raum abgesondert.
In Ermangelung eines Tisches und sonstiger Möbel essen wir auf dem Boden und trinken aus einem Rindenbecher. Die ganze Küchen- und Refektoreinrichtung besteht aus einem großen Holzteller, der mit ‘Sagamit’ gefüllt ist. Ich kann denselben (das Alltagsgericht der Indianer) wohl am besten mit dem Kleister vergleichen, wie man ihn in Europae zum Tapezieren der Wände gebraucht (Es war eine Art dünnen Breies aus Wasser und gestampftem Mais ohne Salz und jede Würze. Anmerkung Huonder).
Durst kennen wir nicht, teils weil wir kein Salz gebrauchen, teils weil unsere Nahrung meist mehr flüssig ist. Was mich angeht, so habe ich, seit ich hier bin - und das sind jetzt acht Monate -, im ganzen noch kein ganzes Glas Wasser getrunken.
Unser Bett besteht ebenfalls aus Stücken Baumrinde, über welche wir eine Decke breiten, die nicht dicker ist als ein Florentiner Piaster. Von Leintüchern ist natürlich nicht einmal für die Kranken die Rede. Die größte Beschwerde verursacht uns der Rauch, der beim Mangel eines Kamins den ganzen Raum erfüllt und alles schwärzt, auch was man gerne rein erhalten möchte. Wenn gewisse Winde wehen, kann man es in der Hütte kaum aushalten, so sehr schmerzen einen die Augen.
Zur Winterszeit gibt es abends kein anderes Licht als den flackernden Schein des Herdfeuers; an ihm beten wir unser Brevier, lernen die Sprache der Wilden und tun alles andere. Über Tag benutzen wir zu diesem Zweck das Loch am oberen Teile der Hütte, das gleichzeitig als Fenster und Rauchfang dient. Damit haben Sie ein kleines Bild von dem Leben hier in unseren Residenzen.
Was die Lebensweise auf unseren Missionstouren angeht, so müssen Ew. Hochwürden vor allem wissen, dass, während die Wilden untereinander gewisse Regeln der Gastfreundschaft beobachten, sie dieselben uns gegenüber außer acht lassen. Wir sind daher gezwungen, uns für die Reise mit einem Vorrat an Messern, Pfriemen, Ringen, Nadeln, Ohrgehängen und ähnlichen Dingen zu versehen, um damit unsere Gastwirte zu bezahlen. Außerdem nehmen wir eine Decke mit, die auf der Fahrt als Mantel, während der Nacht zum Schutz gegen Kälte dient.
Was die Art und Weise angeht, diesen Wilden das Wort Gottes zu verkünden, so geschieht die nicht so, dass wir aur eine Kanzel steigen und auf öffentlichem Platz predigen; vielmehr müssen wir Hütte um Hütte einzeln besuchen und dort am Herdfeuer denen, die uns Gehör schenken, die Geheimnisse des Glaubens erklären. Der einzige Ort, an welchem die Wilden ihre gemeinsamen Angelegenheiten beraten, ist die Hütte eines ihrer Häuptlinge.Eine solche Härte und Unempfindlichkeit im Herzen, wie wir sie hier bei diesen im Heidentum aufgewachsenen Wilden finden, hätte ich mir früher gar nicht vorstellen können. Es genügt nicht, sie von der Torheit ihres Aberglaubens und ihrer Fabeln und von der Wahrheit unseres Glaubens zu überzeugen; um sie zu gewinnen, muß man ihnen zugleich Hoffnung machen, dass die Taufe ihnen auch irdisches Glück und langes Leben bringe, denn diese armen Leute haben bloß Sinn für zeitliche Güter. Das kommt nicht von Stumpfsinn her, sind sie doch geistig regsamer als unsere Bauern und finden sich Häuptlinge unter ihnen, deren natürliche Beredsamkeit uns zur Bewunderung hinreißt. Der Grund ihrer Hartnäckigkeit liegt vielmehr in der Schwierigkeit, wie sie die Beobachtung der Gebote Gottes, zumal des sechsten, mit sich bringt.
Immerhin zeigt die wenn auch erst kleine Zahl von Gläubigen, die unser Herr sich erwählt hat, was die Gnade auch in diesen rohesten Herzen auf Gottes Erdenrunde vermag. Ich kenne einen dieser christlich gewordenen Indianer, der zur Zeit, als die Feindseligkeit gegen unsere Religion am heftigsten war, sich nicht scheute, als Apostel derselben fast alle Dörfer zu besuchen. Er ging in die Ratsversammlungen der Häuptlinge, warf ihnen unerschrocken ihre Torheiten vor, pries die Vernünftigkeit der Lehre, welche die Schwarzröcke - so nennen sie uns - ins Land gebracht, und erklärte sich bereit, für deren Verteidigung sein Leben hinzugeben.
Derselbe Wilde bat uns, die Exerzitien machen zu dürfen, und schöpfte aus denselben solchen Nutzen, dass der Pater, der ihm die Betrachtungen gab, geradezu erstaunt war. Würde man die Erleuchtungen, die dieser Wilde hatte, in einem unserer Jahresberichte niederschreiben, ist könnten selbst den frömmsten und eifrigsten Ordensleuten zur Lehre dienen. Doch es würde zu weit führen, wollte ich alle Beispiele heroischer Standhaftigkeit erzählen, welche dieser Wilde gegeben hat, obschon wohl nur das wenigste davon zu unserer Kenntnis kam. Das Gesagte wird genügen, um Ew. Hochwürden zu zeigen, dass Gott seine Gnade auch den wildesten Menschen nicht versagt und dass auch diese Völker sehr wohl fähig sind, die frohe Botschaft in sich aufzunehmen trotz der großen Schwierigkeiten, welche unter anderem die Armut ihrer Sprache der Glaubenspredigt bietet.
Diese Völker haben weder Weinberge noch Herden, weder Türme noch Städte, weder Salz noch Lampen, noch Tempel, noch Lehrer irgend welcher Kunst und Wissenschaft. Sie können weder lesen noch schreiben, und wir haben die größte Mühe, ihnen die Parabeln des Evangeliums zu erklären, in denen von den genannten Dingen die Rede ist. Trotzdem gelingt es den Patres, ihnen auch ohne diese Gleichnisse hinlänglich alles beizubringen, was sie zu ihrem Heile wissen müssen.”
3. Eine harte Lehrlingszeit
Als Anfänger wurde Chaumonot zunächst abwechselnd einem der älteren Missionare beigegeben. Unter ihnen fanden sich Heldengestalten wie Jean de Brébeuf, de Noué, Daniel, Jogues usw., die ihr Apostolat zum größten Teil mit dem Bekennertode krönten. Bessere Lehrer konnte sich Chaumonot nicht wünschen. Es scheint, dass P. Ant. Daniel, der bei den Huronen vom Fels-Clan wirkte, sein erster Meister war. “Da ich die Sprache der Huronen erst lernen mußte, sagte mir der Pater, ich sollte, falls ich Fortschritte zu machen wünsche, täglich in eine Anzahl der Hütten gehen, um dort von den Wilden selbst die Worte zu erfragen, und sie gleich so niederschreiben, wie sie aus ihrem Munde kämen. Bald empfand ich gegen diese Besuche in den Hütten einen solchen Widerwillen, dass es mir jedesmal, wenn ich eintrat, vorkam, als ginge ich auf die Folterbank, so weh taten mir die Spottreden und Verunglimpfungen, die ich bei diesen Gelegenheiten hinnehmen mußte.” Aber bald gab es noch ganz anderes zu kosten.
Im Winter 1640 war unter den Wilden eine ansteckende Seuche (eine Art Pocken) ausgebrochen, die furchtbare Verheerungen anrichtete und weder Alter noch Geschlecht verschonte. “P. Paul Ragueneau”, so berichtet Chaumonot, “erhielt den Auftrag, in allen verseuchten Dörfern (um Sainte Marie herum) die Runde zu machen, um die armen Sterbenden zu trösten, zu unterrichten, zu taufen und ihnen in jeder Weise beizustehen. Ich ging als Begleiter mit, und wir bekamen reichlich Gelegenheit, uns in der Geduld zu üben. Da die Seuche die Franzosen verschonte, hielten die Wilden uns für böse Zauberer und für die Anstifter des Unglücks und vertrieben uns aus ihren Hütten. Man hielt die Kinder vor uns verborgen, damit wir sie nicht vor dem Tode tauften. Die Erwachsenen aber stopften sich die Ohren zu, um unsere Unterweisungen nicht zu hören. Als ein junger Mensch am Fuße des Kruzifixes, welches P. Ragueneau am Halse trug, den Totenkopf bemerkte, hielt er das für den bösen Zauber und entriß dem Pater gewaltsam das Kruzifix. Als derselbe das Kreuz wieder an sich zu bringen suchte, ergriff der Wilde seine Tomahawk, um ihm den Kopf zu spalten. Ruhig, ohne zu erbleichen oder zu erzittern, sah der Pater das Beil über sich schweben, nahm, statt zu fliehen oder sich zu verteidigen, seinen Hut ab und bot sein Haupt zum Todesstreiche dar. Da fiel im entscheidenden Augenblick eine Indianerfrau dem Wütenden in die Arme und verhütete den Mord.
Schlimmer noch als die Tage waren die Nächte, denn weil man uns von dem Feuer fern hielt und allen Winden preisgab, litten wir große Kälte. Doch ich käme an kein Ende, wenn ich alle Unbilden aufzählten wollte, die man uns antat und durch welche man uns aus dem Lande zu vertreiben hoffte.Während des Winters waren wir jeden Tag gewärtig, die Todeskunde von einem unserer Mitbrüder zu erhalten, und empfingen täglich bei der Messe die heilige Kommunion als Wegzehrung. Schließlich aber blieb es bei einigen Stockschlägen und dem Leidwesen darüber, dass man einige der von uns errichteten Kreuze niedergerissen und einige unserer Hütten niedergebrannt hatte. Nur einer von uns sah auch sein Blut fließen, ‘aber nicht zum Tode’ (Hebr 12,4)....
Da sich Gott erfahrungsgemäß der Verfolgung bedient, um dem Glauben Eingang und Gedeihen zu verschaffen, so hoffen wir, dass der wahre Glaube auch in diesem unglücklichen Lande dereinst noch blühen wird; denn an Verfolgungen herrscht kein Mangel. Die Ernte ist vielversprechend, nicht nur, weil die Zahl der Wilden hier groß ist, sondern weil in dieser unermeßlichen Wildnis noch zahlreiche andere Völker zerstreut leben. Wir kennen bereits die Namen von mehr als 20 Stämmen, die nach dem Nordmeere zu lieben, aber wenig volkreich sind. Weiter landeinwärts jedoch sollen sich ungleich stärker bevölkerte Striche finden. Freilich, um dahin vorzudringen, müßten wir noch viel härtere Leiden auf uns nehmen, als uns die Fahrt hierher schon gekostet hat.”
Bisher hatte sich die Mission den eigentlichen Huronen (Wendats) zugewandt. Nun sollte der tapfere P. De Brébeuf den Versuch machen, die frohe Botschaft auch dem Stamme der Neutralen zu bringen, die etwa 12000 Seelen stark in ca. 40 Ortschaften weiter südlich zwischen dem Erie und Ontario und um den Niagara herum ihren Sitz hatten. “Die Neutralen”, so schildert sie Parkman, “übertrafen alle andern amerikanischen Stämme durch das Ebenmaß un die Kraft ihres Körpers, die Wildheit ihrer Sitten und die Auswüchse rohesten Aberglaubens. Das Land war voll von angeblich ‘Rasenden’, die, um sich ihre Schutzgeister oder Okis geneigt zu machen, splitternackt durch die Dörfer rasten, die brennenden Späne der Hüttenfeuer zerstreuten und alles auf ihrem Wege umwarfen” (Francis Parkman, Die Jesuiten in Nord-Amerika, 155 f).
P. Chaumonot sollte Brébeuf begleiten. Im November brachen die beiden auf. Zwei junge Huronenkrieger gingen als Führer, zwei französischen Diener der Mission als Händler verkleidet mit. Der Weg führte vier Tagereisen weit durch die beschneiten Wälder. “Wir mußten”, schreibt Chaumonot, “all unsere Vorräte auf dem eigenen Rücken tragen. Die Pfade in diesen Wäldern sind schwer gangbar, da sie nicht festgetreten, durch Dorngestrüpp und Buschwerk behindert und von Sümpfen, Bächen und Flüssen oft unterbrochen sind. Als einzige Brücken dienen Baumstämme, die durch Alter und Sturm niedergeworfen wurden. Trotzdem ist der Winter die beste Reisezeit, weil dann der Schnee die Pfade gleichmäßiger eben macht. Nur muß er fest gefroren sein, so wie wir es auf unserem Rückweg, zwei Tage ausgenommen, fanden. Sonst sinkt man bei jedem Schritt ein. Ein anderer Vorteil der Winterszeit ist, dass dann die Wasserläufe gefroren sind und man sein Gepäck streckenweise ziehen kann. Wir konnten dies 60 Stunden weit tun. Schutz gegen die um diese Zeit so heftigen kalten Winde findet man freilich nicht. Allein im Vertrauen auf Gott, dem Winde und Meere gehorchen, marschierten wir trotz Kälte und Müdigkeit mutig und fröhlich voran, wenn wir auch ungezählte Male auf das Eis hinfielen. Meine Knie haben davon ein gutes Andenken bewahrt. Aber was ist das alles im Vergleich zu dem, was unser Herr für mich gelitten hat! Ich werde mich glücklich schätzen, wenn ich in seinem Dienste Arme und Beine brechen darf.”
Endlich war Kandoscho, das erste Dorf der Neutralen, erreicht. Ein seltsamer Umstand trug dazu bei, die Fremdlinge hier günstig einzuführen. Was die Indianer besonders interessierte, waren die europäischen Schriftzeichen, die sie zum erstenmal sahen. Die Missionare erklärten ihnen, dass sie durch dieselben imstande wären, genau zu erfahren, was an einem ganz anderen Ort geschehe und gesprochen werde. Dies kam den Wilden unglaublich vor. Eine Probe sollte sie überzeugen. “P. Brébeuf verließ die Hütte und entfernte sich eine ziemliche Strecke. Inzwischen diktierte mir einer der versammelten Indianer mit leiser Stimme folgendes: ‘Ich gehe auf die Jagd und stoße auf einen Hirsch. Da nehme ich einen Pfeil aus dem Köcher, spanne meinen Bogen, ziele, und beim ersten Schuss fällt das Wild. Ich hebe es auf meine Schultern und trage es in meine Hütte, wo ich mit meinen Freunden einen Festschmaus halte.’ Kaum hatte ich diese kurze Erzählung niedergeschrieben, als man P. Brébeuf zurückrief. Ich gab ihm das Papier in die Hand, und nun las er Wort für Wort alles, was der Wilde mir gesagt hatte. Die Anwesenden stießen einen lauten Ruf der Verwunderung aus. Sie nahmen das Papier, drehten es nach allen Seiten und sagten zueinander: ‘Aber wo ist denn die Figur, die den Jäger darstellt? (Anmerkung Huonder: Bekanntlich haben auch die Indianer eine Art Zeichenschrift, mit der sie ihre Taten auf Birkenrinde oder auf Fellen in roher Weise darstellen, etwa in der Form eines Preisrebus) Wo ist der Hirsch? Wo der Kessel, wo die Hütte? Wir sehen nichts von alledem, und doch hat die Schrift Echon (indianischer Name Brébeufs) alles gesagt.’ Kurz, wir hatten die beste Gelegenheit, den Wilden zu erklären, dass uns die Schriften unserer Vorfahren (die Heilige Schrift) über den Glauben ebenso genau und wahrhaft alles berichteten, wie das von mir beschriebene Papier Echon alles gesagt habe, was er sonst nicht habe wissen können.”
Der weitere Verlauf entsprach jedoch nicht diesem ermutigenden Anfang. Um einen Freipaß für das ganze Land zu erhalten, mußte der Oberhäuptling und sein Rat befragt werden, dessen Dorf im Herzen des Landes lag. Dank den französischen Händlern und ihren stark begehrten Waren kam man glücklich durch.
Inzwischen war der Häuptling in den Krieg gezogen und wurde erst im Frühjahr zurückerwartet. Sein Stellvertreter erklärte, dass über den Abschluss eines Bündnisses mit den Franzosen, das die Missionare vorschlugen, nicht vor der Rückkehr des Häuptlings beraten werden könne, die Predigt ihrer Lehre ihnen aber freistehe.
Da die Lage gefährlich schien, geleiteten die Missionare die beiden Franzosen an die Grenze zurück und zogen dann ein zweites Mal durch die Wälder. Aber jetzt fanden sie überall feindselige Gesichter und meist verschlossene Türen. Die seltsamsten Gerüchte schwirrten umher: Echon wolle durch seine mächtigen Zaubermittel den ganzen Stamm ausrotten. Zwei dem Christentum feindselige Huronen hatten sie verbreitet. Die Schwarzröcke, so erzählten sie überall, hätten über ihren eigenen Stamm die todbringende Seuche gebracht, und sie würden dasselbe hier versuchen. Man solle sie aus dem Lande jagen oder noch besser erschlagen. Als Preis für den Mord setzten sie neun eiserne Äxte aus, ein um so verlockenderer Preis, da eiserne Werkzeuge in diesen entlegenen Strichen noch sehr selten waren und man sich mit Steinäxten begnügen mußte.
Brébeuf trat den Verleumdungen mit der ihm eigenen Beredsamkeit entgegen und erklärte in einer Ratsversammlung der Wilden den Zweck seiner Sendung. Einige, zumal die älteren Krieger, traten für ihn ein; aber die jüngeren, die sich den Mordpreis verdienen wollten, waren für den Tod der “Zauberer”. So wurde tief in die Nacht hinein um das Leben der Missionare gleichsam gewürfelt. Dieselben verrichteten inzwischen in einer andern Hütte gemeinsam ihr Abendgebet. Während desselben hatte P. Brébeuf eine Art Gesicht. Er sah im Geist eine Schreckgestalt, die nacheinander die Wurfspieße auf die Missionare schleuderte. Aber jedesmal wurde die Waffe durch eine unsichtbare Hand aufgehalten. Die Patres erkannten, dass sie in großer Gefahr schwebten, empfahlen sich dem Schutze Gottes und legten sich zur Ruhe nieder. Spät in der Nacht kehrte der Indianer, in dessen Hütte sie wohnten, aus der Ratsversammlung zurück, weckte die Patres und erzählte ihnen, die jüngeren Krieger hätten stürmisch ihren Tod gefordert, und dreimal sei ihr Schicksal fast besiegelt gewesen. Aber immer wieder seien die Jungen durch die Alten niedergestimmt worden. Das erklärte Brébeufs Gesicht.
So waren die beiden dem Tod zunächst entgangen. Aber die unsinnige Furcht der abergläubischen Wilden blieb. Sobald die Patres sich einem Dorfe näherten, hieß es gleich: “Da kommen die Agona” (Ausdruck für die schlimmsten Feinde). Nur mit Mühe konnten sie eine Nachtherberge finden.
“Unsere Zauberkräfte saßen”, so berichtet Chaumonot, “nach ihrer Meinung in unseren Tintenfässern und Büchern usw. Infolgedessen wagten wir es nur im geheimen, ein Buch zu öffnen oder irgend etwas zu schreiben. Aber nicht bloß unsere Bücher und Papiere, jede Gebärde und Bewegung machte uns in ihren Augen verdächtig. So wollte ich einst in einer Hütte, in die wir uns zurückzogen, um gesammelter zu beten, niederknien. Gleich verbreitete sich das Gerücht, Oronhiaguehre, d.h. Himmelsträger, wie mich nannten, haben einen Teil der Nacht damit zugebracht, seine Zaubermittel zu bereiten; man solle auf der Hut sein und sich vor ihm in acht nehmen.”
Schließlich verabredeten sich die Wilden, den Zauberern ihre Hütten ganz zu verbieten. Starr vor Kälte und schwach vor Hunger, fanden sie des Nachts jede Türe verschlossen. Sie passten an den Eingängen auf, und wenn sie einen Indianer aus einer Hütte kommen sahen, schoben sie sich mit einer raschen Bewegung durch die halboffene Tür in diese Höhle von Rauch und Schmutz. Ob solcher Kühnheit erstaunt, gafften die Bewohner sie erst schweigend an. Dann lief ein Bote mit der Nachricht hinaus und brachte eine erbitterte Menge zusammen.
“Geht und verlasst unser Land”, sagte ein alter Häuptling, “oder wir stecken euch in den Kessel und bereiten uns ein Mahl aus euch.”“Ich habe jetzt genug vom dunklen Fleisch unserer Feinde gehabt”, rief ein junger Krieger, “ich möchte einmal den Geschmack des weißen Fleisches kennenlernen.”
Ein Krieger stürzte wie ein Wahnsinniger in die Hütte, spannte seinen Bogen und zielte mit dem Pfeil auf Chaumonot. “Ich schaute ihn fest an”, schreibt dieser, “und empfahl mich vertrauensvoll dem Schutze des hl. Michael. Ohne Zweifel rettete uns dieser große Erzengel, denn fast augenblicklich legte sich die Wut des Kriegers, und die übrigen Wilden horchten auf die Erklärung, die wir ihnen über die Absichten unseres Besuches in ihrem Lande gaben.”
Trotz allem harrten die Missionare vier Monate lang in dem undankbaren Arbeitsfelde aus und besuchten 18 Dörfer. Da aber die feindselige Stimmung anhielt und Brébeuf der Ansicht war, dass ein längeres Verbleiben die Wilden nur noch mehr verbittern würde, kehrten die beiden vorläufig nach Huronia zurück.
Auf dem Marsch überraschte sie ein heftiger Schneesturm, der längere Zeit anhielt und ein Weiterkommen unmöglich machte. Dank der Vorsehung fanden sie in einer Indianerhütte gastliche Aufnahme. Zumal die Frau des Hauses nahm sich der Fremdlinge mit größter Liebe an und stimmte auch ihren Vater und ihren Mann zu deren Gunsten. Da die Patres wegen der Fastenzeit kein Fleisch aßen, kochte ihnen die Squaw eigens etwas anderes zurecht.
Die Patres benutzten die günstige Gelegenheit, um die vom Huronischen nicht unbedeutend abweichende Mundart der Neutralen zu studieren. Dabei half ihnen die gute Indianerin mit unermeßlichem Eifer, inden sie ihnen Wort für Wort, Silbe um Silbe wie kleinen Kindern vorsprach und auch kleine Erzählungen in die Feder diktierte.
Während die anderen Kinder - es war, wie es scheint, eine Gemeinschaftshütte mit mehreren Familien - sich von den übel beleumundeten Schwazröcken in scheuer Ferne hielten, wurden die Kinderchen der Gastwirtin immer zutraulicher und nicht müde, mit den bärtigen Fremdlingen zu plaudern. Umsonst suchten die übrigen, feindselig gesinnten Indianer die Frau gegen die Patres einzunehmen. Sie trat entschieden für dieselben ein, und ihre Kleinen fochten mit den übrigen Kindern mehr wie einen Strauß zugunsten der Schwarzröcke aus. Doch konnte auch die Gastwirtin nicht alle Unbilden von den Patres fernhalten. So drang einst einer der Rasenden in die Hütte, spuckte P. Chaumonot an, zerriß ihm den Rock, drohte ihm mit Feuerbränden und machte während mehrerer Nächte einen solchen Lärm, dass die Missionare kein Auge schließen konnten. Anderen stahlen ihnen ihre besten Sachen fort und drohten mit Mord und Feuertod. Doch schützte Gott das Leben seiner Diener, und nach 25 Tagen kehrten sie durch den schmelzenden Winterschnee nach Sainte Marie zurück. Ihr Mut war keineswegs gebrochen. “Nächstes Jahr”, schreibt Chaumonot, “hoffe ich einen zweiten Winter bei den Wilden zu verleben und rechne dann auf den Beistand Ihres Gebetes.”
“Wir haben”, so faßt Brébeuf in einem Brief an den Ordensgeneral das Ergebnis zusammen, “fünf Monate dort zugebracht und in Wahrheit viel gelitten. Nur wenige der Wilden liehen uns ein williges Ohr. Als wir sie aber verließen, luden uns fünf ihrer Häuptlinge ein, zu ihrem Stamm zurückzukehren.” Vorläufig nahm Chaumonot seine Arbeiten im eigentlichen Huronia wieder auf.
Bei einem der nächsten apostolischen Ausflüge durfte er auch schon wenigstens einige Tropfen Blut vergießen. Es war im Missionsbezirk St. Johann Baptist von Cahiage. Eines Tages begleitete er P. Daniel bei einem Rundgang im Dorf St. Michael (jedes Dorf, das besucht wurde, erhielt gleich den Namen eines christlichen Heiligen). Der Pater taufte in einer Hütte eine junge Frau, die im Sterben lag. Ein Verwandter derselben war darüber so erbost, dass er mit einem großen Stein bewaffnet am Eingang der Hütte sich aufstellte. Als P. Chaumonot als erster heraustrat, riß ihm der Wilde blitzschnell den Hut herab und versetzte ihm mit dem Stein einen so wuchtigen Schlag auf den Hinterkopf, dass der Pater bewußtlos zu Boden sank. Da er aber noch nicht tot war, holte der Mörder rasch ein Beil herbei, um sein Werk zu vollenden. P. Daniel, ein starker und behender Mann, entriß ihm jedoch die Waffe und machte den Rasenden mit Hilfe einiger herzugeeilten Indianer dingfest. P. Chaumonot wurde in eine Indianerhütte getragen. Gleich war der Indianerdoktor zur Stelle und untersuchte die Wunde. Er fand eine große Beule und schnitt dieselbe mit einem scharfen Stein auf, um das geronnene Blut herauszudrücken. Dann netzte er den Oberteil des Kopfes mit kaltem Wasser, nahm von dem mit Heilkräutern gemischten Wasser in den Mund und blies es in die Wunde. Wenige Tage darauf war alles geheilt. “So hat Gott sich mit meinem Verlangen nach dem Martyrium begnügt, oder vielmehr, er hielt mich nicht für würdig, um des ersten heiligen Sakramentes willen den Tod zu erleiden.”
Von Hause aus zart und durch die harten Schicksale seiner Knabenjahre geschwächt, schien Chaumonot anfangs den außerordentlichen Anforderungen der Huronenmission nicht gewachsen. Infolge der schlechten, unzureichenden Nahrung stellten sich heftige Unterleibsschmerzen ein. Aber er biss sich mit der ihm eigenen Willensstärke durch alle diese Schwierigkeiten durch und blieb auf seinem Posten. “Gott gab mir die Gnade, dass ich trotz allem niemals auch nur mit einem einzigen Gedanken mich nach Europa zurücksehnte. Im Gegenteil war ich entschlossener denn je, mein ganzes Leben in dieser Mission zu verbringen.”
Wie man sieht, hatte der Lehrling seine ersten Probejahre gut bestanden, und sein Meister Brébeuf stellte ihm denn auch in einem Schreiben an den Ordensgeneral ein treffliches Zeugnis aus. “P. Calmonotus (Chaumonot)”, so schrieb er, “wird, wie ich zuversichtlich hoffe, Christus in diesem Lande ausgezeichnete Dienste leisten. Er hat in der Sprache dieses Volkes (der Neutralen), die von derjenigen der anderen Huronen nicht allzuviel abweicht, große Fortschritte gemacht. Er ist eine ganz ungewöhnliche Kraft (vir est omnino egregius).”
In der Tat hatte sich Chaumonot dank seinem ganz ungewöhnlichen Sprachtalent das Huronische und seine Dialekte so vollkommen angeeignet, dass er schon bald als ihr bester Kenner galt und später selbst die Wilden erklärten, dass er das Huronische besser spreche als sie selbst, obschon sie ihre Sprache durchweg mit großer Leichtigkeit und Beredsamkeit handhabten.
(Anmerkung Huonder: P. Chaumonot verfaßte etwas später (um 1549?) auch die erste Grammatik “dieser schwierigsten aller nordamerikanischen Sprachen”, ein Werk, das den andern Missionaren außerordentlich gute Dienste leistete und 1831 von Wilkie in englischer Übersetzung veröffentlicht wurde (Quebec. Lit. and Hist. Soc. Trans. VII, 1831). Auf Grund seiner ungewöhnlichen Sprachkenntnisse wurde P. Chaumonot, der keinen vollen theologischen Kurs gemacht hatte, am 18. Oktober 1651 vom Ordensgeneral zur Profession der drei feierlichen Gelübde zugelassen.)
4. Aufschwung und Vernichtung der Huronenmission
Die harte Pflügearbeit der ersten Jahre in einem so dornigen und steinigen Acker brachte allmählich die ersehnte Frucht. Es war den Missionaren gelungen, einige der hervorragendsten Häuptlinge für das Christentum zu gewinnen, und dank ihrem großen Einfluß und ihrer eifrigen Mitarbeit faßte die Mission zumal im eigentlichen Huronenlande festen Fuß.An Stelle der Wandermission trat nur die Missionierung von festen Stationen aus und die ordentliche Gemeindebildung. 1639 bestanden bereits fünf Hauptstationen mit zusammen 30 Nebenstationen.
Jede dieser Missionen hatte ihr Kirchlein und eine Glocke, die oft einfach an den Ästen eines nahen Waldbaumes befestigt war, dazu ein schlichtes Priesterhaus mit zwei bis drei Missionaren und einigen sog. donnés, d.h. meist jungen Franzosen, die sich aus Liebe zu Gott unentgeltlich dem Dienste der Mission weihten und die noch fehlenden Laienbrüder ersetzten.
Diese “Missionen” waren zumeist keine ausschließlich christliche Ortschaften, sondern bereits bestehende, mit Heiligennamen benannte Huronendörfer, in denen Heiden und Christen zusammenwohnten. Aber die Zahl der letzteren nahm von Jahr zu Jahr zu und gewann immer mehr das Übergewicht.
Mit der äußeren Entwicklung hielt die innere Erstarkung gleichen Schritt. Einmal für die Wahrheit gewonnnen, nahm der Hurone mit dem ihm angeborenen Ernst das Christentum in sich auf. Die Jahresberichte (Relations) aus dieser Zeit sind voll ergreifend schöner Züge, welche diesen tröstlichen Umschwung beleuchten.
An diesem Aufbau der jungen Huronenkirche nahm Chaumonot einen hervorragenden Anteil. Aber gerade als das Werk vollendet schien und die Missionare die süßen Früchte zu kosten begannen, kam der Sturm, der bereits seit langem unheildrohend am Himmel hing, jetzt aber mit tobender Gewalt hereinbrach und das mühevolle Werk eines Vierteljahrhunderts in kurzer Frist vernichtete. Ursache und Träger dieser Katastrophe waren die Irokesen.
Die Irokesen saßen südlich vom Ontariosee in der Nordwestecke des heutigen Staates New York, etwa in dem Viereck, das zwischen den heutigen Städten Buffalo, Rochester, Albany und Scranton liegt. Ursprünglich wohl ein Volk mit den Huronen bildend, lagen sie mit diesen seit langem in unversöhnlicher Fehde. Das Bündnis Frankreichs mit den Huronen und die Siege Champlains über die stolzen Irokesen hatten deren Hass auch auf die französische Kolonie und folgerichtig auf die Mission gezogen. Die Irokesen fanden ihrerseits Bundesgenossen und bereitwillige Helfer in den kalvinischen Holländern und den Engländern, welche die grimmigen Krieger immer wieder gegen die Franzosen hetzten und ihnen durch Überlassung von Feuerwaffen eine starke Überlegenheit über die Huronen verliehen. Leider versäumte es Frankreich, seine Bundesgenossen in ähnlicher Weise zu stärken und zu unterstützen. Solange Champlain lebte, hielt er die Irokesen in Schach. Nach seinem Tode (1636) begannen sie wieder ihr altes Spiel, machten die huronischen Wälder unsicher, überfielen kleine Niederlassungen und versprengte Huronenbanden, lauerten in der Zeit der Jahresfahrten nach Quebec in den Uferwäldern und bedrohten die vorüberziehenden Huronenflottillen. “Wir schweben jetzt”, schrieb Chaumonot bereits 1640, “beständig in Gefahr, von den Irokesen gefangen genommen und ebenso behandelt zu werden wie die Huronen, unter denen wir leben. Alljährlich müssen wir nämlich auf unserer Fahrt hin und zurück von Quebec gerade die Strecken passieren, wo diese Todfeinde unserer Huronen im Hinterhalt liegen, um die Durchziehenden abzufangen.”
Gelegentlich brachten die Huronen ihren Gegnern wohl auch eine Schlappe bei, im ganzen aber behielten die straffer organisierten Irokesen die Oberhand. Mochten ihre fünf Stämme (Senecas, Cayugas, Onondagas, Oneidas, Mohawks) unter sich auch noch so viel in Streit und Hader liegen, gegen den gemeinsamen Feind waren sie immer einig.
War es bis 1642 bei jährlichen Steifzügen und gelegentlichen Überfällen geblieben, so ging die Stammesfehde seit Ende der vierziger Jahre in einen förmlichen Vernichtungskampf über. 1642 war Contarea, die stärkste Grenzfeste der Huronen, gefallen. Die ganze Bevölkerung wurde niedergemacht oder gefangen fortgeschleppt. Dadurch war auch St. Baptist (Cahiage) bedroht und mußte verlassen werden.
Am 4. Juli 1648 nahmen die Irokesen St. Joseph im Sturm. P. Ant. Daniel [Antoine Daniel (1601 - 1648) wurde 1930 heiliggesprochen], der die Flucht der Seinen decken wollte, wurde mit den meisten seiner Christen grausam ermordet. Am 16. März 1649 fielen St. Ignatius und St. Louis nach tapferer Gegenwehr. Brébeuf und Gabriel Lalemant starben unter furchtbaren Qualen in der Gefangenschaft.
“Um diese Zeit”, so erzählt P. Chaumonot, “war ich der Seelsorger eines Dorfes (La Conception an den Ufern des Huronensees), das fast ganz aus Christen bestand. Die Irokesen hatten eine Ortschaft (St. Louis) angegriffen, die zehn Meilen von uns entfernt lag. Das gab unseren Tapferen Gelegenheit, auszurücken und den Angriff abschlagen zu helfen. Mit ihnen zog auch die Mannschaft von St. Magdalena oder Arenta. Allein der Feind war zahlreicher, als man vermutet hatte, und unsere Mannschaft wurde geschlagen. Zwei Tage später kam die Nachricht, dass alle unsere Krieger getötet oder gefangen weggeschleppt seien. Es war Mitternacht, als die Schreckenskunde eintraf. O, wer beschreibt das Wehklagen, Jammern und das herzzerreißende Schreien, das aus jeder Hütte drang! Da hörte man Frauen, die um ihren Gatten, Mütter, die um ihre Söhne weinten... Auf einmal packte die nicht unbegründete Furcht, die siegreichen Irokesen möchten auch hierher kommen und das wehrlose Dorf überfallen, einen alten Mann. Er begann auf der Straße auf und ab zu rennen mit dem Rufe: ‘Fliehet, fliehet! Laßt uns fortziehen, ehe der Feind kommt und uns alles raubt.’ Auf diesen Ruf hin eilte ich von Hütte zu Hütte, um die Katechumenen noch rasch zu taufen, die Neophyten Beichte zu hören und allen wenigstens die Waffe des Gebetes in die Hand zu geben. Bei meinem Rundgang bemerkte ich bald, dass die ganze Einwohnerschaft das Dorf verlassen wollte, um Zuflucht bei einem anderen Stamme zu suchen, der etwa 39 Meilen weit entfernt wohnte.
Sofort war ich entschlossen, den armen Flüchtlingen zu folgen, damit sie wenigstens der geistlichen Hilfe nicht entbehrten. In der Eile hatte ich vergessen, einige Vorräte mitzunehmen, und so mußte ich den ganzen langen Marsch ohne Speise und Trank zurücklegen. Dennoch fühlte ich nicht die geringste Ermüdung. Ich wurde auf dem Wege so nach allen Seiten in Anspruch genommen, dass ich an anderes gar nicht denken konnte. Hier hatte ich Beicht zu hören, dort einige zu taufen, die das Sakrament noch nicht empfangen hatten. Es war Winter, und so mußte ich in Ermangelung anderen Wassers die Taufe mit Schnee erteilen, den ich in meiner Hand schmelzen ließ. Dass die Kraft, die mich in diesen harten Tagen aufrecht erhielt, von oben kam, ersah ich daraus, dass ein Franzose, der sich im Zuge befand, auf dem Marsch durch völlige Erschöpfung dem Tode nahe kam, obschon er von ungleich stärkerer Leibesbeschaffenheit schien als ich.”
Die Mission war vernichtet. Von fünfzehn Huronendörfern blieben nur noch rauchende Trümmer; ihre Einwohnerschaft, soweit sie sich nicht nach einem sicheren Ort hatte retten können, irrte flüchtig in den Wäldern umher. Eine Reihe Ortschaften wurden von den Huronen selbst in Brand gesteckt, damit nicht die Irokesen sich dort festsetzten.
Die meisten Flüchtlinge hatten sich nach der Hauptstation Sainte Marie gewendet. Aber auch hier gab es keine Sicherheit mehr, und man mußte sich nach einem besser geschützten Zufluchtsorte umsehen. Auf Bitten der Häuptlinge wurde das Eiland Ahuendoe oder St. Joseph (heute Christian Islands) gewählt, wo bereits im Jahr zuvor eine kleine Missionsniederlassung begonnen worden war. Am 15. Mai 1649 steckte man unter Tränen Sainte Marie I mit Residenz, Befestigung und Kapelle, die Frucht einer zehnjährigen Arbeit, in Brand und setzte auf Flößen und einem rasch gebauten Schiffe nach dem rettenden Eiland über. In einigen Tagen war der Umzug vollzogen, gerade noch rechtzeitig, denn bereits streiften Irokesen in der Gegend und griffen einige Nachzügler auf.Auch P. Chaumonot hatte wenigstens einen Teil seiner Flüchtlinge nach Sainte Marie II auf der St. Josephsinsel gerettet, in richtiger Voraussicht, dass das Gebiet der Pettun-Huronen kenie genügende Sicherheit biete. In der Tat fielen die Irokesen wenige Monate später dort ein. Mutig zogen die Pettuns ihnen entgegen; aber der Feind nahte sich hinterlistig in entgegengesetzter Richtung, fiel plötzlich über die wehrlose Ortschaft St. Baptist (Etharita) her und richtete ein furchtbares Blutbad an, bei dem acuh P. Karl Garnier den Bekennertod erlitt. Sein Gefährte, P. Noël Chabanel, war tags zuvor mit einem Teil der Christen geflüchtet, wurde aber auf dem wege nach der St. Josephsinsel von einem Huronenapostaten meuchlings erschlagen. Die andere Pettun-Station, St. Matthias von Ekarenniondi, hielt sich noch bis zum Sommer 1650.
Mit welcher Gesinnung P. Chaumonot die harte Prüfung aufnahm, ergibt sich in ergreifender Weise aus dem Schreiben, das er am 1. Juni 1649 von der St. Josephsinsel aus an P. Hieronymus Lalemant, damals Oberer der ganzen kanadischen Mission, richtete:
“Nach dem Tode des jungen Droüart (Anmerkung von Huonder: Der junge Franzose hatte sich als donné dem Dienste der Patres geweiht. Er war 1648 bei einem Ausgang am Abend von den Wilden erschlagen worden.) habe ich Gott innerlich um Opfer gebracht, was mir in dieser Welt das Liebste wäre, in der Erwägung, dass es nichts gibt, mag es noch so kostbar sein, dessen Vernichtung wir nicht bereitwillig hinnehmen müssen, falls daraus etwas zur Ehre Gottes herauskommt. Unter anderen Dingen, die ich Gott auf diese Weise still zum Opfer brachte, waren die mir anvertrauten Christen von Conception und unser Haus in Sainte Marie. Beide galten mir von allem, was ich auf Erden besaß, als das Teuerste. Der liebe Gott hat mein Opfer angenommen. Alle meine armen Christen von Conception (d.h. die kriegsfähige Mannschaft), drei bis vier ausgenommen, sind von den Irokesen getötet oder gefangen und das Haus in Sainte Marie zerstört worden, obschon in schonenderer Weise, als wozu ich mich von vornherein in meiner Betrachtung bereit erklärt hatte. Ein viel angenehmeres Opfer aber haben Gott die guten Patres de Brébeuf und Gabriel Lalemant bringen dürfen, non aliena, non sua, sed seipsos immolando (indem sie nicht Fremdes, nicht das Ihrige, sondern sich selbst dahingaben). Welch ein kostbares Opfer waren diese tugendhaften Patres! O, dass ich es nicht in meiner Person fortsetzen konnte! Das wird der Fall sein, wenn es Gott gefällt.
Wir Patres hier haben alle unsern Beruf nie mehr geliebt als gerade jetzt, nachdem wir gesehen, dass derselbe uns bis zur Glorie der Märtyrer erheben kann. Sollte ich meinen Anteil daran verlieren, so tragen meine vielen Unvollkommmenheiten allein die Schuld. Wenn aber Ew. Hochwürden mir denselben von unserem Herrn auf Grund der Verdienste seiner großen Diener, der Patres Jogues, Daniel, de Brébeuf und Lalemant, erflehen, so darf ich hoffen, dass er Herr auch mir die Gnade, für die Ausbreitung seines Reiches zu sterben, nicht vorenthalten wird.
Seit einem Monat weile ich auf Ahuendoe, der Insel St. Joseph, wohin die Mehrzahl unserer armen Huronen geflohen ist. Hier sehe ich einen Teil des unsäglichen Elends, das Krieg und Hunger über dieses arme, verlassenen Volk gebracht haben.
Seine gewöhnliche Nahrung besteht nur noch aus Eicheln oder einer bitteren Wurzel, die sie Otsa nennen, und glücklich sind die, welche wenigstens noch diese Nahrung haben. Andere leben teils von Knoblauch, den sie unter der Asche oder in Wasser ohne jede andere Zutat kochen, teil von geräuchertem Fisch... Es gibt noch Ärmere, die auch das nicht haben, und Kranke, die ihren Unterhalt nicht selbst suchen können.
Fügen Sie dieser Armut hinzu, dass die Leute jetzt von neuem die Wälder roden, Hütten bauen und Palisaden errichten müssen, um sich für das kommende Jahr vor Hunger und Überfall zu schützen.
Kurz, wenn Sie sie sähen, Sie würden glauben, es seien Tote, die man aus den Gräbern geholt. O wie gerne möchte ich allen Personen, die für unsere Huronen ein Herz haben, die ganze Not schildern, in welche dieses Volk geraten ist! Sie würden gewiß heiße Tränen des Mitleids vergießen. Im Namen dieses armen Volkes rufe ich allen zu: Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos, amici mei, quia manus Domini tetigit me.
Der allgütige Jesus war einst von Mitleid gerührt beim Anblick einer einzige Witwe, deren Sohn man zu Grabe trug. Wie sollten nicht seine Apostel und Nachfolger von Mitleid bewegt sein beim Anblick von hundert und aber hundert Witwen, denen man nicht bloß ihre Söhne, sondern auch ihre Männer und Väter erbarmungslos getötet und weggeschleppt oder aufgefressen hat!
Was mir am nächsten geht, ist das Schicksal der armen Witwen und Waisen von Conception, jenes Dorfes, das die Huronen selbst allgemein ‘das Dorf des Glaubens’ nannten, und mit Recht, da es dort nur ganz wenige Heiden gab. Im letzten Winter ist dort keine einzige öffentliche Sünde begangen worden, da die Christen bei ihrem beherrschenden Einfluß auch die Heiden daran hinderten. Diese wünschten einen Doutetha-Tanz, mit welchem die Musiker, die aus einem anderen Dorf herübergekommen waren, ein Endakwandet-Fest verbinden wollten. Aber die Christen widersetzten sich so entschieden, dass keiner der Häuptlinge es wagte, die Ausrufung des Festes anzuordnen, und die Musiker beschämt in ihr Dorf zurückkehren mußten. [Nach dem Historiker Bruce Trigger gehörte zum Ritual des Endakwandet-Festes öffentlicher Geschlechtsverkehr, zu dem die Mädchen des Dorfes bestimmt wurden]. Das war die letzte Tat, durch welche die Christen das offene Bekenntnis ihres Glaubens besiegelten. Drei Tage später metzelten die Irokesen sie großenteils nieder oder schleppten sie als Gefangene fort. Die übrigen haben zur Verteidigung ihres Heimatlandes tapfer bis in den Tod gekämpft.
Als Karl Ondaiaiondiont [ein wichtiger Kriegsführer, der sich 1640 hatte taufen lassen], so wird uns berichtet, sah, dass der übermächtige Feind nicht mehr aufzuhalten sei, kniete er nieder, um seine Seele Gott zu empfehlen, und fiel kurz darauf durch den Schuß aus einer Hakenbüchse. Acowendoutie von Arenta wurde als Leicht mit gefalteten Händen gefunden. Er war einer der Huronen, welche einst den Leib des P. de Nouë (Anmerkung Huonder: P. de Nouë erfror auf einer Missionstour am 1. oder 2. Februar 1646) [Anne de Nouë war der erste Jesuit, der in Kanada den Tod fand. Ihm folgte am 12. Mai 1646 P. Énemond Massé] in dieser Haltung aufgefunden hatten; ohne Zweifel hatte Acowendoutie dies nachahmen wollen.Zum Schlusse will ich Ihnen auch das Gebet mitteilen, das René Tsondihouané [Huonder schreibt: Tsondikwannen. Es handelt sich um einen Huronen, der sich wohl im Frühjahr des Jahres 1639 hatte taufen lassen, im Alter von über 60 Jahren. Er besaß die Gabe des Gebetes, begleitet von Erscheinungen, prophetischen Träumen und verschiedenen Wundern; so Guy Laflèche in: Les Saints Martyrs Canadiens, 3. Band: Le Martyre de Jean de Brébeuf selon Paul Raguneau, Québec 1990, S. 273] im Augenblick sprach, als die christlichen Krieger Conception verließen, um dem Feind entgegenzuziehen: ‘Herr Gott, Meister unseres Lebens, habe Mitleid mit den Christen, die da den Irokesen entgegenziehen; verlaß sie nicht, damit nicht durch unsere Feinde, falls sie siegen, der Fortschritt des Glaubens aufgehalten wird.’
Dass sein Gebet keine Erhörung fand, beirrte ihn nicht, auch nicht, als sein Schwiegersohn Tsoendiai fiel und sein Sohn Thancusa [Ihanneusa] in Gefangenschaft geriet. Wiederum war ich Zeuge, wie er betete: ‘Mein Gott, was geschehen ist, dass nämlich unsere Brüder fielen, ist das beste; wir Menschen fragen: Weshalb fiel die Entscheidung so aus? Aber wir haben keinen Verstand. Du allein weißt, was das beste ist. Und wenn wir dereinst in den Himmel kommen, werden auch wir sehen, dass, was geschah, so geschehen mußte, und dass es nicht gut gewesen, wäre es anders gegangen.’
Euer Hochwürden sehen daraus, wie wahr es ist: Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum (Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum besten).
Noch eines. Ich hatte die Ehre, drei Wochen lang der Lehrer Ihres guten Neffen (Anmerkung Huonder: Gabriel Lalemant. Es gab drei Lalemant in der Mission: Karl, Missionsoberer 1625, + 1674 in Frankreich; Hieronymus, sein Bruder, gleichfalls Oberer, + 1673; Gabriel, ihr Neffe, wurde nach dreijähriger Tätigkeit 1649 von den Irokesen gemartert) im Huronischen zu sein. Es ist unglaublich, welche Mühe er sich gab, um die Sprache zu lernen, und welche Fortschritte er machte. Einige unserer Patres sind der Meinung, dass Gott ihm diesen großen Eifer durch einen so seligen Tod belohnt hat.”
Inzwischen wurde auf der St. Josephsinsel ein Sainte Marie II errichtet und ein 17 Fuß hoher Schutzwall aus solidem Mauerwerk aufgeführt. Allein so oft die Huronen auf das Festland herüberkamen, um durch Jagd oder Fischfang die kärglichen Vorräte auf der Insel zu ergänzen, wurden sie vom Feinde mit überlegener Macht angegriffen und aufgerieben. Die Lage auf dem Eiland wurde immer unhaltbarer. Es bliebt nichts übrig, als das Huronenland ganz zu verlassen und in die französischen Kolonie von Quebec auszuwandern. Es war ein harter Entschluss, denn er bedeutete für die einen das Aufgeben einer durch so viel Schweiß erkauften und so viel Blut geheiligten Eroberung, für das arme Volk die Preisgabe des Landes seiner Väter.
Am 10. Juni begann der traurige Exodus. Der Zug bestand aus 13 Patres, 4 Laienbrüdern, 22 données, 11 Dienern, 4 Knaben und 6 Soldaten. Die Zahl der mitziehenden Huronen überstieg nur wenig 300, hauptsächlich Greise, Frauen und Kinder. Die waffenfähige Mannschaft war zumeist gefallen oder in Gefangenschaft, ebenso viele junge Frauen und Mädchen, der Rest noch über das Land hin versprengt. Unterwegs stieß man mit einer Schar von 40 Franzosen und einigen Huronen zusammen, die unter Führung P. Bressanis [Franz Joseph Bressani SJ, 1612 - 1672, war 1642 nach Kanada gekommen] der bedrängten Mission zu Hilfe eilen sollte. Sie kam zu spät, und beide Flottillen setzten den Weg nach Quebec fort, das man am 28. Juli 1650 nach fünfzigtägiger Reise erreichte.
Zunächst wurde den armen Flüchtlingen unter den Wällen des Forts von Quebec eine Zufluchtsstätte angewiesen und P. Chaumonot mit ihrer Seelsorge betraut. Im Frühjahr 1651 siedelte dieser mit seinen Pflegebefohlenen, deren Zahl durch neue Flüchtlinge sich langsam auf etwa 500 mehrte, nach der im St. Lorenzostrome anderthalb Stunden flußabwärts von Quebec gelegenen Insel Orléans über, wo die Jesuiten ein Stück Land besaßen. Chaumonot ließ den Wald teilweise niederlegen und den so gewonnenen Ackergrund mit Mais und anderen Früchten bestellen.
“Wir halfen”, so berichtet die Relation von 1651/52, “diesen guten Leuten die Felder bestellen, und sie haben dieses Jahr eine ziemlich gute Maisernte gehabt, wenn auch nicht ganz zu ihrem Unterhalt. Wir unterstützen sie mit den aus Frankreich gesandten Almosen. Wir haben auch eine Schanze oder eine Art kleine Festung aufführen lassen zum Schutze gegen die Irokesen ... und eine recht hübsche Kapelle samt Priesterhaus errichtet. Die Hütten unserer Neophyten liegen ganz nahe dabei unter dem Schutze des kleinen Forts.
Gott hat dieses Volk auf eigenartige Weise und auf seltsamen Wegen geführt und offenbar im Sinn, es recht hoch zu heben, da er es so tief herabdrückt. Sein Wille sei gebenedeit in Zeit und Ewigkeit.”
5. P. Chaumonot geht zu den Irokesen
P. Chaumonot stand jetzt im Anfang der vierziger Jahre, also im besten Mannesalter. Wie lieb ihm seine Huronengemeinde auch war, die mit rührender Liebe an ihm hing, so ging doch die Sehnsucht seines Herzens nach den unermeßlichen Wäldern, wo noch so viele wilde Stämme der frohen Botschaft harrten. Dieser Wunsch nach apostolischen Mühen und Leiden sollte sich bald erfüllen.Seit dem Jahre 1653 machte sich bei den Irokesenstämmen eine starke Bewegung zum Frieden bemerklich. Im Juni 1653 erschien in Quebec eine Flottille mit 60 Onondagaskriegern, um mit Onnontio, d. h. dem Statthalter de Lauzon, über den Frieden zu verhandeln. Es schien ihnen Ernst zu sein, und es kam zu einer feierlichen Verhandlung auf der Insel Orléans. Der sprachkundige P. Chaumonot machte auf Wunsch des Statthalters den Dolmetscher. Feierlich rief der Häuptling der Onondagas zuerst die Sonne, die das Dunkel erhelle und alles enthülle, zum Zeugen an, dass sein Herz ohne Falsch sei. Dann wurden die bei solchen Gelegenheiten nie fehlenden Wampuns vorgezeigt. Es waren Halskrägen, Gürtel, Armbänder oder Halsketten, kunstvoll aus bunten Porzellanperlen gefertigt.
“Kein Vertrag”, schreibt Parkman, “keine Rede, keine Zusage hatte bei Verhandlungen mit anderen Stämmen bindende Kraft, wenn sie nicht durch Überreichung eines Wampuns beglaubigt waren. Auf diese Gürtel stickten sie bei gewissen Anlässen besondere Zeichen, die sich auf den Gegenstand des Vertrages bezogen und zur Unterstützung des Gedächtnisses dienten.” Die Rede knüpfte dann meist Punkt für Punkt an diese Zeichen an und deutete sie in oft recht geistvoller, witziger Weise.
So war es hier. Der erste Wampun sollte die vielen Tränen der Huronen und Franzosen über die in den Kriegen Gefallenen trocknen; der zweite als süßes Tränlein dienen, um alle Bitterkeit vergessen zu machen; der dritte als Decke über die Toten ausgebreitet werden, damit nicht ihr Bild die alten Klagen und Fehden wecke; der vierte sie tiefer einschaufeln, damit ihre Geister nicht wieder herausstiegen; der fünfte als Hülle dienen, um die Waffen gut zu verbergen; der sechste die Flüsse von dem vielen Blut reinigen, das sie gerötet; der siebte endlich war den Huronen geweiht, um sie geneigt zu machen, allem zuzustimmen, was Onnontio über den Frieden beschließe. Biberfelle und ähnliche Geschenke wurden den Wampuns beigegeben. Der Statthalter ließ Geschenk um Geschenk erwidern und durch P. Chaumonot mit entsprechenden Erklärungen begleiten.
Das erste Geschenk sollte das Kriegsbeil aus der Hand der Onondagas nehmen; das zweite die Kessel zerschlagen, in denen sie das Fleisch ihrer Gefangenen kochten; das dritte das Messer wegnehmen, das bei diesen Schlächtereien gedient; das vierte Bogen, Pfeile und die anderen Waffen bannen; das fünfte die Farben ausmerzen, mit denen sie ihr Gesicht zum Kriege bemalten; das sechste die Kriegkanoes so gut verbergen, dass sie dieselben nicht wiederfänden usw. Das alles wurde von den Irokesen zugesagt. Sie würden die Kunde ihren Brüdern zutragen und im Jahr darauf die Antwort zurückbringen. Auch von anderen Stämmen kamen Gesandtschaften. Selbst die Mohawks, der schlimmste und heimtückischste aller Irokesenstämme, schienen einlenken zu wollen.
Wirklich fanden sich die Onondagas im folgenden Sommer wieder ein, brachten die Friedenszusage ihres Stammes, verlangten Missionare und besiegelten alles durch Überreichung vno 24 Wampuns. Das Blutfließen sollte aufhören, das war der Grundgedanke der Rede. Wir wollen Brüder sein und bitten, dass die Franzosen und vorab die Schwarzröcke in unser Land kommen, um unsere Kinder zu erziehen und uns den rechten Weg zu lehren.
Zum Schluß erhob sich ein von den Onondagas adoptierter Huronenhäuptling und versicherte, dass die Onondagas es aufrichtig meinten. Diese Erklärung war nicht überflüssig. Wie oft schon hatten die Irokesen ihr gegebenes Wort gebrochen! War doch P. Jogues bei einer solchen Friedensgesandtschaft vn den Mohawks hinterlistig ermordet worden. Nach längerer Beratung entschied sich der Statthalter zur Absendung von Missionaren, die in seinem Namen den Friedensvertrag in feierlicher Ratssitzung der Stämme rechtskräftig schließen und die Glaubenspredigt beginnen sollten.
Freudig nahmen die Patres den Entscheid entgegen. Ein neues, größeres Arbeitsfeld schien sich zu öffnen und damit eine neue Gelegenheit, für Christus zu kämpfen und zu leiden. Auf besonderen Wunsch des Statthalters wurde P. Chaumonot mit der wichtigen Sendung betraut und P. Claudius Dablon ihm als Gefährte zugesellt.
Am 19. September 1655 fuhr die Indianerflottille mit den Patres an Bord von Quebec ab. Es waren 30 Onondagas mit ihren Frauen, die sie zum Zeichen ihrer Friedensgesinnung mitgebracht hatten, zwei Senecas-Irokesen und einige christliche Huronen.
Über die lange, abentuerliche Fahrt in den irokesischen Süden hat uns P. Dablon einen überaus anschaulichen Bericht hinterlassen. Einige Züge seien daraus mitgeteilt.
Sonntags wurde wo möglich am Waldrand in einer Kapelle aus grünem Blätterwerk die heilige Messe gelesen. Den Meßwein lieferte die wilde Rebe des Urwaldes. Die leicht gebrechlichen Kanoes aus Birkenrinde waren zum Warentransport wenig geeignet, so dass die Missionare sich auf die notwendige Ausrüstung hatten beschränken müssen. Jagd und Fischfang auf der Fahrt schafften den täglichen Unterhalt. Je nach ihrem Ergebnis fiel der Küchenzettel reichlich oder mager aus. So mußte man den einen oder anderen Tag mit dem bereits halb verwesten Fleisch einer ertrunkenen “Wildkuh” (wahrscheinlich ist ein Elentier [Elch] gemeint) vorlieb nehmen. “Aber der Hunger ist ein guter Koch. Er tat in sein Gericht weder Salz noch Pfeffer noch Muskatnuß und machte es doch schmackhaft. Oder vielmehr der Eifer und das Verlangen, diese armen Völker Gott zu gewinnen, streut über alle Schwierigkeiten, die man findet, einen so süßen Zucker, dass man in Wahrheit dulcedinem in forti, die Süßigkeit auch in der Bitterkeit findet.”Dann hatten die Jäger wieder Glück. Einmal wurden acht, ein anderes Mal sogar 30 Bären erlegt, und mehrere Tage schwelgten die Wilden in Überfluß und rieben sich von der Sohle bis zum Scheitel mit dem geschmolzenen Bärenfett ein.
Am 24. Oktober erreichte man den Ontariosee und fuhr längs dessen malerischen Südufern und Strandinseln bis zur Mündung des Otihatange (Oswego Ricer). Auf der Flußfahrt landeinwärts begegnete man einem Trupp hierher versprengter, fischender Huronen. In ihrer Freude, einen ihrer Schwarzröcke wiederzusehen, warfen sie sich P. Chaumonot an den Hals, luden ihn zum Mahl ein, brachten Geschenke und baten, er möge wieder einmal nach so langer Zeit mit ihnen beten. So wurde unter freiem Himmel Gottesdienst gehalten, nachdem der Pater sie unterrichtet und Beicht gehört hatte.
Am 30. Oktober verließ man die Kanoes und trat zu Fuß den Marsch nach Onondage, dem Ziel der langen Reise, an. Bald stieß man auf 60 Irokesenkrieger, die unter Führung Atondatochans sich auf dem Kriegspfade gegen die Schwarzfußindiander befanden. In der zeremoniösen Weise der Indianer wurde Gruß und Gegengruß ausgetauscht. Mitten unter den kriegerischen Gestalten stehend, hielt P. Chaumonot, der die mit dem Huronischen verwandten Irokesensprache sich mit Leichtigkeit angeeignet hatte, eine Rede, pries den Häuptling, dessen Ruhm bis ins Land der Franzosen gedrungen sei (Atondatochan war mit einer Gesandtschaft in Montreal gewesen), und erklärte den Zweck seiner Sendung. Sie bedeute Frieden. Irokesen, Huronen, Franzosen sollten fürder Brüder sein und nur eine Sprache, Sonne und Seele haben. Ein Wampon von 1500 Porzellanperlen begleitete die mit lautem Beifall aufgenommene Rede.
Der Kriegszug war ein Racheakt wegen eines erschlagenen Stammesgenossen und deshalb nicht zu verhindern, so gern es P. Chaumonot getan hätte. Doch erreichte er eine Schonungszusage zugunsten zweier bei den Schwarzfüßen wohnenden Franzosen.
Als Antwort auf P. Chaumonots Ansprache begann der Häuptling mit seinen Kriegern eine Art Choral zu singen, in welchem dem Schwarzrock gedankt, ihm Glück zur Fahrt gewünscht, seine Friedensbemühungen gepriesen und die Franzosen eingeladen wurden, zu kommen und von dem fischreichen Otihatange Besitz zu nehmen. Und hier rief der Häuptling singend alle Fische, Salme, Barsche usw. bis zu den kleinesten, mit ihrem Namen auf und lud sie ein, in die Netze der Franzosen zu gehen; ein solches Ende sei ihre größte Ehre. Die letzte Strophe erklärte, sie, die Irokesen, wollten ihre Herzen weit aufmachen, damit die Schwarzröcke darin lesen könnten, und sie würden dort bei allen Freude über ihre Ankunft finden. Ein Wampun von 2000 Korallen besiegelte die gemachten Erklärungen.
P. Chaumonot dankte. Die Worte Atondatochans, die hier am Ontario geklungen, würden ein Echo finden an allen anderen Seen und wie Donner selbst im fernen Lande der Franzosen widerhallen - ein Lob, das dem stolzen Sachem (Häuptling) nicht wenig schmeichelte.
Rührend gestaltete sich das Zusammentreffen mit einer christlichen, in Gefangenschaft geratenen Huronin. Sie war auf die Kunde von der Ankunft der Patres von weitem hergeeilt, um wieder einmal einen Schwarzrock zu sehen, und zeigte sich überglücklich. Auf dem Arme trug sie ihr kleines Kind. Auf die Frage, ob es getauft sei und wie, erwiderte die Huronin, sie selbst habe es getauft mit den Worten: “O Jesus, hab Erbarmen mit meinem Kinde! Ich taufe dich, mein Kind, damit du dereinst glücklich werdest im Himmel.” Der Pater unterwies sie nun in der richtigen Spendung der Taufe, hörte ihre Beicht und tröstete sie ihn ihrem Leide, denn zwei ihrer Kinder waren ihr von den Irokesen grausam ermordet worden.
Endlich nach 85tägiger sehr beschwerlicher Reise war Onondage, der Hauptort der Onondagas, erreicht. Eine Viertelstunde vor dem Dorfe standen die Ältesten zum Empfange bereit und reichten den Schwarzröcken auf der Glut geröstete Kürbisse, den größten Leckerbissen der Irokesenküche. Während sie aßen, hielt einer der Alten eine lange Begrüßungsrede. P. Chaumonot erwiderte gewandt wie immer: des Sachems (Häuptlings) Worte seien wie ein kühlender Trank, der alle Mühen der langen Reise hinweggenommen habe. Alle lauschten mit gespannter Aufmerksamkeit und sichtlich erfreut, dass ein Franzose ihre Sprache so vollkommen beherrsche. Nun ging es in festlichem Aufzug durch die Spalier bildende Menge. Alle wollten die Schwarzröcke sehen und boten ihnen Früchte dar. Die Straßen im Dorf waren hübsch reingefegt, die Dächer der Hütten voll von Kindern.
Man führte die Gäste in eine eigens für sie bereitete Hütte, damit sie sich erst etwas ausruhen. Dann wurden sie zum Festschmaus geladen, der hauptsächlich aus saftigem Bärenbraten bestand. Da es Freitag war, entschuldigten sich die Missionare, und sogleich wurde ihnen Biberfleisch und Fisch gereicht. Abends fand in der Gasthütte große Versammlung statt. In wohlgesetzter Rede hieß einer im Namen des ganzen Volkes die Gesandtschaft willkommen und überreichte 1000 Porzellanperlen zum Geschenke: 500, damit sie ihre Tränen über die vielen Getöteten trockneten, 500, damit sie ihre Stimme, die der Schmerz dumpf und heiser mache, wieder auffrischten.
P. Chaumonot dankte, erwiderte das Geschenk mit 2000 Perlen und sagte: Der Onnontio (Statthalter) und der Achiendase (Missionsobere) hielten jetzt ihre Augen nach Onondage gerichtet. Sie (die Onondagas) möchten die Türe der Hütte weit aufmachen, auf dass die in Quebec sähen, welch guten Empfang man ihren Abgesandten bereitet, die hübschen Matten wahrnähmen, auf denen sie säßen, und die freundlichen Gesichter erblickten, die sie umgäben. Die Schmeichelei zauberte auch jetzt wieder ein Lächeln der Befriedigung auf die scharfgeschnittenen Indianergesichter. Der folgende Tag ging ganz in Festlichkeiten zu Ehren der Gäste auf. P. Chaumonot und seine Begleiter machten dazwischen ihren ersten Rundgang zu den Kranken des Dorfes.Am 7. November hielten die 15 Häuptlinge eine geheime Versammlung ab, deren Ergebnis P. Chaumonot mitgeteilt wurde. Man hoffe, dass es dem Oberhäuptling Agochiendagete und Onnontio gelingen werde, das Band des Friedens zwischen den fünf Irokesennationen fest zu knüpfen. Doch sollten die Franzosen für die Ausschreitungen einzelner nicht alle übrigen verantwortlich machen. Sie ihrerseits wünschten aufrichtig, sich die Freundschaft Onnontios zu gewinnen, und da sie erfahren hätten, dass ein Kapellenbauch in Onondage ihm besonders genehm wäre, wollten sie denselben tunlichst bald fördern. Man sah, ein Bündnis mit den Franzosen lag den Onondagos sehr am Herzen.
Am Abend setzten sich die Indianer mit dem Schwarzrock um das knisternde Feuer. Er mußte ihnen aus Frankreich erzählen und tat es, indem er ihnen sagte, auch dieses schöne Land sei einst wie das Land der Irokesen heidnische gewesen, bis Gottes Sohn gekommen und seine Boten ihm zugesandt habe, wie er solche jetzt zu den Onondagos schicke. Er suchte dann den Wilden das Geheimnis der Menschwerdung nahe zu bringen und benutzte die günstige Gelegenheit, um die von den Holländerns und huronischen Apostaten in Umlauf gesetzten Verleumdungen zu widerlegen. Anderhalb Stunden lauschten die Indianer seinen Worten, dann luden sie ihn zum Festschmaus ein. Was ein Festschmaus bei den Wilden besagte, ersehen wir aus der gelegentlichen Notiz der Missionare, wonach bei einem solchen Fischessen in 25 Kesseln 50 Riesenfische und 26 von der Größe unserer Salme sotten und bei einer andern Gelegenheit in 30 Kesseln gleichzeitig 20 Hirsche und vier Bären schmorten.
Tags darauf setzte P. Chaumonot mit seiner Beredsamkeit es durch, dass auch die Algonkins in das Bündnis mit eingeschlossen wurden und das Kriegsbeil gegen die Nez percés begraben wurde. Abends erzählte der Schwarzrock den 30 alten Kriegern, die sich um sein Feuer gelagert, die Bekehrungsgeschichte des hl. Paulus, natürlich in den Farben der indianischen Umwelt. Das gefiel ihnen sehr. Er mußte ihnen dann noch einiges über den Anfang der Welt sagen, was ihm Gelegenheit gab, den einfach großen Bericht der Bibel ihren eigenen lächerlichen Sagen gegenüberzustellen.
Die günstige Stimmung der Indianer ließ das beste hoffen. Wie weit jedoch diese wilden Herzen noch vom Geiste des Christentum entfernt waren, zeigte einer der folgenden Tage. Den Onondagas war ein 9-10 jähriger Knabe aus dem Stamme der Katzenindianer in die Hände gefallen, mit denen sie im Kriege lagen. Er sollte gemartert werden und sterben. Jede Einsprache war vergeblich. Wenigstens wollte der Pater die Seele retten. Aber auch hier war kluge Vorsicht vonnöten, denn der Hass der Wilden gegen ihre Stammesfeinde ist so groß, dass sie dieselben auch im künftigen Leben nicht glücklich sehen wollen. P. Chaumonot gelang es, heimlich mit dem Knaben zu sprechen und ihn auf die Taufe vorzubereiten. Dann schützte er Durst vor, tränkte mit dem zur Stelle gebrachten Wasser sein Taschentuch und taufte den Knaben, ohne dass die Wilden es merkten. Zwei Stunden lang hielt der Knabe die fruchtbaren Feuerqualen aus, ohne eine Träne zu vergießen und irgend ein Zeichen des Schmerzes zu geben.
Eine große Stütze für die Missionare waren die Irokesenfrauen, die in Quebec gewesen und dort und auf der Rückfahrt bereits im Christentum unterrichtet worden waren. An ihrer Spitze stand eine Häuptlingsfrau namen Teotanharason. Sie bot den Missionaren gleich ihre Hütte an, in welcher bis zur Fertigstellung der Kapelle ein Altar errichtet und am 14. November, einem Sonntage, zum erstenmal in Onondaga das heilige Opfer gefeiert wurde.
Tags darauf, am 15. November, sollte P. Chaumonot in feierlicher Versammlung als Gesandter auftreten und im Namen des französischen Statthalters durch Überreichung der Wampuns und Gegengeschenke den in Quebec geschlossenen Bund und Friedensschluß feierlich besiegeln. Man hatte damit gewartet, da Tag um Tag noch neue Abordnungen von anderen Irokesendörfern eintrafen.Die Versammlung fand auf einem weiten freien Platz statt, auf dem die Häuptlinge, die alten und jungen Krieger und ringsum das Volk in malerischen Gruppen sich aufstellten. Mit einem Gebete zum wahren Gott, das die Patres kniend verrichteten und das die Versammlung mit ehrfurchtsvollem Schweigen anhörte, wurde der feierliche Akt eröffnet.
P. Chaumonot begann mit der Erklärung, sein Mund sei der Mund Onnontios und seine Worte die Worte der Franzosen, Huronen und Algonkins, die durch ihn sprächen. Darauf begann er, der Reihe nach die 24 Wampuns und Geschenke zu deuten. Nachdem der Redner seine Zuhörer vorbereitet und gewonnen hatte, zeigte er ihnen ein Halsband aus Porzellanperlen, schöner und köstlicher als alle anderen. Was er bisher vorgeführt, so erklärte er, seien nur kleine Linderungsmittel für ihre Schmerzen, hier aber bringe er ein wirklich kostbares Geschenk, das alle ihre Übel heilen werde. Das sei der wahre Glaube, den zu verkünden er so seit hergekommen. Und nun begann der Pater nach italienischer Predigerart auf und ab zu gehen und hielt eine feurige Ansprache über den christlichen Glauben, der sichtlich großen Eindruck machte. In packender Form wies der Redner die gegen den christlichen Glauben umgehenden Verleumdungen zurück. Er zeigte dem Volk einen weißen Bogen Papier, das den reinen, unversehrten Glauben bedeute, und hielt dann ein anderes, mit Kohle geschwärztes Blatt hoch, als Sinnbild der Lügen und Verleumdungen, mit denen die katholische Glaubenslehre besudelt werde. Mit wuchtiger Kraft wurden sie der Reihe nach widerlegt und das Schmutzblatt Stück für Stück zerrissen und verbrannt. Eine wirksame Zusammenfassung und ernste Mahnung, ihre Ohren nicht wieder böswilligen Verleumdungen zu öffnen, schloß die zündende Rede.
“Es ist kaum zu glauben”, fügte P. Dablon dem Berichte bei, “wie die Beredsamkeit des P. Chaumonot und seine anmutige Art, mit diesen Wilden zu verkehren, die Leute hinreißt. Und wenn er bis zum Abend fortgefahren hätte, so sagte einer, unsere Ohren wären nicht voll geworden und unsere Herzen nach mehr Worten aus seinem Munde hungrig geblieben. Andere bemerkten: die Holländer hätten weder Geist noch Sprache; nie hätten sie von denselben etwas von Paradies und Hölle gehört. Die Holländer wären es gewesen, die sie zuerst auf schlimme Wege geführt. Anderen drückten ihre Gedanken in anderer Weise aus; alle aber sprachen einstimmig es aus: ‘Nie hat ein Mensch so zu uns geredet.’”
Tags darauf wurde dem Pater von den Häuptlingen von Onondage und den anderen Dörfern die Antwort mit den Gegengeschenken überbracht. Die Antwort wurde gesungen, und jede der sechs Strophen brachte in Ton und Weise die wechselnden Stimmungen treffend zum Ausdruck. Ein Alter übernahm die Rolle des abwesenden Oberhäuptlings Agochiendagete und stimmte den Choral an, worauf die übrigen taktfest einfielen und die Worte wiederholten. Nur eine kurze Probe.
| Häuptling: | O du schönes Land, du schönes Land, das die Franzosen besetzen sollen. |
| Die anderen: | O du schönes ... |
| Häuptling: | Häuptling: Gute Botschaft, gute Botschaft. |
| Die anderen: | Die anderen: Gute Botschaft (hat er gebracht). |
| Häuptling: | In Wahrheit meine Brüder. |
| Die anderen: |
Die anderen: In Wahrheit meine Brüder. |
| Häuptling: |
Mein Bruder, ich grüße dich; mein Bruder, sei willkommen. |
Bei der nächsten Strophe begannen die Sänger mit Händen, Füßen und ihren Pfeifen gegen die Matten zu schlagen. Alles im schönsten Takt.
| Häuptling: |
Mein Bruder, ich grüße dich, |
| Die anderen: | Ich nehme den ... |
| Häuptling: |
Heute ward der große Friede geschlossen. |
Dem Gesang folgte die Überreichung der Geschenke mit den üblichen Begleitworten. Das erste galt Onnontio, mit dem er (der Häuptling) ein Herz und eine Seele sei; das zweite den Huronen und Algonkins, die ihre Brüder sein müßten, weil sie die Kinder Onnontios seien; das dritte und schönste, ein Halsband aus 7000 Perlen, bedeutete den Glauben. “Es ist”, sagte der Häuptling, “das Geschenk des Glaubens. Es soll dir sagen, dass ich in Wahrheit ein Gläubiger bin; es soll dich antreiben, nicht zu ermüden in unserem Unterricht. Fahre fort, von Hütte zu Hütte zu gehen, und habe Geduld, wenn du siehst, wie kurz unser Verstand ist, um den Glauben zu lernen. Präge ihn ein, tief ein in unsere Köpfe und unsere Herzen.” An dieser Stelle nahm der alte Häuptling, um seinen Worten durch eine äußere sinnbildliche Handlung Nachdruck zu geben, den Pater bei der Hand, führte ihn in die Mitte der Versammlung, warf sich an seinen Hals, preßte ihn ans Herz und legte ihm die kostbare Perlenschnur als Gürtel um, indem er vor Himmel und Erde erklärte, dass er den Glauben so umfassen wolle, wie er jetzt den Schwarzrock umfasse. Alle Zuschauer sollten Zeugen sein, dass dieser Gürtel, der den Pater so eng umschließe, als Sinnbild der engen Verbindung gelten solle, die fürder zwischen ihm und den Irokesen bestehen werde.
“Es war eine Szene”, fügt P. Dablon hinzu, “die auch dem Härtesten Tränen entlocken konnte, zu sehen, wie der Häuptling eines heidnischen Stammes öffentlich den Glauben bekannte unter dem lauten Beifall des Volkes. Ich bitte alle, die dies lesen, ihre Herzen zu Gott zu erheben im Gebet für diese armen Barbaren.”
6. Ein Jahr im Irokesendorf
Die Aufnahme in Onondage ließ das beste hoffen; indessen wußte Chaumonot aus langer Erfahrung, wie schwer es sei, auf diese Wildlinge des Urwaldes das edle Reis des Christentums zu pfropfen. “In diesen Missionen”, so hatte er den Missionsoberen früher geschrieben, “gedeiht die Aussaat erst, nachdem sie durch den Schweiß derer, die dort arbeiten, und das Blut derer, die dort sterben, vorher reichlich befruchtet worden ist.” Das zeigte sich auch jetzt wieder in Onondage. Anfangs ging alles gut. “Kaum hatten wir in der Hütte unserer Gastwirtin eine Notkapelle eingerichtet, als die Leute sich dort zum Gebet und Unterricht zu versammeln begannen. Da der Raum zu klein war, wählten wir für die Christenlehre an Sonn- und Festtagen bald diese bald jene Hütte. So hofften wir zugleich die Wilden zu gewinnen, indem sie sich dadurch geehrt fühlten, dass die ‘heilige Versammlung’ - so nannten sie diese Zusammenkünfte - in ihrer Wohnung stattfand.“Um sie noch mehr anzuziehen, lehrten wir die kleinen Mädchen, welche die schönsten Stimmen hatten, geistliche Lieder singen. P. Dablon, der sehr gut verschiedene Musikinstrumente spielte und solche mitgebracht hatte, wiederholte jedesmal, wenn die Knider eine Strophe gesungen hatten, dieselbe auf seiner kleinen Geige. Die Wilden waren außer sich vor Erstaunen. ‘Seht da, ein Holz’, riefen sie, ‘das spricht und den Geist hat, genau wieder zu sagen, was unsere Kinder ihm vorgesagt haben.’ Wie anderswo, so waren auch hier die Frauen und Kinder die eifrigsten Kirchgänger. Der arme Squaw, die bei diesen Völkern nach dem Ausdruck Champlains nur ‘der Packesel des Mannes’ war, fühlte unwillkürlich, dass die neue Religion ihr eine wirklich frohe Botschaft zu bringen hatte. Teotonharason und die andern Frauen, die mit in Quebec gewesen waren, bildeten die erste eifrige Katechumenengruppe, um die sich rasch andere Frauen und Kinder sammelten. Bald schon brachten die Mütter ihre Kinder zur Taufe. Acuh die über 100 Jahre alte Großmutter Teotonharasons empfing das Sakrament der Wiedergeburt. ‘Verlaß mich nicht’, so betete sie, als ihr das Bild des Herrn gezeigt wurde, ‘gib mir dein Paradies nach meinem Tode; lass uns nicht mehr getrennt werden.’ Andere alte Leute folgten. Auf den Rundgängen durch die Hütten fanden die Patres ganz auserwählte Seelen. Ein krankes Mädchen von 20 Jahren, das auf dem Totenbette getauft wurde, starb so schön und erbaulich, ‘als wäre sie zeitlebens eine Christin gewesen’.”
Anders freilich war es im ganzen mit der Männerwelt. Auch sie kam wohl zu den Predigten und Christenlehren, die Chaumonots frische, anschauliche Art so anziehend machte. Die Glaubenslehre gefiel ihnen, aber die christliche Sittenlehre anzunehmen, ihren Aberglauben aufzugeben, ihr wildes, trotziges, rachsüchtiges Herz zu bändigen, das alles stand auf einem andern Blatt.
Eine geradezu verhängnisvolle Rolle spielte bei den Indianern ihr Traumwesen. Jeder Traum, mochte er noch so wunderlich sein, war ihnen eine Art Offenbarung, eine Einsprechung ihres Geistes und mußte um jeden Preis verwirklicht werden.
Ein junger Mensch träumte z. B., er sei in Asche vergraben worden. Gleich beim Erwachen lud er zehn Freunde zu seinem Schmaus ein und teilte ihnen den Traum mit. Sofort gaben sie sich daran, den Traum wahr zu machen, indem sie den Jüngling bis an den Mund und die Ohren in Asche vergruben, während die andern staunend und verwundert zusahen.
Einem andern hatte geträumt, er habe ein Festmahl mit Menschenfleisch gegeben. Er berief die Häuptlinge in seine Hütte unter dem Vorwand, er müsse ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Er habe einen Traum gehabt, den man ihm nicht erfüllen könne, dessen Nichterfüllung aber Verderben über den ganzen Stamm bringen werde. Auf die Frage, was es denn sei, ließ er sie raten. Keiner kam darauf. Endlich traf es einer: “Du willst einen Menschen zum Mahle haben. Gut, nimm hier meinen Bruder, zerstückle ihn und wirf ihn in den Kessel.” Alle waren erschrocken. Der Träumer aber erklärte, nein, sein Traum fordere, dass es ein Weib sei. Wirklich wurde nun ein Mädchen ausgesucht, mit Armspangen, Halsbändern und anderem Zierat geschmückt und dem Indianer zugeführt. Alles eilte herbei, um das Schauspiel zu sehen. Das Opfer wurde in die Mitte gestellt. Alles erwartete den Todesstreich, als der Indianer unerwartet ausrief: “Es ist genug; mein Traum ist erfüllt, mehr ist nicht erfordert.”
Aber nicht immer ging es so glimpflich ab, und die größten Tollheiten und Gewalttaten wurden entschuldigt, wenn sie durch einen vorgeblichen Traum gedeckt wurden. Es kamen Tage, wo ein großer Teil des Dorfes wie verrückt schien und die Leute halbnackt herumliefen und alles schlugen und zerschlugen, was ihnen in den Weg kam. Da P. Chaumonot öfter der Gegenstand solcher Träume wurde, so hatte er unter diesem Wahnsinn wiederholt schwer zu leiden. Mordtaten, zuman an Kriegsgefangenen, waren so gewöhnlich, dass die auf der Straße spielenden Kinder sich dadurch in ihrem fröhlichen Treiben gar nicht mehr stören ließen.
Ein großes Hindernis für die Bekehrung, zumal der jüngeren Männer, war die durch das Christentum geforderte Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe. Sobald die Männer der einen Frau müde waren, nahmen sie meistens eine andere oder eine zweite. Seit die Schwarzröcke da waren, hieß es auf einmal, das dürfe nicht sein. Und nun kam es vor, dass christlich gewordene Mädchen solche Bewerbungen entschieden zurückwiesen, mochte der Freier auch ein noch so angesehener Krieger sein. Das war etwas Unerhörtes im Irokesenland und machte die leidenschaftlichen Menschen zu heftigen Gegnern der neuen Religion, die ihrer zügellosen Freiheit so fühlbare Schranken setzte. Dazu kam der immer wieder von allen Gegnern des Christentums ins Feld geführte Hinweis auf das Schicksal der Huronen. Ihr Niedergang und ihre Vernichtung habe mit ihrer Annahme des christlichen Glaubens begonnen. Die Irokesen würden wie sie ihren kriegerischen Geist und damit ihre Überlegenheit verlieren; ihr Blut würde sich in Wasser verwandeln.
Als Teotonharason sich zur Annahme des Christentums bereit erklärte, prophezeiten ihr die heidnischen Verwandten gleich allerlei Unglück. Tatsächlich traf alles ein. Sie selbst erkrankte, ihre Mutter brach ein Bein, ihr Lieblingssöhnchen, ein prächtiger Knabe, wurde von einem sonderbaren Siechtum erfaßt und magerte zu einem Skelett ab. Alles das machte indessen die tapfere Frau nicht irre. Am 23. Januar 1656 empfing sie die Taufe. Nun griff Gott ein. Das heilige Sarkament gab ihr mit der übernatürlichen Gnade fas plötzlich die Gesundheit wieder. Auch der Knabe genas gegen alles Erwarten. Eine Reihe ähnlicher, fast wunderbarer Gebetserhörungen warb kräftig für die christliche Wahrheit. Im ganzen aber trug die harte Pionierarbeit der beiden Missionäre zunächst nur kärgliche Frucht, und auch diese mußte mit geradezu heroischen Opfern erkauft werden.Im Frühjahr sollte der Kriegszug gegen die Schwarzfuß- und Katzenindianer beginnen. Seit Monaten brodelten schon die Kriegskessel auf dem Feuer. Um sie herum saßen die Krieger, schmausend, singend, tanzend und prahlend, und übten sich in dem, was dem Indianer als Höchstes galt: im lautlosen Ertragen des Schmerzes. Zu diesem Zwecke schlugen, brannten, quälten sie sich gegenseitig in jeder Weise, genau so, als ob jeder am Marterpfahl stände. Keine Muskel durfte dabei verzogen werden, um als Tapferer zu gelten.
Fast ständig kamen Abgeordnete aus anderen Dörfern zu den Kriegsberatungen. Unter ihnen befanden sich auch manche christliche adoptierte Huronen. Sie waren in der Gefangenschaft dem christlichen Glauben treu geblieben und hatten sich einen Kalender in ihrer Art zurecht gemacht, um ja den Sonntag nicht zu verfehlen.Das war ein süßer Trost für die Missionare.
Am 29. Februar fand eine große Versammlung der fünf Stämme statt, bei der über das Bündnis mit den Franzosen beraten wurde. Wie gewöhnlich wurde auch Chaumonot beigezogen. Er schreibt es einem besonderen Beistand Gottes zu, dass er bei diesen Versammlungen, wo die verschiedenen Stämme in ihrer Mundart sprachen, sie alle verstehen konnte, “obgleich ich bis dahin bloß das Onondaga studiert hatte” (Autobiographie, hg. von P. Aug. Carayon SJ, Poitiers 1869). Die Wilden waren sehr unzufrieden, dass die Franzosen ihr Versprechen, in ihrem Lande sich niederzulassen, bisher nicht gehalten hatten, und drohten, die angeknüpfte Verbindung wieder zu lösen.
Weiterhin hatte sich das Gerücht verbreitet, einige Onondagasjäger seien in Montreal festgenommen und mißhandelt worden. Die Alten stellten P. Chaumonot zur Rede und warfen ihm vor, er wolle sie und ihr Volk verraten. Entschieden wies der Pater die Anschuldigung zurück. Kein Schwarzrock sei einer solchen Handlungsweise fähig. Sie sollten sich gedulden und erst sichere Kunde über das Geschehene abwarten. Aber die argwöhnische, heftige Naturder Indianer war erregt. Wilde Drohungen fielen. Sie vermochten den mutigen Schwarzrock nicht zu schrecken. “Mit Gottes Gnade hatte ich keine Furcht.” Schließlich machte er den Häuptlingen einen Vorschlag: Schickt einen von uns beiden nach Montreal als Abgesandten zu Onnontio und behaltet den anderen als Geisel bei euch. Der Vorschlag wurde angenommen, und von zwei jungen Indianern aus den ersten Familien des Dorfes begleitet, brach P. Dablon im Frühjahr (2. März 1656) nach Quebec auf.
7. Das Ende der ersten Irokesenmission
Der Bericht P. Dablons, der wahrheitsgetreu die Lage der Dinge im Irokesenland schilderte und Hoffnungen und Befürchtungen nebeneinander stellte, wurde in Quebec der Gegenstand eingehender Beratung. Sollte man der Einladung der Wilden folgen und eine französische Kolonie mitten unter den bisherigen Todfeinden der Franzosen und ihrer Bundesgenossen wagen?Die bisherigen Erfahrungen mit diesen wildesten Stämmen Neu-Frankreichs mahnten zur Vorsicht. Die Behauptung eines aus Onondage nach Quebec geflüchteten Huronen, die fünf Stämme hegten mit ihren Friedensversicherungen nur die Absicht, die Franzosen in ihr Land zu locken, um sie dort bei der ersten günstigen Gelegenheit niederzumachen, klang nicht unwahrscheinlich. Allein der Statthalter und die Missionare waren entschieden für das Wagnis. Man habe den Irokesen nun einmal Zusagen gemacht. Täusche man ihre Erwartungen, so sei Gefahr, dass auch die aufrichtig dem Frieden geneigten Stämme und Häuptlinge zur Kriegspartei übergingen und die offenen Feindseligkeiten von neuem begännen. Ohne Opfer und Blut, betonten die Patres, sie das Christentum bei diesen Stämmen nicht einzupflanzen. Das Blut der Bekenner werde auch bei den Irokesen sich als Samen der Christen erweisen.
So wurde die Expedition beschlossen und ohne Verzug vorbereitet. 50 Franzosen utner Führung Dupuis’, des tapferen Kommandanten des Forts von Quebec, wollten das Wagnis unternehmen. Ihnen schlossen sich der Missionsobere P. Franz Le Mercier, die Patres René Menard, Claude Dablon, Jacques Fremin und die Brüder Ambros Broat und Joseph Boursier an. Am 17. Mai 1656 fuhr die aus zwei großen Schaluppen und zahlreichen Rindenkanoes bestehende Flotte von Quebec ab.
Am 15. Juli 1656 lief sie in den See von Gannentaa (heute Onondaga-Lake, an dessen Südende die Stadt Syracuse liegt) ein, und die waldigen Ufer hörten zum erstenmal den Donner der fünf kleinen Kanonen, welche die Franzosen mitgebracht hatten, und deren lautes Echo die Indianer von nah und fern herbeirief.
Gannentaa war der von den Onondagas angebotene und von P. Chaumonot gutgeheißene Ort für die zu gründende Kolonie, ein prächtiges Fleckchen Erde im Herzen des Irokesenlandes mit reichem Waldbestand, fruchtbarem Boden, wertvollen Salzquellen und gutem Wasser, wenige Stunden von Onondaga gelegen. Durch den Owego-, Seneca- und Oneidafluß stand der Ort in Verbindung mit dem übrigen Land und dem Ontariosee.
Die Franzosen von damals waren, wie heute noch die Kanadier, fromme Leute. Tags nach ihrer Ankunft wurde nach einem freudigen Te Deum vom Lande Besitz ergriffen und die Niederlassung “U. L. Frau von Gannentaa” getauft.
Am ersten Sonntag darauf sah das Irokesenland das erste feierliche Hochamt. Sämtliche Franzosen gingen zur Beicht und Kommunion, in Erfüllung eines Gelübdes, das sie in schwerer Stunde auf der Fahrt gemacht hatten. Sofort wurde nun mit dem Bau eines starken, festungsartigen Blockhauses begonnen, das von einer Höhe aus die ganze Gegend beherrschte, und dessen Wälle mit den fünf kleinen Kanonen bestückt waren.
Die Aufnahme der Kolonisten von seiten der Häuptlinge und der ganzen Bevölkerung schien eine sehr herzliche, und als die Franzosen einige Tage später in schmuckem kriegerischen Aufzug mit Trommelwirbel und Salutschüssen durch die Straßen von Onondage zogen, kannte der Jubel kein Ende.
Am 24. Juli sollte in einer großen Versammlung der fünf Stämme die Verbrüderung der Irokesen und Franzosen durch Austausch der Wampuns und Geschenke feierlich besiegelt werden. Es war ein großer Tag für P. Chaumonot. Er lag am Fieber krank danieder, nahm aber seine Zuflucht zum hl. Petrus und trat dann in voller Kraft und Frische vor die Versammlung.
Die Christen, so erklärte er zunächst, begännen keine Verhandlung von Wichtigkeit, ohne erst den großen Geist um seinen Segen zu bitten. Damit warfen sich die Patres und alle anwesenden Franzosen auf die Knie, entblößten ihr Haupt und sangen mit gefalteten Händen andächtig das Veni Creator Spiritus, was auf die Versammlung tiefen Eindruck machte.
Nun begann Chaumonot nach der Sitte die Geschenke der Franzosen zu erklären. Es waren Wampuns und Gaben willkommenster Art: Hakenbüchsen, Pulver und Blei, Mäntel, Äxte, Kessel und ähnliches, die man in hübscher, einladender Weise ausgelegt hatte. Seine ersten Worte galten dem Andenken der Onondagashäuptlinge, deren Ermordung vor kurzem beinhae wieder zum Kriege zwischen den Onondagas und Mohawks (den Mördern) geführt hätte. Die Geschenke sollten die Bitterkeit der Herzen versüßen. Nachdem er in der packenden, bilderreichen Sprache der Wilden geschickt die Stimmung vorbereitet hatte, änderte er auf einmal den Ton, schlug eine herbe Note an und sprach nun mit der ganzen wuchtigen Kraft eines Apostels. Er wußte sehr wohl, dass es zum guten Teil recht selbstsüchtige Gründe waren, welche die Irokesen zum Einlenken in friedliche Bahnen veranlaßt hatten. Sie hatten sich fas allen anderen Stämme zu Feinden gemacht und fürchteten erdrückt zu werden. Der Anschluss an die Franzosen sollte ihre Macht stärken. Es galt nun vor allem, ihnen klar zu machen, dass die Mission keine politischen Ziele verfolge.
“Es ist nicht der Handel, der uns in euer Land geführt hat. Unsere Absichten gehen höher. Eure Pelzwaren sind gar zu gering, um ihretwegen eine so weite, beschwerliche und gefahrvolle Fahrt zu unternehmen. Sparet eure Biberfelle, wenn ihr sie gut genug findet, für die Holländer auf. Was uns davno zu Handen kommt, werden wir alles zu eurem eigenen Vorteil verwenden. Wir suchen keine vergänglichen Güter. Nein, um euch den Glauben zu bringen, dafür haben wir unser Land, unsere Eltern und Verwandten darangegeben; um des Glaubens willen haben wir den Ozean durchquert; um des Glaubens willen verließen wir die großen Schiffe der Franzosen, um in eure kleinen Birkenkähne zu steigen; um des Glaubens willen zogen wir aus unseren schönen Wohnungen, um in eure Rindenhütten zu treten; um des Glaubens willen haben wir auf die uns bekömmlichen Speisen und die köstlichen Gerichte in Frankreich verzichtet, um statt dessen euer Sagamit und eure rohen Fleischstücke zu essen, die in unserer Heimat kaum von den Tieren berührt würden.”Nun hielt er den Wilden ein schönes, kunstvoll gearbeitetes Halsband vor und fuhr weiter: “Um des Glaubens willen halte ich dieses reiche Geschenk in meinen Händen und öffne meinen Mund, um euch zu ermahnen, das Wort einzulösen, das ihr uns gabet, als ihr nach Quebec kamet, um uns in euer Land einzuladen. Ihr habt feierlich gelobt, den Worten des großen Gottes zu gehorchen. Gut, seine Worte sind in meinem Munde, höret sie, ich bin sein Werkzeug. Er sendet euch seine Diener, damit sie euch sagen, dass sein Sohn Mensch geworden sei aus Liebe zu euch, dass er als Gottessohn der König und Herrscher der Menschen ist, dass er im Himmel ewige Freuden und Wonnen allen denen bereitet, die seine Gebote erfüllen, und in der Hölle ein schreckliches Feuer für die angezündet, die seinen Worten kein Gehör schenken.
Sein Gesetz ist milde; er verbietet, sich zu vergreifen an den Gütern, am Leben, am Weibe und am guten Ruf des Nächsten. Gibt es ein vernünftigeres Verbot? Er gebietet, Ehrfurcht, Liebe, Unterwürfigkeit dem zu erweisen, der alles gemacht hat und erhält. Nimmt euer Verstand etwa Anstoß an einem so selbstverständlichen Gebot?
Jesus Christus, der Sohn dessen, der alles gemacht hat, ist unser Bruder geworden und auch der eurige, indem er sich mit Fleisch bekleidet hat; er brachte uns die Wahrheit, er ließ sie malen und schreiben in ein Buch und befahl, es in alle Welt zu tragen. Seht ihr nun den Grund und Zweck, der uns in euer Land geführt hat und uns zu euch sprechen läßt?
Und wir sind dieser Wahrheit so sicher, dass wir bereit sind, für sie zu sterben. Wenn du sie zurückweisest, wer immer du seiest, ob Onnontagheronnon oder Sonnontoueronnon, ob Annieronnon, Oïogaenaonnon oder Onneïutschronnon, so wisse, dass Jesus Christus, der durch meine Stimme und aus meinem Herzen spricht, dich einst hinabstürzen wird in die Hölle. Komm diesem Unglück zuvor, indem du dich bekehrest, führe nicht dein eigenes Verderben herbei und gehorche der Stimme des Allmächtigen."
Die wuchtige Predigt, mit glühendem Eifer gesprochen, schlug wie ein Donner in die Versammlung. Der erste Eindruck war Schrecken und Bestürzung. Dann aber brach der Beifall los, und die Wilden wußten, sich herbeidrängend, gar nicht, wie sie dem Pater ihre Liebe und Verehrung ausdrücken sollten.
Den Franzosen, die Zeugen des ganzen Vorganges waren, standen die Tränen in den Augen, als sie sahen, “wie machtvoll unser Herr und Heiland in diesem entlegenen Winkel der Erde gepredigt wurde”. “Was mich angeht”, bemerkt der Berichterstatter P. Le Mercier, “so muß ich bekennen, dass das, was ich in dieser Versammlung hörte und sah, alles übertrifft, was man sagen und schreiben kann. Wenn nach alldem der böse Feind diesen armen Völkern abermals das Hirn verwirrt und sie aufstachelt, uns zu töten, nun dann: Iustificabitur in sermonibus suis (Er wird gerecht erfunden werden in seinen Worten). Wir haben zum wenigsten unseren Gott gerechtfertigt in unseren Worten.”
Am nächsten Tag erschienen die Abgeordneten aller Stämme bei den Patres, um in den wärmsten Ausdrücken ihren Dank auszusprechen. Selbst den Mohawks schien es diesmal Ernst zu sein. Sie erklärten laut, sie könnten den Gründen nicht länger widerstehen und wollten Christen werden. Es galt jetzt, die günstige Stimmung auszunutzen.
Dank der Geschicklichkeit der Franzosen gewann Gannentoa rasch das Aussehen einer europäischen Niederlassung, der auch Kapelle und Priesterhaus nicht fehlten.
In Onondage wurde an Stelle der schlechten Rindenkapelle ein hübsches Kirchlein aufgebaut. Von morgens früh bis abends spät waren die Patres beschäftigt, teils in der Kapelle teils in den Hütten das Evangelium zu verkünden, Christenlehre zu halten, die Katechumenen auf die Taufe vorzubereiten. Allein die schlechte Wohnung und kümmerliche Nahrung und das heiße, von dem des Lorenzotales ganz verschiedene Klima machten sich schon bald in empfindlichster Weise geltend. Der Reihe nach wurden alle Patres krank und lagen hilflos und kraftlos in ihrer armen Hütte.Jetzt aber zeigten die Indianer sich von ihrer besseren Seite. Wetteifernd brachten sie den Kranken Fisch und Wildbret, Korn, Kürbisse, frische junge Maiskolben und was sie sonst hatten, und dank der besseren Nahrung erholten sich die Kranken und konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen. Auch die Männer wurden jetzt williger, und als bald darauf Achiendase (der Missionsobere) vom obersten Häuptling Sagochiendagete in Gegenwart der Abgeordneten anderer Irokesendörfer feierlich adoptiert wurde, schien die Mission von Onondage fest begründet, und man konnte daran denken, nun auch den dringenden Einladungen der Nachbarstämme zu entsprechen. P. Menard zog nach Oiogoen, dem Hauptort der Cayugas, Chaumonot noch weiter westlich zu den Senecas, dem zahlreichsten aller Irokesenstämme.
Gleich bei seiner Ankunft in ihrer Hauptfeste Gandagan berief er die Ältesten zu einer Versammlung und forderte sie zur Annahme des christlichen Glaubens auf. “Ich selbst biete mich zum Unterpfand an, dass das, was ich euch verkünde, die Wahrheit ist, und wenn euch dieses Pfand nicht genügt, wohlan, dann nehmt die Franzosen dazu, die uns nach Gannentaa gefolgt sind, um lebende Zeugen des Glaubens zu sein, den ich predige. Seid ihr denn so töricht, zu meinen, dass eine so ausgezeichnete Schar ihr Land, das schönste und angenehmste der Welt, verlassen und so große Mühsale auf sich genommen hätte, bloß um eine Lüge in so weite Ferne zu tragen?”
Die Senecas nickten Beifall und sagten: “Es ist gut, Schwarzrock, bleibe bei uns und lehre uns die Wahrheit.” Einer verlangte gleich mit seiner Frau unterrichtet und getauft zu werden. Wichtiger war noch die Bekehrung und Taufe des obersten Sachems der Senecas, des alten Annontenritaüi. Wie zum Lohne dafür heilte ihn Gott wunderbar von einem Krebsgeschwür am Schenkel, das die Zauberdoktoren als unheilbar erklärt hatten.
Mit allen Glaubensartikeln und Geboten, so erzählt Chaumonot, erklärten sich die Wilden einverstanden. Nur die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe wollte ihnen nicht einleuchten. Wenn man den Männern, so hielt ein Alter dem Missionar entgegen, nur eine Frau bewillige, würde das Land nicht bevölkert werden. Chaumonot widerlegte dies durch Hinweis auf sein Vaterland, das ungleich stärker bevölkert sei, obschon dort jeder Mann nur eine Frau besitze. Wenn die Indianer die Franzosen nachahmten, so würden ihre Ehen viel fruchtbarer sein, denn jetzt hätten ihre Frauen, weil in steter Furcht, verstoßen zu werden, gar keine Freude am Kindersegen, suchten denselben vielmehr zu verhindern. Wenn das Land immer mehr entvölkert werde, so seien daran die Männer schuld, weil sie in ihren Hütten statt rechtmäßiger Ehefrauen stets Kebsweiber und Sklavinnen hielten.
Diese Rede fand bei den Squaws der Indianer lauten Beifall. “Um ihre Dankbarkeit zu bezeigen, kamen sie beim nächsten Fest in ihren besten Schmuck gekleidet daher und führten zum Spiel zweier Musiker einen Tanz auf, wobei sie mein Lob sangen und mir dankten, dass ich so kräftig für sie Partei genommen hatte.”
Wie bei den übrigen Irokesenstämmen fand sich auch bei den Senecas eine kleine Gruppe versprengter Huronen. Sie wohnten abgesondert in einer eigenen, St. Michael getauften Ortschaft, wo sie nach ihren heimischen Gebräuchen und Sitten lebten, und waren überglücklich, wieder einen Schwarzrock bei sich zu haben. Gleich drängten sie sich herzu, um wieder einmal zu beichten, und brachten ihre Kinder zur Taufe. Selbst einige der Alten, die früher in ihrem Lande die Annahme des christlichen Glaubens verweigert hatten, waren jetzt willig wie die Kinder.
Nachdem so bei den Senecas und Cayugas wenigstens der Grund gelegt war, eilten Menard und Chaumonot auch zu den Oneidas, die östlich von den Onondagas wohnten, und fanden eine unerwartet günstige Aufnahme. Auch hier bildete ein Trupp versprengter Huronen den Kern der christlichen Gemeinde.
Selbst bei den Mohawks hatte inzwischen der kühne P. Le Moyne, freilich unter unglaublichen Gefahren und Mühsalen, einige Erfolge erzielt. So schien der langgehegte Wunsch einer christlichen Irokesenkirche der Verwirklichung entgegenzugehen.
Allein es sollte noch nicht sein. Erst etwa zehn Jahre später kam für diese rauhen Krieger die Stunde der Gnade. Zweifellos hatte ein großer Teil zumal der älteren Häuptlinge und des Volkes den Frieden und das Christentum aufrichtig gewünscht. Aber die noch immer starke Kriegspartei, und in erster Linie die wilde, trotzige Jungmannschaft, die keine Zügel duldete, war nur gezwungen oder aus politischen Gründen den Friedensverhandlungen beigetreten. Besonders die Mohawks hatten nie im Ernst daran gedacht, das Kriegsbeil zu begraben. Diesen Elementen gelang es, immer mehr die Oberhand zu gewinnen. Langsam, aber immer deutlicher trat der Umschwung zu Tage. Die plötzliche grausame Niedermetzelung der christlichen Huronen in Onondage im August 1657 war das erste drohende Warnungszeichen. Der heldenhafte Starkmut eines christlichen Huronenmädchens den Gelüsten eines Onondagahäuptlings gegenüber war die Veranlassung gewesen.
Abordnungen gingen von Stamm zu Stamm, geheime Ratsitzungen wurden gehalten. Es wurde immer klarer: ein Schlag gegen die französische Kolonie war geplant. In Voraussicht des kommenden Unwetters zog der Obere die Missionare nach dem festen Gannentaa zusammen.So schlich der Winter von 1657/58 in steter Ungewissheit dahin. Mit dem Lenz kam die Kunde, dass die Sachems bei einem Ratfeuer am Mohawkflusse den Krieg und die Ausrottung der Franzosen und Missionare beschlossen hätten. Ein Fluchtversuch schien unmöglich, da der einzige offene Flussweg nach dem Ontariosee mitten durch Feindesland führte und auch in den Uferwäldern des Lorenzo bis Quebec hinab feindliche Indianerbanden lauerten. Der tapfere Kommandant Dupuis und die Patres hielten Rat, und man beschloß, das scheinbar Unmögliche zu wagen.
In aller Stille wurden zwei eigens zur Überwindung der gefährlichen Flussschnellen konstruierte Flachboote gezimmert, die je 14 bis 15 Personen und 1500 Pfund Gepäck fassten. Außerdem hielt man neun Kanoes (vier Algonkins-, fünf Irokesenarbeit) heimlich verborgen. Alles kam nun darauf an, einen günstigen Augenblick zu finden, um die Fahrzeuge unbemerkt ins Wasser zu bringen. Eine List musste helfen. Man ließ an alle Krieger der Umgebung die Einladung zu einem großen Festmahl ergehen, bei dem es hoch hergehen solle und die Gäste alles bis auf die letzte Krume aufessen dürften. Dafür waren die Wilden stets zu haben.
Sie kamen denn auch in hellen Haufen und setzten sich an den reichbesetzten Tisch. Musik und Tanz und fröhliches Spiel erhöhten die gute Stimmung. So dauerte das Fest bis tief in die Nacht hinein. Die Wilden vergaßen über den ungewohnt reichen Genüssen alles andere.
Inzwischen hatten die Franzosen die Boote unbemerkt ans Ufer gebracht und warteten, bis endlich in später Stunde die übersatten Gäste heimzogen, um ihren Festrausch auszuschlafen.
Es war um Mitternacht (20. März 1658), als die Franzosen und Patres in aller Stille die Boote bestiegen und zu den Rudern griffen. Aber während sie ruderten, begann der See um sie herum zu gefrieren, “und wir fürchteten, nachdem wir dem Feuer der Irokesen entgangen waren, nun im Eis stecken zu bleiben”. Doch der Durchbruch gelang.
Ungleich größere Gefahren harrten der Flüchtlinge in dem engen Flussbett des Owegoflusses mit seinen reißenden Schnellen und Wasserfällen. Die schlimmste Stelle mußte umgangen und die Boote mit der ganzen Ladung in stockfinsterer Nacht vier Stunden weit durch den Urwald geschleppt werden. Unter aufregenden Abenteuern wurde in zehn Tagen der Ontariosee erreicht. Aber an der Stelle, wo er in den Lorenzo ausmündet, fand man Eis und mußte mit der Axt in der Hand sich erst einen Weg bahnen. Furchtbare Augenblicke brachte die Fahrt durch die Stromschnellen des Lorenzo. Die schäumenden Wasser rissen die leichten Boote pfeilschnell durch Strudel und Klippengewirr. Eine Kanoe zerschellte an einem Felsen; drei Franzosen ertranken, der vierte, der an den Trümmern sich festhielt, konnte weiter unten halb erstarrt wieder aufgefischt werden. Glücklich entging man schließlich auch noch den in den Wäldern lauernden Mohawksbanden und erreichte am 23. April Quebec. Es war eine Fahrt auf Leben und Tod gewesen.
Kehren wir jetzt noch einmal nach Gannentaa zurück. Die Flucht der Franzosen wurde nicht gleich bemerkt. Die Hähne krähten in der stillgewordenen Niederlassung am nächsten Morgen wie sonst, und der Haushund bellte. Aber die andauernde Stille erregte allmählich Verdacht. Vorsichtig drangen die Indianer ein und durchsuchten jeden Winkel. Umsonst, nirgends eine Spur. Da erfaßte die abergläubischen Wilden ein jäher Schreck. “Sie sind unsichtbar geworden”, riefen sie, “und über die Wasser weggeflogen, denn Kanoes hatten sie keine!” So hatte diesmal die überlegene Klugheit der Weißen die listige Tücke der roten Krieger geschlagen.
Damit endete die erste Irokesenmission und der erste Versuch einer katholischen Mission im heutigen Staate New York (5. November 1655 bis 20. März 1658).
8. P. Chaumonot als Seelsorger der Huronenkolonie bei QuebecNach seiner Rückkehr aus dem Irokesenland fiel Chaumonot zunächst in eine schwere Krankheit, wohl die Folge der übermenschlichen Anstrengungen, die hinter ihm lagen. Ein furchtbares Kopfweh machte ihn fast völlig taub und raubte ihm allen Schlaf. Auch jetzt wieder nahm er seine Zuflucht nicht zu irdischen Arzneien, sondern zur heiligen Familie, und genas fast plötzlich. Am liebsten wäre er möglichst bald wieder ins Land der Irokesen zurückgekehrt. Dieselben hatten bei ihrem Kriegszug gegen die Franzosen (1659/61) wenig Glück gehabt, und die Friedenspartei gewann wieder die Oberhand. Voll Freude meldete Chaumonot 1661 einem Pater in Europa (Brief an P. Germain Rippault vom 29.10.1661), dass die Onondagas, “unter denen ich fast drei Jahre gearbeitet und eine gute Zahl getauft habe”, und auch andere Stämme der Irokesen einzulenken begännen und die Mission dort wieder aufzuleben verspreche. In Onondage stehe noch die Kapelle. “Die Wilden haben erklärt, sie würden nächstes Frühjahr, wenn sie den Rest ihrer Gefangenen nach Quebec brächten, mich wieder in ihr Land mitnehmen, da sie alle sehr nach mir verlangten, zumal jene, die ich selbst im heiligen Glauben unterrichtet habe. Ich bitte Sie und alle anderen hochwürdigen Patres dort inständig, mich bei Ihren heiligen Meßopfern Gott zu empfehlen, damit nicht meine Feigheit und Armseligkeit mich des Glücks berauben, noch einmal mein wertloses Leben im heidnischen Lande für die Bekehrung der Seelen und die Ehre meines Schöpfers daransetzen zu dürfen. O wie dankbar wäre ich den hochwürdigen Patres, wenn sie mir von Unserem Herrn die Gnade erwirkten, den Rest meines Lebens diesem heiligen Apostelberufe zu weihen!”
Es sollte nicht sein. Chaumonots Gesundheit war durch die übermäßigen Strapazen stark erschüttert, und ein recht bösartiges Bruchleiden machte ihn zu den Wandermissionen im Urwald untauglich. Zudem hatten die Oberen keinen, der die Huronen so verstand und zu behandeln wußte wie er. So übernahm denn Chaumonot ein zweites Mal die Seelsorge der Huronenkolonie bei Quebec und blieb auf diesem Posten, zwei kürzere Unterbrechungen abgerechnet, bis an sein Lebensende.
Die kleine Kolonie hatte während seiner Abwesenheit im Irokesenlande Hartes durchgemacht. Im Mai 1656 war es eine Streifbande Mohawks gelungen, mit 40 Kanoes an den Wällen von Quebec unbemerkt vorüberzuschleichen. Sie landeten ebenso unbemerkt auf der Insel Orléans, legten sich in den Hinterhalt und überfielen am Morgen des 20. Mai die nichts ahnenden Huronen, die teils in der Kirche beteten, teil auf ihren Feldern arbeiteten. 71 wurden entweder niedergemacht oder als Gefangene fortgeschleppt, unter diesen viele junge Frauen.
Die unsicher gewordene Insel wurde verlassen und die Kolonie vorläufig unter dem Fort von Quebec (Fort des Hurons) in Sicherheit gebracht, wo sie bis 1868 verblieb. In diesem Jahr siedelte sie unter Führung P. Chaumonots zunächst nach Notre-Dame des Neiges, einer Besitzung der Jesuiten unweit von Quebec, und da dort der Raum nicht genügte, 1669 nach der französischen Kolonie Côte St-Michel, vier Stunden von Quebec entfernt, über.
“Die Huronenkolonie”, schreibt Chaumonot, “die im Augenblick 150 Seelen zählt, ist ein Rest der Stämme dieser Nation, die vor der Mordgier der Irokesen verschont blieb. Die göttliche Vorsehung hat sie an einem Ort zusammengebracht, der Côte de Saint-Michel heißt und von Franzosen dicht bevölkert ist, damit so einerseits die Huronen von deren gutem Beispiel Nutzen ziehen und die Franzosen ihrerseits an der Frömmigkeit und dem Eifer der Neubekehrten sich erbauen können.”
Beide taten sich auf Anregung ihres gemeinsamen Hirten brüderlich zusammen, um an Stelle der ärmlichen und kleinen Rindenkapelle ein hübsches Kirchlein aufzuführen. Dort stellte Chaumonot eine Kopie des Gnadenbildes Notre-Dame de Foy auf und wurde so unseres Wissens der Gründer des ersten Wallfahrtsortes Unserer Lieben Frau in Neu-Frankreich.
Sechs Jahre verblieb die Kolonie in Notre-Dame de Foy, als eine abermalige Übersiedlung nötig wurde. Zwei Gründe bedingten bei den Indianern diese häufigen Ortsveränderungen. Weil sie das Land nicht düngten, war die Ackerkrume nach sechs bis sieben Jahren erschöpft. Sodann brauchten sie für ihre offenen Herdfeuer sehr viel Holz, und da diese auf dem Rücken herbeigeschafft werden mußte, wünschten sie dem Walde möglichst nahe zu bleiben und waren auf waldreiche Gegende angewiesen.
Die Kolonie wurde diesmal weiter landeinwärts mitten in die Wälder verlegt. Die neue Übersiedlung bot Chaumonot den Anlaß, sein einst in Loreto gemachtes Gelöbnis, ein Abbild des Heiligen Hauses in Kanada erstehen zu lassen, nunmehr zu erfüllen.
P. Dablon, sein ehemaliger Gefährte und jetzt Oberer der ganzen kanadischen Mission, gab freudig seine Zustimmung und übernahm einen Teil der Baukosten. Fromme Wohltäter und die Ursulinen in Quebec taten ein übriges, und so erstand im Jahre 1674 das Heiligtum Notre-Dame de Lorette, das sich rasch zu einem stark besuchten Wallfahrtsort entwickelte und heute noch besteht [auch noch im Jahr 2010].
(Anmerkung Huonder: Im Herbst 1697, also bereits nach Chaumonots Tod, mußte die Kolonie ein letztes Mal weiter in die Wälder vorgeschoben werden. Hier in “Neu-Loreto” blieben die Huronen bis auf den heutigen Tag. Eine zweite Kolonie von Huronen (Petuns) besteht in der Nähe von Sandwich, Essex Co., Ontario, eine dritte ist die Wyandot Reservation in Oklahoma. Das ist alles, was heute von dem einst so mächtigen Stamm übrig geblieben ist; Old Huronia 447 f.)
Die Kolonie war inzwischen durch Zuzug von versprengten Huronen, Neutralen und christlich gewordenen Irokesen und durch natürliche Vermehrung auf gut 500 Seelen gestiegen. Sie bildeten ein Herz und eine Seele und halfen sich gegenseitig in allen Nöten und Leiden mit wahrhaft brüderlicher Liebe.
An “Echon” [auch Ekom] - dieser Name, den die Huronen einst dem P. de Brébeuf gegeben, war als Erbe auf Chaumonot übergegangen - hingen die Neubekehrten mit wahrhaft rührender Liebe und Verehrung.
Und er verdiente sie, gab er ihnen doch vor allem das Beispiel eines wahrhaft heiligen Lebens, das ganz durch das treu gehaltene Gelübde geregelt wurde, in allem und jedem stets nur die größere Ehre Gottes zu suchen.
Hier seien nur einige wenige Züge aus dem schönen Nachruf ausgehoben, den P. Dablon später seinem verstorbenen Mitbruder weihte.
Trotz der heftigen Schmerzen, die ihm besonders sein alts Bruchleiden verursachte, stand Chaumonot jeden Tag bereits um 2 Uhr morgens auf, um die Zeit für eine Betrachtung von mehreren Stunden zu gewinnen. Dann folgte als weitere Vorbereitung auf die heilige Messe eine geistliche Lesung und Prim und Terz.
Die heilige Messe war ihm wirklich der heiligste und wichtigste Akt während des ganzen Tages. Mit welch außerordentlicher Andacht und wunderbaren Tröstungen er sie las, ersieht man aus einem Schriftstück, das er auf Geheiß seines Beichtvaters verfaßte und in welchem er hauptsächlich schildert, was in seiner Seele während der heiligen Geheimnisse am Altare vor sich ging. Der lebendige Glaube und die glühende Liebe zu Christus, die durch diese Aufzeichnungen gehen, sind tief ergreifend. Überhaupt besaß Chaumonot die “Gabe des Gebetes” in einem ganz außerordentlichen Grade. Ohne Zerstreuungen und ohne zu ermüden, konnte er stundenlang vor dem Tabernakel in stillen Zwiegesprächen mit seinem Gott und Heiland knien.
Täglich richtete er während der heiligen Messe an seine Gemeinde einige Worte, um sie zur Hochschätzung und Ehrfurcht gegen das hochheilige Sakrament aufzufordern und ihnen praktische Winke für das andächtige Anhören der heiligen Messe zu geben. Nur an Sonn- und Festtagen predigter er länger. Dankbarere Zuhörer als die Huronen, meinte er einmal, kann man nicht haben.
Im Sommer las er die heilige Messe gleich nach seiner Betrachtung, damit die Leute frühzeitig an die Arbeit gehen konnten. Nach der halbstündigen Danksagung kamen die Krankenbesuche, dann der Sprachunterricht für seine jüngeren Gehilfen. Da er das Huronisch-Irokesische wie kein zweiter beherrschte, wurden alle jüngeren für die Mission bestimmten Patres ihm eine Zeitlang unterstellt, so dass er fast zwei Generationen von Missionaren in ihnen Missionsberuf einführte.
Beim frugalen [spärlichen] Mahle war Chaumonot so mäßig und abgetötet, dass die Oberen sich gezwungen sahen, ihn in dieser Beziehung unter den Gehorsam der jüngeren Mitglieder zu stellen, und ihm befahlen, zu genießen, was diese ihm vorsetzten.
Die Erholung wurde, wenn die Indianer ihm die Zeit ließen, abermals zur Sprachübung oder zu einem praktischen Pastoralunterricht verwandt. Gegen 1 Uhr machte Chaumonot eine Anbetungsstunde in der Kapelle und betete die Tagzeiten und den Rosenkranz. Darauf pflegte er die Hütten seiner Huronen zu besuchen, wo sein Erscheinen stets große Freude hervorrief. Nachher betete er wieder sein Brevier in der Kapelle.
Gegen Sonnenuntergang rief das Glöcklein groß und klein in das Kirchlein zum gemeinsamen Abendgebet oder zur Segensandacht. Alle liturgischen Andachten und Gebete wurden chorweise verrichtet, indem die Männer den lateinischen Text, die Frauen die huronische Übersetzung sangen.
Die späten Abendstunden waren, wenn nicht durch Unterricht oder Beichtstuhl ausgefüllt, der Lesung, dem Gebet und Briefschreiben gewidmet. Denn Chaumonot führte im Interesse seiner lieben Huronen und als vielgesuchter Ratgeber eine umfangreiche Korrespondenz, und was ihm die geistliche Lesung war, zeigt sein Briefwechsel mit zwei großen Geistesmännern, die damals in Frankreich lebten, dem seligen P. Eudes (Stifter der Eudisten [1925 heiliggesprochen]) und P. Johann Crasset S. J., einem der bekanntesten aszetischen Schriftsteller jener Tage.
Praktisch, wie Chaumonot war, pflegte er mit großer Sorgfalt auch das kirchliche Vereinsleben. Besonders zwei Vereine standen in Blüte: die Marianische Kongregation für die jüngeren Leute und der Verein der heiligen Familie für die Verheirateten. Letzteren Verein hatte Chaumonot während seiner einjährigen Seelsorgetätigkeit in Montreal (1662) zunächste für die französischen Kolonistenfamilien eingeführt. Derselbe wurde 1665 an der Katherale von Quebec kanonisch errichtet, verbreitete sich rasch über die ganze Kolonie, und es ist nicht zum wenigsten ihm zu danken, dass das Familienleben der kanadischen Kolonisten jenen echt katholischen Geist erhielt, der es bis auf unsere Zeit in so hohem Grade auszeichnet. Der Verein hatte bei den neubekehrten Indianern eine besonders wichtige Aufgabe zu erfüllen, und was uns die Missionsberichte über das schöne, innige, fromme Familienleben der Huronen erzählen, beweist, wie segensreich er gewirkt. Zweimal in der Woche versammelte Chaumonot die Mitglieder des Vereins zu einem eigenen Vortrag.
Die Huronen wurde nie müde, ihn zu hören. Kein Wunder. Er meisterte zunächst ihre Sprache wie kein anderer Huronenmissionar vor und nach ihm. “Es gefiel Gott”, so schreibt er selbst in seinen Erinnerungen, “mein Sprachstudium so zu segnen, dass es in der Huronensprache keine Feinheit und keinen Ausdruck gibt, den ich nicht mir angeeignet und gleichsam entdeckt hätte.” Dabei war er ein geborener Volksredner. Wenn er in seinen Predigten und Vorträgen einen Zug aus der Bibel oder Heiligenlegende einflocht, war alles so ganz in die Farben und Vorstellungen der kanadischen Umwelt gekleidet, dass die Szenen und Vorgänge in deren Wälderns und an deren Strömen und Seen zu spielen schienen. Bei ihrem schlichten Ernst und ihrer kindlichen Gelehrigkeit nahmen die Rothäute alles, was ihnen der Schwarzrock sagte, gleich wörtlich. Erzählte er irgend einen Zug aus dem Leben Christi und der Heiligen, sofort suchten sie es buchstäblich nachzuahmen oder freuten sich kindlich, dass sie bereits aus sich selbst Ähnliches schon getan hatten. Wenn z. B. der Pater am Karfreitag über das Leiden Christi predigte, griffen viele zu Hause ohne weiteres zur Geißel, um die Schmerzen des Heilandes in etwa mitzukosten.
Im Advent 1671 schickte die ehrwürdige Mutter Maria von der Menschwerdung [1599 - 1672; 1980 seliggesprochen] dem eifrigen Katechisten Ludwig Tuondechoren ein allerliebstes Christkindlein aus Wachs samt Krippleikn als Weihnachtsgeschenk. Das ganze Dorf lief zusammen, um das wunderbare Kindlein zu schauen. Damit alle in die Freude sich teilten und den rechten geistlichen Nutzen schöpften, ließ P. Chaumonot das Kindlein bis Mariä Lichtmeß in den Hütten rundgehen. Alle sollten sich während der vorausgehenden Woche vorbereiten, um das Kindlein würdig zu empfangen. Am Sonntag wurde dann durch das Los bestimmt, welche Hütte das Krippchen die folgende Woche besitzen durfte. In Prozession wurde dasselbe in die schön gereinigte und geschmückte Wohnung getragen. Hierher kamen dann alle Nachbarn zusammen, um Weihnachtslieder zu singen, zu beten und dem Kindlein ihre schönsten Wampuns und was sie sonst an kleinen Schätzen besaßen, zu opfern. Ein heiliger Wetteifer herrschte, wer dem Christkind die beste Aufnahme bereite.
Das ist einer von den zahllosen schönen Zügen, welche die Relations [die Ordensberichte aus der kanadischen Mission] Jahr um Jahr über die Huronenkolonie vno Loreto brachten. Doch muß das Gesagte genügen, um wenigstens eine Vorstellung von dem Leben zu geben, das Chaumonot 30 Jahren unter seien Neubekehrten führte.
9. Tod
Chaumonot war jetzt der älteste Missionsveteran in Kanada, der einzige, der von der alten garde noch übrig geblieben war, hoch verehrt nichit nur von seinen Huronen, sondern auch von seinen Mitbrüdern und den französischen Kolonisten. Diese allgemeine Verehrung kam in schönster Weise zum Ausdruck, als der heiligmäßige Greis 1689 sein 50jähriges Priesterjubiläum feierte. Es war die erste Feier dieser Art in Neu-Frankreich, und Bischof und Kapitel von Quebec wünschten, dass sie in der Kathedrale von Quebec selbst begangen würde, was denn auch unter außerordentlicher Beteiligung der ganzen Stadt geschah.
Zwei Tage später kehrte der Jubilar in sein liebes Loreto zurück und führte hier seine Arbeit fort bis zum Herbst des Jahres 1692. In diesem Jahr wurde die kanadische Kolonie durch eine schreckliche Heuschreckenplage heimgesucht. Franzosen und Indianer wandten sich in ihrer Not an den “heiligen Mann”, wie Chaumonot allgemein genannt wurde; stand er doch längst im Ruf eines Wundertäters und wurden die seltsamsten Dinge von der Kraft seines Gebetes erzählt.
Chaumonot begann mit den Leuten eine Novene. Täglich nach der heiligen Messe trugen sie ehrwürdigen Greis auf eine Anhöhe, von der aus er die Gegend segnete. Am dritten Tage war die Plage aus der ganzen Gegend verschwunden, und die übrigen Tage der Novene wurden der Danksagung gewidmet.
Indessen nahm die Schwäche des Achtzigjährigen so zu, dass man ihn ins Kolleg von Quebec brachte. Hier erbaute er alle im Hause durch seine ungetrübt freudige Geduld und seinen außerordentlichen Gebetsgeist. Fast den ganzen Tag sah man ihn entweder oben in der Kirche oder unten in der Totengruft, wo er seinen lieben alten Kriegskameraden “besuchte”.
Im Dezember machte er trotz großer Schwäche seine letzten Exerzitien. Mit dem Beginn des jahres 1693 brachen all die vielen alten Übel und Krankheiten, die ihm zeitlebens zu schaffen gemacht, gleichsam wieder auf. Trotzdem las er noch täglich die heilige Messe bis vierzehn Tage vor seinem Tode.
Am 18. Febraur empfing er die heilige Wegzehrung. Alle seine Gedanken und Gebete beschäftigten sich fortan mit der heiligen Familie von Nazareth, mit der er die trautesten Zwiegespräche hielt. Gleichsam in ihren Armen entschlief er endlich, die ihm so teuren heiligen Namen auf den Lippen, am 21. Februar 1693, 82 Jahre alt, von denen er 61 in der Gesellschaft Jesu, 54 in Kanada verlebt hatte. “Wir beten”, so hebt der Nachruf an, den ihm P. Dablon, sein einstiger Genosse bei den Irokesen, weihte, “den ältesten und berühmtesten unserer Missionare verloren.”
Gleich nach seinem Tod eilte alles in Kolleg, um die sterbliche Hülle des Verblichenen noch einmal zu sehen; alle wollten ein Andenken von ihm haben. Im Nu waren sein Kruzifix, Rosenkranz usw. verschwunden, seine alte Soutane zerteilt. Man mußte die Leiche schützen, da auch von ihr sich jeder eine Reliquie sichern wollte.
Noch nie hatte Kanada ein Begräbnis gesehen, wie es dem einfachen, schlichten Missionar zuteil wurde. Der ganze Klerus, der Bischof an der Spitze, der Adel, die höchsten Beamten, selbst der den Jesuiten so abgeneigte Generalstatthalter Frontenac [Louis de Buade, Comte de Frontenac, 1620 - 1698], das Volk von nah und fern, nicht zuletzt Chaumonots braune huronische Kinder gaben ihm das letzte Geleit. An seinem Grabe wurde wie an dem eines Heiligen gebetet.
Das war das Ende einer Laufbahn, die so wenig versprechend einst begonnen hatte. Aus dem kleinen Vagabunden von ehedem war ein echter Apostel und Gottesmann und nach dem Ausdruck Abbé Gosselins “eine der schönsten Gestalten der Kirche Alt-Kanadas” geworden.
Anmerkungen:[1] Hier ist in der Selbstbiographie eine Lücke. Wahrscheinlich ging eines der Heftchen verloren.
[2] Noch 1642 zählte sie bloß etwa 200 französische Siedler.
Aus: Anton Huonder SJ, Bannerträger des Kreuzes, Zweiter Teil, Freiburg im Breisgau 1915, S. 218 - 286.
Weitere Indianermissionare:
Personen
(Auswahl)
Lewis C. S.
Malagrida G.
Marescotti J.
Manning H. E.
Marillac L.
Maritain J.
Martin Konrad
Massaja G.
Meier H.
Mieth Dietmar
Mixa Walter
Mogrovejo T.A.
Moltke H. v.
Montalembert
Montecorvino J.
Moreno E.
Moreno G. G.
Mosebach M.
Müller Max
Muttathu-padathu
Nies F. X.
Nightingale F.
Pandosy C.
Paschalis II.
Pieper Josef
Pignatelli G.
Pius XI.
Postel M. M.
Poullart C. F.
Prat M. M.
Prümm Karl
Pruner J. E.
Quidort
Radecki S. v.
Ragueneau P.
Rahner K.
Ratzinger J.
Reinbold W.
Répin G.
Rippertschwand
Rudigier F. J.
Ruysbroek
Salvi Lorenzo
Sanjurjo D. S.
Saventhem E.
Schamoni W.
Schreiber St.
Schynse A.
Sierro C.
Silvestrelli C.
Simonis W.
Solanus
Solminihac A.
Spaemann C.
Spaemann R.
Stein Karl vom
Steiner Agnes
Sterckx E.
Stern Paul
Stolberg F. L.
Talbot Matt
Therese
Thun Leo G.
Tolkien J.R.R.
Tournon Ch.
Vénard Th.
Vermehren I.
Vianney J. M.
Walker K.
Wasmann E.
Waugh E.
Wimmer B.
Windthorst L.
Wittmann G. M.
Wurmbrand R.
Xaver Franz





