zur katholischen Geisteswelt
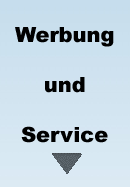
|
Zum
Inhalts- verzeichnis |
|
Zum
Rezensions- bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im biographischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
Datenschutzerklärung
|
Zum philosophischen Bereich
|
|
Zum
liturgischen Bereich |
Personen
(Auswahl)
Albert d. Große
Allouez C.
Amadeus v. L.
Auden W. H.
Bacon Francis
Bain James
Balmes J.
Barón R.
Barbarigo G. Baronius C.
Basset J.
Bataillon P. M.
Bélanger Dina
Bellarmin R.
Benninghaus A.
Benno v. M.
Bernanos G.
Billot Louis
Billuart C. R.
Bobola A.
Böhm D.
Borghero F.
Borja Franz v.
Boscardin B.
Brendan
Brisson L.
Calvin J.
Capestrano J.
Capitanio B.
Cassian v. N.
Castro A. de
Chambon M.M.
Chaumonot
Claret A.M.
Cornacchiola B.
Dawkins R.
Deku Henry
Delp Alfred
Döblin Alfred
Döring H.
Duns Scotus
Ebner F.
Eltz Sophie zu
Ferrero
Ferretti G.
Fesch Jacques
Flatten Heinrich
Focherini O.
Gallitzin A.v.
Geach P. T.
Gerlich M.
Green Julien
Haecker Th.
Hasenhüttl G.
H. d. Seefahrer
Hengelbrock W.
Hildebrand D. v.
Hochhuth Rolf
Höffner Joseph
Hönisch A.
Homolka W.
Hopkins G. M.
Husserl E.
Ignatius v. L.
Innozenz XI.
Jakob Max
Janssen A.
Jogues Isaak
Jones David
Jörgensen J.
Kaltenbrunner
Knox R. A.
Konrad I.
Kornmann R.
Kutschera U.
Lamy J. E.
Laurentius v. B.
Le Fort G. v.
Lehmann Karl
Leisner Karl
Dichtung als Gottesdienst
Über Gerard Manley Hopkins
Von Michael Hanke
Es ist der 4. Dezember 1875. In Bremerhaven nimmt der Dampfsegler „Deutschland“ Kurs auf die Vereinigten Staaten: an Bord neben etwa 100 Besatzungsmitgliedern 135 Passagiere. Die meisten sind Auswanderer, darunter fünf franziskanische Ordensfrauen aus dem westfälischen Salzkotten, die im Zuge des preußischen Kulturkampfes ihre Heimat verlassen müssen. Das Wetter ist schlecht; zu hohem Seegang und anhaltendem Nebel gesellt sich ein Schneesturm. Vierzig Kilometer vor der englischen Südostküste führt ein Navigationsfehler des Kapitäns zur Katastrophe: Das Schiff weicht vom Kurs ab und läuft in der Themsemündung auf eine Sandbank. Eisige Brecher fegen übers Deck; vor allem Frauen und Kinder werden von Bord gespült. Zu den 57 Passagieren, die ihr Leben verlieren, gehören die Ordensfrauen.
Zur gleichen Zeit genießt ein junger Pater namens Gerard Manley Hopkins (1844–1889) das milde Wetter im walisischen Jesuitenkolleg St Bruno. In den folgenden Tagen liest er in der Times die ausführlichen, um immer neue Details erweiterten Berichte über den Untergang der „Deutschland“; im Artikel des 11. Dezember werden auch die Franziskanerinnen erwähnt: „Fünf Ordensfrauen fassten sich an den Händen und gingen gemeinsam unter. Ihre Leiterin, eine hagere Frau von großem Wuchs, rief mehrfach: ,O Christus, komm schnell!‘“
Hopkins erzählt seinem Rektor, wie sehr ihn das Unglück bewegt, und dieser äußert den Wunsch, es möge jemand ein Gedicht darüber schreiben. Er kann nicht wissen, dass er den wortgewaltigsten englischen Dichter der Gegenwart vor sich hat. Dieser hatte zwar in der Jugend einige Kostproben seiner Verskunst vorgelegt, beim Eintritt in den Jesuitenorden aber gelobt, keine Gedichte mehr zu verfassen – es sei denn, einer seiner Oberen sollte ihn dazu auffordern. Jetzt begibt er sich ans Werk und schreibt ein Gedicht, das ein halbes Jahrhundert später in der wichtigsten Anthologie moderner englischer Dichtung an den Anfang gerückt und seither als Wendepunkt in der englischen Verskunst der letzten drei Jahrhunderte gewürdigt wird. Wer ist der 31-jährige Pater, der binnen weniger Wochen das heute weit über den englischen Sprachraum hinaus bekannte Gedicht „Der Untergang der ,Deutschland‘“ schreibt?
Gerard Manley Hopkins wird 1844 als Sohn einer wohlhabenden anglikanischen Familie geboren. Schon früh lässt er eine außergewöhnliche künstlerische und intellektuelle Begabung erkennen, so dass ihm eine glanzvolle Laufbahn prophezeit wird. Der junge Gerard – von attraktivem Äußeren, doch zarter Gesundheit – dichtet, malt, komponiert. Seine besondere Liebe gilt der antiken Literatur. Sie führt ihn 1863 an die Universität Oxford, wo er alte Sprachen studiert und vier Jahre später ein hervorragendes Examen ablegt, das ihm gegen Ende seines Lebens eine Professur für Gräzistik in Dublin einbringt.
Zur Freude der Eltern ist die Universität Oxford Zentrum der sogenannten Oxford- Bewegung, jener Strömung des Anglikanismus, die mit der sogenannten „niederkirchlichen“ Richtung rivalisiert und in Ritus und Lehre mit dem Katholizismus sympathisiert, ohne ihre protestantische Identität zu leugnen. Doch die Freude weicht rasch der Bestürzung, als der Sohn (ohne um Rat oder Zustimmung zu bitten) ihnen mitteilt, dass er seinem verehrten Vorbild John Henry Newman folgen und konvertieren werde. Die Eltern halten ihn für ebenso „kopf- wie herzlos“. Doch Hopkins erklärt seinen Entschluss für ebenso folgerichtig wie das Ergebnis der Addition von zwei und zwei. Wenige Wochen später nimmt ihn Kardinal Newman in die Kirche auf und verspricht ihm Unterstützung für den Fall, dass seine Konversion zu familiären oder finanziellen Problemen führen sollte.
Bei der Konversion bleibt es nicht. Kardinal Newman bemerkt die Willensstärke des jungen Mannes und bestärkt ihn in dem Wunsch, in den Jesuitenorden einzutreten. Im Unterschied zu der heute unter Konvenienz-Katholiken verbreiteten Neigung, praktizierte Homosexualität als moralisch unbedenkliche Variante des Liebesbegriffs anzuerkennen, nimmt Hopkins mit diesem Schritt den Kampf gegen eine Veranlagung auf, die er als Todsünde ansieht. Mit Blick auf sein „Deutschland“-Gedicht lässt sich sagen, dass er sie im Einklang mit den Gesetzen Gottes künstlerisch sublimiert.
Die Faszinationskraft dieses Gedichts (wie der meisten seiner späteren Gedichte) verdankt sich der bewunderungswürdigen Verschmelzung von Thema und Form. Thema ist der als Martyrium verstandene Tod der Ordensfrauen; rasch wechselnde Sprechsituationen sind eingebettet in Gebete und Meditationen. Das Gedicht beginnt mit einer Anrufung Gottes, in dem Ehrfurcht, Bewunderung und ahnendes Verstehen seiner Allmacht (wie im Lobgesang der Engel zu Beginn des „Faust“) zur demütigen Bejahung seines Wirkens führen; es endet mit der Bitte an die Leiterin der Ordensfrauen, sein Heimatland zum wahren Glauben zurückzuführen. Die Form des Gedichts ergibt sich aus der von Hopkins angestrebten Verbindung des Schönen mit dem Schrecken einflößenden Erhabenen.
Die Dichterin und Konvertitin Edith Sitwell hat diese Kunst in ihrer Analyse des Gedichtanfangs verdeutlicht: „Im langsamen und majestätischen Eröffnungsvers 'Du mich meisternder [Gott]' erzeugen die langen und kräftig anschwellenden Vokale sowie die alliterierenden m's das Bild einer riesigen Welle, die sich erhebt, langsam steigt, ungeheure Kraft gewinnt, bis wir zur Pause am Versende gelangen. Dann fällt die Welle, nur um erneut sich nach vorn zu stürzen.“ Zwar mag es verwegen erscheinen, all dies einem einzigen, syntaktisch nicht einmal vollständigen Vers extrahieren zu wollen. Und doch: Wer das Gedicht von Anfang bis Ende liest (und seiner Sogwirkung kann man sich nur schwer entziehen), wird zugeben, dass Edith Sitwell weniger die Wirkung allein des isoliert zitierten Verses, wohl aber die des gesamten, 280 Verse umfassenden Werkes treffend beschreibt. Hopkins ist mit diesem Gedicht der Schöpfer eines eigenen, von ihm als „Sprungrhythmus“ bezeichneten Metrums geworden, in dem der Einzelvers bei fester Zahl der Hebungen (der betonten Silben) eine beliebige Zahl der jeder Hebung vorausgehenden oder folgenden Senkungen (der unbetonten Silben) aufweist – eine an englische Vorbilder des Mittelalters angelehnte technische Meisterleistung, die eine kleine Revolution der Dichtkunst zur Folge haben sollte.
Weder eine Paraphrase noch dem Zusammenhang entnommene Zitate vermögen die energetische Wucht dieses langen Gedichts zu vermitteln. Hopkins stellt sich die Aufgabe, den durch die grauenhaften Geschehnisse nicht etwa geschwächten, sondern gestärkten Glauben als Zentrum menschlichen Seins symbolisch zu vermitteln. Die Szenerie des Sturmes, des Schiffbruchs und des gewaltsamen Todes wird vom gläubigen Visionär (im Sinne eines ignatianischen „exercitium spirituale“) als Teil des Schöpfungsplans gedeutet und bejaht. Die fünf Franziskanerinnen sind nicht etwa Opfer eines sinnlosen Unfalls oder gar eines „Zufalls“, der im christlichen Weltbild ohnehin keinen Platz hat. Hopkins identifiziert sie mit den fünf Wundmalen ihres Ordensgründers, des Heiligen Franziskus und symbolisiert solcherart ihre Bereitschaft zur „imitatio Christi“. Ihr Tod unter den Mastbäumen des Schiffes ist die ihnen zugedachte Kreuzigung, ihr Tod fällt zusammen mit dem ihres Erlösers.
Doch ist der Ausruf „O Christus, Christus, komm schnell!“ – so ließe sich einwenden – nicht auch Ausdruck ihrer Todesangst? Hopkins kommt dem Einwand zuvor. „Herr, wir verderben“, zitiert er den Angstschrei der Jünger auf dem See Genezareth, obwohl der Herr mitten unter ihnen ist. „Sie waren anders gesinnt“, kommentiert Hopkins; er lässt seine Ordensfrau „ihr Kreuz ihren Christus“ nennen. Dem Gottesleugner muss diese Deutung des gewaltsamen Todes pervers erscheinen. Doch nur sie ist für Hopkins sinnvoll. Die Vertreibung der Ordensfrauen aus dem protestantischen Deutschland ist Teil des göttlichen Heilsplans. Christus macht sie zu Heiligen, so dass der Dichter sie in den letzten Versen sogar um Fürsprache für seine der Häresie verfallene Heimat machen darf.
Hopkins verstand sein ganzes Leben als Gottesdienst; seine Dichtung war nur Teil davon. Es verwundert, dass manche Forscher noch heute so viel Mühe darauf verwenden, sein Spätwerk, insbesondere die nicht von Hopkins selbst so genannten „schrecklichen Sonette“ seiner letzten, gesundheitlich schwer angeschlagenen Dubliner Monate als Beweis für ein zerrüttetes Gottvertrauen zu reklamieren. Schon sein nüchterner Hinweis in einem Brief an den Dichterfreund Robert Bridges, er habe „ein weiteres Sonett“ geschrieben (es sollte sein letztes sein), hätte als Beleg dafür dienen können, dass er nicht in Depressionen versunken war – auch dann nicht, als er einige Tage später an Tuberkulose erkrankte.Was ihm tatsächlich Sorgen machte, war nicht fehlendes Gottvertrauen, sondern ein Paar abgelaufener Schuhe: Er bat, sie zum Schuster zu bringen. Seine letzten Worte – ein Mitbruder hat sie überliefert – lauteten: „Ich bin so glücklich.“
Unter Freunden wirkte Hopkins auch als strenger Kritiker. Bewegt von Hopkins’ Tod im Juni 1889 schrieb der katholische Dichter Coventry Patmore dem gemeinsamen Freund Bridges, dass er ihm nach jahrelangem Feilen ein Prosawerk zugesandt habe, in dem die Beziehung der Seele zu Gott in Analogie zur Beziehung von Mann und Frau gedeutet wurde. Hopkins habe geantwortet, dass die literarische Gestaltung des Erhabenen und Unschuldigen nicht dagegen gefeit sei, Gedanken an Niederes zu wecken; selbst die Kontemplation auf höchstem Niveau stehe in Gefahr, missbraucht zu werden. Zwei Jahre lang – schreibt Patmore – habe er geschwankt. Am Weihnachtsabend des Jahres 1887 sei es dann soweit gewesen: Er habe sich Hopkins’ „durchschlagender Güte und Frömmigkeit“ nicht mehr entziehen können und das Manuskript ins Feuer geworfen.
Erst 1918 wagte Robert Bridges – damals als „poeta laureatus“ der angesehenste englische Dichter seiner Zeit – eine Auswahl von Hopkins’ Lyrik zu publizieren. Vor dem „Untergang der ,Deutschland‘“ glaubte er die Leser in einem apologetischen Vorwort jedoch warnen zu müssen: Das Gedicht bäume sich zu Beginn des Bandes auf wie ein Drache. Doch seither ist Hopkins’ dichterisches Ansehen auf Kosten des Freundes stetig gewachsen: Die Dichtung von Bridges ist nur noch eine Fußnote in einem Kapitel der Literaturgeschichte, die von Hopkins ein Eckstein.
Als 1930 eine erweiterte Auflage des Bandes erschien, traf Hopkins’ Lyrik die jüngste Generation englischer Dichter (W. H. Auden, George Barker, Dylan Thomas) wie ein Blitz. Doch rezipierten sie nicht seine religiösen Themen, sondern seine Verstechnik. Bei den führenden katholischen Autoren stieß Hopkins auf betretenes Schweigen. Chesterton hat ihn in keinem seiner literarkritischen Essays auch nur erwähnt. Doch ist das verwunderlich? Bedenkt man, dass Hopkins sogar bei dem ihm so wohlgesonnenen Coventry Patmore auf Unverständnis gestoßen war (er bezeichnete Hopkins’ Gedichte als „in Quarz eingelegte Juwelen“), um wieviel mehr musste ein Mann wie Chesterton, der sich zeitlebens gegen metrische Experimente gewehrt hatte, die Lyrik des Paters ablehnen. Und während der junge George Barker sein geistreiches Huldigungssonett an Hopkins („An Pater Gerard Manley Hopkins, S.J.“) unter Rückgriff auf dessen Sprungrhythmen schrieb, wartete der frisch konvertierte Südafrikaner Roy Campbell mit zwei nicht minder geistreichen Hopkins-Parodien auf, in denen er die nicht zu leugnenden Manierismen des Meisters humorvoll auf die Spitze (und vielleicht darüber hinaus) trieb.
Wie steht es heute um Hopkins? Niemand wird einzelne Schwächen seines Dichtungsstils bestreiten wollen. Die besten seiner Gedichte aber erfüllen Gottfried Benns Diktum: „Lyrik muss entweder exorbitant sein oder gar nicht.“ Das Mittelmaß war Hopkins verhasst, in der Lyrik wie im Glauben. Und was seine Manierismen betrifft – sie verblassen angesichts der Intensität eines dichterischen und religiösen Empfindens, das der Maxime des Heiligen Ignatius von Loyola gerecht wird: „Der Mensch ist geschaffen, um Gott zu preisen.“
Der Text erschien am 24. März 2015 in der Tagespost, der empfehlens- und unterstützenswerten einzigen katholischen Zeitung Deutschlands. Wiedergabe mit freundlicher Erlaubnis.
Personen
(Auswahl)
Lewis C. S.
Malagrida G.
Marescotti J.
Manning H. E.
Marillac L.
Maritain J.
Martin Konrad
Massaja G.
Meier H.
Mieth Dietmar
Mixa Walter
Mogrovejo T.A.
Moltke H. v.
Montalembert
Montecorvino J.
Moreno E.
Moreno G. G.
Mosebach M.
Müller Max
Muttathu-padathu
Nies F. X.
Nightingale F.
Pandosy C.
Paschalis II.
Pieper Josef
Pignatelli G.
Pius XI.
Postel M. M.
Poullart C. F.
Prat M. M.
Prümm Karl
Pruner J. E.
Quidort
Radecki S. v.
Ragueneau P.
Rahner K.
Ratzinger J.
Reinbold W.
Répin G.
Rippertschwand
Rudigier F. J.
Ruysbroek
Salvi Lorenzo
Sanjurjo D. S.
Saventhem E.
Schamoni W.
Schreiber St.
Schynse A.
Sierro C.
Silvestrelli C.
Simonis W.
Solanus
Solminihac A.
Spaemann C.
Spaemann R.
Stein Karl vom
Steiner Agnes
Sterckx E.
Stern Paul
Stolberg F. L.
Talbot Matt
Therese
Thun Leo G.
Tolkien J.R.R.
Tournon Ch.
Vénard Th.
Vermehren I.
Vianney J. M.
Walker K.
Wasmann E.
Waugh E.
Wimmer B.
Windthorst L.
Wittmann G. M.
Wurmbrand R.
Xaver Franz





