zur katholischen Geisteswelt
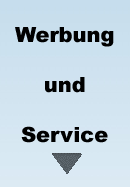
|
Zum
Inhalts- verzeichnis |
|
Zum
Rezensions- bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im biographischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
Datenschutzerklärung
|
Zum philosophischen Bereich
|
|
Zum
liturgischen Bereich |
Personen
(Auswahl)
Albert d. Große
Allouez C.
Amadeus v. L.
Auden W. H.
Bacon Francis
Bain James
Balmes J.
Barón R.
Barbarigo G. Baronius C.
Basset J.
Bataillon P. M.
Bélanger Dina
Bellarmin R.
Benninghaus A.
Benno v. M.
Bernanos G.
Billot Louis
Billuart C. R.
Bobola A.
Böhm D.
Borghero F.
Borja Franz v.
Boscardin B.
Brendan
Brisson L.
Bryson Jennifer
Calvin J.
Capestrano J.
Capitanio B.
Cassian v. N.
Castro A. de
Chambon M.M.
Chaumonot
Claret A.M.
Cornacchiola B.
Crockett Clare
Dawkins R.
Deku Henry
Delp Alfred
Döblin Alfred
Döring H.
Duns Scotus
Ebner F.
Eltz Sophie zu
Ferrero
Ferretti G.
Fesch Jacques
Flatten Heinrich
Focherini O.
Gallitzin A.v.
Geach P. T.
Gerlich M.
Green Julien
Haecker Th.
Hasenhüttl G.
H. d. Seefahrer
Hengelbrock W.
Hildebrand D. v.
Hochhuth Rolf
Höffner Joseph
Hönisch A.
Homolka W.
Hopkins G. M.
Husserl E.
Ignatius v. L.
Innozenz XI.
Jakob Max
Janssen A.
Jogues Isaak
Jones David
Jörgensen J.
Kaltenbrunner
Knox R. A.
Konrad I.
Kornmann R.
Kutschera U.
Lamy J. E.
Laurentius v. B.
Le Fort G. v.
Lehmann Karl
Leisner Karl
Florence Nightingale
Von Gisbert Kranz
Vor 100 Jahren, am 3. August 1910, starb Florence Nightingale. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ihre Biographie aus der Feder von Gisbert Kranz, zuletzt veröffentlicht in Gisbert Kranz, Zwölf Frauen, Eos Verlag Erzabtei St. Ottilien, 1998, S. 357-383. Dieser empfehlenswerte Band enthält außerdem die Biographien von Hildegard von Bingen, Hedwig von Schlesien, Elisabeth von Thüringen, Birgitta von Schweden, Caterina von Siena, Jeanne d’Arc, Vittoria Colonna, Teresa von Avila, Johanna Franziska vno Chantal, Maria Ward und Amalie von Gallitzin. Letztere Biographie erschien auch als eigene Broschüre, die über unsere Seite des Schriftenapostolats kostenlos bestellt werden kann.
Kampf um den Beruf
Was soll ein junges Mädchen tun, wenn es sich zu einem bestimmten Beruf entschließt, dieser Entschluß aber bei seinen Eltern und seiner Familie auf den heftigsten Widerstand stößt? Soll es rebellieren? Oder soll es sich der Meinung seiner Umwelt fügen? Florence Nightingale tat in dieser Lage weder das eine noch das andere. Sie ging einen dritten Weg, der zwar unvergleichlich qualvoller war und acht Jahre ihres Lebens kostete, aber schließlich doch das Ziel erreichte und zu weit größeren Erfolgen führte.
Die Nightingales waren eine reiche und kultivierte Familie, die auf ihren stattlichen Gütern in Südengland oder während ausgedehnter Reisen (mit Dienerschaft und in einer eigenen Kutsche, die zehn Personen faßte und von sechs Pferden gezogen wurde) ein angenehmes Leben führte. Die ältere der beiden Töchter hieß Pärthenope, weil sie in Neapel geboren war; die jüngere trug den damals ebenso ungewöhnlichen Vornamen Florence, nach ihrer Geburtsstadt am Arno. Der Vater, der es nicht nötig hatte, einen Beruf auszuüben, erteilte den Mädchen in seiner Privatbibliothek Unterricht in Griechisch, Latein, Deutsch, Französisch, Italienisch, Geschichte und Philosophie. Florence war schöner und intelligenter als ihre Schwester. Die Gelehrten und die jungen adeligen Herren, die bei den Nightingales verkehrten, wandten denn auch ihre Aufmerksamkeit vor allem ihr zu, die jeden durch ihr Wesen bezauberte. Ihre Mutter und der ganze Kreis hegten nicht den geringsten Zweifel, daß »Flo«, wie es für junge Damen ihres Standes üblich war, eine gute Partie machen und als Schloßherrin dieses glänzende Leben fortführen werde.
Florence war noch nicht siebzehn, als sie ein entscheidendes Erlebnis hatte. In ihr Tagebuch schrieb sie: »Am 7. Februar 1837 sprach Gott zu mir und berief mich in seinen Dienst.« Ihre Biographin gibt dazu folgenden Kommentar: »Es war keine innere Offenbarung. Sie hörte (wie Jeanne d‘Arc) eine objektive Stimme, eine Stimme außerhalb ihrer selbst, die in menschlichen Worten zu ihr redete.« (Cecil Woodham-Smith, Florence Nightingale 1820—1910, London 1950, S. 17.) Während aber Jeanne d’Arc von ihren Stimmen konkrete Befehle erhielt, blieb Florence Nightingale im Ungewissen darüber, welcher Art der Dienst sei, zu dem Gott sie berief. Später sprach Gott noch mehrmals im Laufe ihres Lebens zu ihr, wie sie 1874 in ihrem Tagebuch feststellte, doch jetzt wußte sie nur, daß sie Gott gehörte. Ihr Weg lag noch im Dunkeln.
Zunächst einmal bereiste Miss Nightingale anderthalb Jahre mit ihren Eltern Frankreich, Italien und die Schweiz. Während der langen Aufenthalte in Nizza, Genua, Florenz, Genf und Paris genoß sie in vollen Zügen das Leben, war eine gefeierte Ballkönigin, gewann Verehrer, wurde bewundert von Gelehrten und Schriftstellern, die in ganz Europa einen Namen hatten. Ihre Mutter blickte stolz auf die Erfolge ihrer schönen und geistvollen Tochter in der intellektuellen und vornehmen Gesellschaft und machte sich große Hoffnungen auf ihre Zukunft.
Florence aber war nach der Rückkehr von der großen Reise alles andere als glücklich. Ihr Gewissen ließ ihr keine Ruhe. Zwei Jahre war es nun schon her, daß Gott zu ihr gesprochen hatte. Warum hatte Er nicht wieder gesprochen? Sicher deshalb (so fand sie), weil sie unwürdig war. Sie hatte Gott in Ballsälen und Salons vergessen, hatte sich dem Vergnügen hingegeben und der Lust, bewundert zu werden. Sie nahm sich vor, die Versuchung, in Gesellschaft glänzen zu wollen, zu überwinden, um sich für Gottes Dienst würdig zu machen. Es folgten sechs Jahre des Suchens und der Verwirrung. Welche Art Dienst forderte Gott von ihr? Ein sorgloses Leben in der High Society konnte es nicht sein. Einer Existenz in Luxus, Glanz und Muße vermochte sie keinen Sinn abzugewinnen. Sie hatte alles, worum viele sie beneidet hätten: Pferde, Hausbälle, Opernbesuche, Verehrer — doch schien ihr dies alles leer zu sein. In ihr Tagebuch schrieb sie: »Ich verlange heftig nach einer regelmäßigen Beschäftigung, nach etwas Vernünftigem, das des Tuns wert ist, statt meine Zeit mit Nichtigkeiten zu vertrödeln.« Die Familie hielt sie für undankbar, weil ihr dieses behagliche Leben nicht genügte, und schalt sie als »sonderbar, querköpfig und eigensinnig«. Florence war unglücklich darüber, daß sie anders war als andere, und bemühte sich redlich, den Anforderungen ihrer Umwelt zu entsprechen. Und doch fühlte sie sich wie in einem goldenen Käfig.
1842 wurde ihr eindringlich bewußt, daß es außer der reichen, glanzvollen Welt, in der sie sich bewegte, auch eine Welt des Elends, des Leidens und der Verzweiflung gab. Die Bevölkerung Englands litt in jenem Jahre unter Mißernten und Hungersnot. In den Hütten der Weber und Landarbeiter in der Nachbarschaft, die Florence aufsuchte, sah sie Sorge und Krankheit. Sie begann, sich um die Armen zu kümmern, ihnen Essen, Kleidung, Medizin zu beschaffen und sich Gedanken über gesündere Wohnungen und über Volksbildung zu machen.
Alles, was sie tat, verrichtete sie sehr gründlich, sorgfältig und genau. Sobald sie aber ohne Beschäftigung war, gab sie sich einsamen Grübeleien und Tagträumen hin. Sie erkannte diese Neigung als eine große Versuchung und bekämpfte sie, freilich viele Jahre ohne Erfolg, so daß sie manchmal schier verzweifelt war. Sie verkehrte mit einer frommen Verwandten, führte mit ihr lange religiöse Gespräche und wechselte mit ihr endlose Briefe über die Vereinigung der Seele mit Gott, die Florence als eine notwendige Voraussetzung verstand für die Ausführung von Gottes Werk. Ihr wurde klar, daß Gott dienen den Menschen dienen heißt. Seltsame Vorstellungen suchten sie heim. Als sie einmal mit einem Besucher vor der vielfenstrigen Fassade des Herrenhauses stand, überlegte sie, wie sie das Gebäude in ein Hospital umwandeln könne.
Im Frühjahr 1844 wurde ihr endlich gewiß, wozu sie berufen war: Sie sollte in Hospitälern unter Kranken arbeiten. Als Dr. Howe, der amerikanische Philantrop, als Gast in ihrem Elternhaus weilte, fragte sie ihn unter vier Augen: »Halten Sie es für unpassend und ungehörig, wenn eine junge Engländerin sich Werken der Nächstenliebe in Hospitälern und anderswo widmet, wie es die katholischen Schwestern tun? Glauben Sie, das wäre etwas Schreckliches?« Er antwortete: »Meine liebe Miss Florence, es wäre ungewöhnlich, und in England hält man alles Ungewöhnliche für unpassend. Aber ich sage Ihnen: Gehen Sie vorwärts! Wenn Sie für diese Lebensaufgabe eine Berufung haben, dann handeln Sie nach Ihrer Eingebung, und Sie werden finden, daß niemals etwas Ungehöriges oder für eine Dame Unschickliches darin liegt, wenn man zum Wohle anderer seine Pflicht tut. Entscheiden Sie sich! Bleiben Sie dabei, wohin es Sie führen mag! Gott sei mit Ihnen!« (Woodhani-Smith, S. 48f.)
Sie zögerte, dem Ruf zu folgen. Zwar beschäftigte sie sich theoretisch mit Krankenpflege, nahm sich auch hier und da eines Kranken in der Umgebung an; aber sie tat noch keinen entschiedenen Schritt auf den praktischen Beruf hin. Gewissensbisse quälten sie deshalb. »Niemand hat so wie ich gegen den Heiligen Geist gefehlt«, schrieb sie in jenen Jahren des Widerstrebens. Praktische Erfahrungen drängten ihren methodischen Geist vorwärts. Viermal half sie an einem Sterbebett, einmal bei einer schweren Geburt. Sie erkannte dabei, daß Zartgefühl, Mitleid und Geduld nicht ausreichten, eine erfolgreiche Pflegerin zu machen. Nötig war vor allem eine gehörige Menge Fachwissen, und das konnte sie am besten in einem Krankenhaus lernen.
Eines Tages erklärte die Fünfundzwanzigjährige ihren Eltern, sie wolle für drei Monate ins Hospital von Salisbury gehen, um dort Krankenpflege zu lernen. Außerdem gestand sie ihren Plan, eines Tages in einem Nachbardorf ein eigenes Krankenhaus zu gründen, zusammen mit »so etwas wie einem protestantischen Schwesternorden, ohne Gelübde, für gebildete Damen«.
Die Erklärung wirkte, als sei eine Bombe in das Haus geschlagen. Die Mutter war empört, der Vater entsetzt, Parthenope fiel in Ohnmacht. Damals war es unvorstellbar, daß eine Frau aus gutem Hause unabhängig durch die Welt komme. Es gab keinen anderen Beruf für sie, als an der Seite eines Gatten die Honneurs zu machen. Und dann Krankenpflegerin! Darunter stellte man sich damals ein grobes altes Weib vor, unwissend, schmuddelig, oft brutal, versoffen und unzuverlässig. Dickens hatte soeben den Typ in seiner Mrs. Gamp geschildert (Charles Dickens, The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, 19 Teile, London 1843—44; in 3 Bänden, London 1844). In der Tat wurde der Dienst an Kranken damals rohesten Wärterinnen überlassen. Krankenhauspflege galt als ein Beruf, den eine anständige Frau nicht ergreifen konnte. Wenn eine Dienstmagd Pflegerin wurde, nahm man an, sie habe sich etwas zuschulden kommen lassen. Manche Wärterinnen gaben sich abwechselnd mit Pflege und mit Prostitution ab. Man kann es schon verstehen, daß die Familie Nightingale sich gebärdete, als ob Florence »studienhalber in ein Bordell eintreten wollte« (Ida Friederike Görres, Aus der Welt der Heiligen, Frankfurt a. M. 1955, S. 285— 355: Florence Nightingale, eine protestantische Heilige? Hier S. 290).
Vorerst streckte Florence die Waffen. Gott hatte sie zum Dienst an den Kranken berufen. Wenn ihre Umwelt mit ihrem Entschluß nicht einverstanden war, so mußte das, meinte sie, daran liegen, daß sie noch nicht würdig genug war. Geduldig spielte sie also weiter tagsüber die gehorsame Haustochter. Vor Morgengrauen aber studierte sie insgeheim Blaubücher über öffentliches Gesundheitswesen und Jahresberichte von Krankenhäusern. Bei Kerzenlicht füllte sie viele Hefte mit Massen von Fakten über das Sanitätswesen in England und in andern Ländern. Durch den preußischen Gesandten von Bunsen, der im Hause Nightingale verkehrte, bekam Florence die Jahresberichte der Diakon issenanstalt in J(aiserswerth zu lesen. Die Lektüre ließ ihr Herz höher schlagen. Diese Gründung des evangelischen Pastors Theodor Fliedner (Theodor Fliedner, 1800—1864. Aus seinen Schriften ragt hervor: Buch der Märtyrer und anderer Glaubenszeugen, 4 Bde., Kaiserswerth 1842—1860, geschrieben für seine Diakonissen) war, was sie suchte: eine Schule, in der junge Mädchen die Krankenpflege erlernen können und zu einer Art Ordensschwestern ohne Gelübde herangebildet werden.
Im Winter 1847 bis 48 weilte Florence mit ihrer Familie in Rom. Sie war begeistert von der Stadt, von Michelangelo, vom Papst. Sie lernte Sidney Herbert, den vollkommenen Gentleman, und seine junge Frau kennen, machte mit beiden zu Pferd Ausflüge in die Umgebung Roms und führte mit ihnen lange Gespräche. Zu beiden faßte Florence eine tiefe Zuneigung, die für ihr späteres Leben und Wirken bedeutsam werden sollte. Den tiefsten Eindruck ihres römischen Aufenthaits aber gewann sie im Kloster der Dames du Sacrd Cceur an Santa Trinitä de‘Monti, wo sie fast täglich weilte. Die Schwestern dort unterhielten eine sehr fortschrittliche Waisenhausschule. Florence studierte die Einrichtungen und erhielt manche Anregung. Die Seele des Ganzen war Madre Santa Colomba, die ein intensives mystisches Leben mit erfolgreicher Tätigkeit verband. Diese Ordensfrau riet Florence, sich völlig dem Willen Gottes zu unterwerfen. Florence schrieb alle Aussprüche der Mystikerin auf und machte im Kloster zehntägige Exerzitien. Am Schluß dieser geistlichen Übungen glaubte sie wieder Gottes Stimme zu hören, die von ihr forderte, ihren Willen völlig zu unterwerfen und sich nicht gegen ihre Umwelt aufzulehnen (Woodhani-Smith, S. 72). Es fiel Florence schwer, diesem Befehl zu folgen. Nach England zurückgekehrt, konnte sie sich mit dem untätigen Leben als Haus-tochter nicht abfinden. Ihre fromme Verwandte schrieb ihr, alles, auch eine Party oder ein Empfang, könne zur Ehre Gottes getan werden.
Florence schrieb zurück: »Wie kann es zur Ehre Gottes sein, wenn es so viel Elend gibt in der Welt, das wir heilen könnten, statt in Luxus zu leben!« Sie gab eine Reihe von Unterrichtsstunden in der Schule des Nachbardorfes über das Leben Christi, hatte aber das Gefühl, daß sie zur Lehrerin nicht tauge. Ihr Dasein schien ihr manchmal unerträglich zu sein.
Der Mann, der sie seit neun Jahren umwarb und den sie anbetete, drängte sie zur Entscheidung. Heiraten wäre nur eine Fortsetzung ihres bisherigen müßigen, verwöhnten Lebens gewesen. Sie wußte sich zu anderem berufen und sagte Nein, mochte ihr Herz dabei fast brechen. (Sie hat noch mehrmals Heiratsanträge von ausgezeichneten Männern bekommen und sie stets abgelehnt.) Aber noch sah sie keine Möglichkeit, das zu verwirklichen, um dessentwillen sie dieses Opfer gebracht hatte. Die Leere wuchs, und mit ihr die Qual.
Mit einem befreundeten Ehepaar unternahm Miss Nightingale 1849 bis 50 eine Ägyptenreise. Sie fuhr mit einer Barke tausend Kilometer den Nil hinauf. Stärker als Abu Simbel und die andern Tempel des Niltals wirkten auf sie die Sklavenmärkte und die elenden Dörfer. In Florences Innerem spielte sich ein Drama ab. Sie war manchmal niedergedrückt bis zur Verzweiflung, doch gab es auch lichte Augenblicke. In ihrem Tagebuch lesen wir: »22.2.: Gott sprach wieder zu mir, auf den Stufen der Säulenhalle in Karnak... 7. 3.: Gott rief mich heute morgen und fragte mich, ob ich Gutes für Ihn tun wolle, für Ihn allein, ohne selbst Ruhm davon zu genießen... 1.4.: Unfähig, auszugehn, wünschte aber, es gehe mir ganz, wie Gott es will. Ich habe es gern, wenn Er handelt genau, wie Er es will, ohne mir den Grund zu sagen... 12.5.: Heute bin ich dreißig. In diesem Alter begann Christus seine öffentliche Wirksamkeit. Jetzt keine Kindereien mehr! Keine Liebe mehr! Keine Gedanken an Ehe mehr! Herr, laß mich jetzt nur an Deinen Willen denken, was Du mir zu tun gebietest! Herr, Dein Wille, Dein Wille! 18.5.: Morgen ist Pfingsten. Ich habe meine ganze Geschichte nachgelesen, eine Geschichte voll schmerzlicher Leiden, voller Fehler und verblendender Eitelkeit. Ich habe um meiner selbst willen nach großen Dingen getrachtet... 21.5.: ... Nun bin ich dreißig ... Nun laß mich nur den Willen Gottes tun, laß mich nicht Großes um meiner selbst willen begehren.« (Woodham-Smith, S. 79—80).
In Alexandria verbrachte sie lange Zeit bei den Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul. Sie rühmt den Fleiß der Vinzentinerinnen bei der Betreuung der Waisen und Kranken: »Es waren nur neunzehn Schwestern da, aber sie schienen die Arbeit von neunzig zu machen.« Die Rückreise ging über Athen, wo sie Schulen und Waisenhäuser besichtigte, Berlin, wo sie Spitäler besuchte, und Kaiserswerth, wo sie zwei Wochen bei der Familie Fliedner wohnte und die Diakonissenanstalt, über die sie schon viel gelesen hatte, endlich persönlich sehen konnte. Sie war von Fliedners Werk so begeistert, daß sie noch auf der Rückreise in Gent ein kleines Buch darüber schrieb, das 1851 in London erschien, natürlich anonym (The Institution of Kaiserswerth on the Rhine for the practical training of deaconesses under the direction of the Rev. Pastor Fliedner, embracing the support and care of a Hospital, Infant and Industrial Schools, and a Female Penitentiary. Printed by the Inmates of the London Ragged Colonial Training School, 1851).
Zu Hause fühlte sie sich wieder frustriert. Wenn sie nur ein Wort von Krankenhäusern wagte, gab es Szenen und hysterische Anfälle. Oft wünschte sie sich tot. Die ständigen Vorwürfe von Seiten ihrer Mutter und ihrer Schwester Parthe lasteten schwer auf ihrem Gewissen. »Was soll aus mir werden?« schreibt die Einunddreißigjährige. »Ich kann kaum den Mund öffnen, ohne der lieben Parthe Verdruß zu bereiten — alles, was ich sage oder tue, ist für sie ein Anlaß zu Ärger.« Von ihrer Mutter schrieb sie in ihr Tagebuch: »O liebe, gute Frau! Wenn ich spüre, wie sehr sie über mich enttäuscht ist, ist es, als sei ich im Begriff, wahnsinnig zu werden. Welch ein Mörder bin ich, daß ich ihr Glück störe! Was bin ich, daß ihr Leben für mich nicht genug ist? Gott, warum kann ich nicht mit diesem Leben zufrieden sein, mit dem so viele Menschen zufrieden sind?«
Nach langen zermürbenden Auseinandersetzungen sah sie ein, daß jeder Versuch, bei ihrer Familie Verständnis für ihre Berufung zu finden, vergeblich sei. »Ich muß mir einiges nehmen«, schrieb sie in ihr Tagebuch, »damit ich leben kann. Ich muß es nehmen, man wird es mir nicht schenken... So lange hat man mich wie ein Kind behandelt, und so lange habe ich es geduldet, daß man mich wie ein Kind behandelte.« Sie setzte es durch, nach Kaiserswerth zu gehen. Aber sie durfte es nur im geheimen tun, niemand aus dem Bekanntenkreis sollte es erfahren. Gern wäre sie mit dem Segen ihrer Mutter gegangen, aber den bekam sie nicht.
Zum zweiten Male weilte Florence Nightingale in Kaiserswerth, diesmal für ein Vierteljahr. Die Gründung Fliedners umfaßte damals (1851) ein Hospital mit hundert Betten, eine Kinderschule, ein Haus für gefallene Mädchen, ein Waisenhaus und eine Normalschule zur Ausbildung von Lehrerinnen. Zur Anstalt gehörten 116 Diakonissinnen, von denen 67 in andere Teile Deutschlands gesandt waren. Die englische Lady teilte mit einfachen Bauern- und Handwerkertöchtern das spartanische Leben, arbeitete und war glücklich. Beim Abschied bat sie Pastor Fliedner um seinen Segen. Als sie zu ihrer Familie wieder zurückkehrte, wurde sie behandelt, als sei sie »gerade aus dem Gefängnis gekommen« oder als habe sie »ein Verbrechen begangen«.
Im Sommer 1852 kam Miss Nightingale durch ihre Sozialarbeit in Berührung mit Manning, dem späteren Kardinal (Henry Edward Manning, 1808—1892. E. S. Purcell, Life of Cardinal Manning, 2 Bde., London 1896), der damals als katholischer Priester in den Slums von Ost-London wirkte. Sie schloß mit ihm bald Freundschaft und wechselte viele, endlos lange Briefe mit ihm. »Wenn Sie wüßten«, schrieb sie, »welche Heimat die katholische Kirche mir sein würde! Alles, was ich wünsche, fände ich in ihr. Alle meine Schwierigkeiten wären beseitigt. Ich muß mühsam hier und da Krumen auflesen, von denen ich lebe; sie gäbe mir tägliches Brot. Die Töchter des heiligen Vinzenz würden mir ihre Arme öffnen.« Und wiederum: »Was für eine Ausbildung gibt es für Frauen in der anglikanischen Kirche, verglichen mit jener der katholischen Nonne? Es gibt nichts, das man mit der Ausbildung vergleichen könnte, welche die Sacré Cœur-Schwestern oder die Vinzentinerinnen Frauen bieten.« Schließlich fragte sie: »Warum kann ich nicht sofort in die katholische Kirche eintreten, die beste Form der Wahrheit, die ich je gekannt? Der gordische Knoten, den ich nicht auflösen kann, wäre durchgehauen.« Aber Manning, sonst Proselytenmacher, riet ihr ab (Woodham-Smith, S. 97—100).
Ihre Freundschaft mit Manning blieb aber ungetrübt. Manning wollte ihre Meinung hören »über die Haltung der Arbeiter zum Christentum«. Durch Kontakte mit Sozialisten und Freidenkern hatte sich Florence ein Bild zu machen versucht über die Ursachen des Unglaubens in der Arbeiterklasse. Sie antwortete: »Die intelligentesten und gewissenhaftesten unter den Arbeitern haben überhaupt keine Religion.« In den Industriestädten seien die Arbeiter meist Atheisten. Damals, im Sommer 1852, begann sie ein Buch zu schreiben, mit dem sie Freidenkern christliche Wahrheiten in neuer Formulierung nahebringen wollte. Aus Gesprächen mit Arbeitern wußte sie, daß man gewisse christliche Vokabeln vermeiden mußte, sonst würde niemand mehr zuhören. Unter dem Titel Anregungen für die Wahrheitssucher unter Englands Handarbeitern erschien das Buch 1860 in drei Bänden als Privatdruck (Suggestions for Thought to the Searchers after Truth among the Artizans of England. Privately printed for Miss Nightingale, 3 Bde., London 1860).
Das Buch enthält unter anderem die religiöse Motivation ihres Tatendrangs. Gott dienen, das heißt für Florence Nightingale: gegen das Böse in der Welt kämpfen. Es habe keinen Zweck, um Verschonung vor Seuche und Pest zu beten, solange man die Kloaken in die Themse laufen lasse. Gottes Wille solle geschehen, aber er geschehe nicht ohne die Arbeit des Menschen.
Manning vermittelte Miss Nightingale Kontakte mit katholischen Schwestern-Konventen in Dublin und Paris. In Dublin besichtigte sie Krankenhäuser; in Paris weilte sie kurze Zeit bei den Barmherzigen Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul, die ein Waisenhaus, eine Kinderbewahranstalt, ein Hospital und ein Pflegeheim für alte kranke Frauen unterhielten. Natürlich waren Florences Mutter und Schwester dagegen, und sie machten auch Szenen, als Florence 1853 das Angebot erhielt, als Oberin das Harley-Street-Hospital zu übernehmen. Der Vorwurf, sie bereite der Familie Schande, und die üblichen hysterischen Anfälle vermochten Florence jetzt nicht mehr festzuhalten. Sie war innerlich frei geworden. Sechzehn Jahre waren seit dem ersten Ruf Gottes vergangen. Acht Jahre Kampf, von dem sie oft gemeint hatte, er werde sie vernichten, hatten sie langsam aber stetig zu einem Charakter gehämmert, der ein Höchstmaß an Sanftmut mit einem stählernen Willen verband. Jetzt war sie imstande, mit tausend Teufeln fertigzuwerden.
In der Hölle des Krimkriegs
Schon in wenigen Monaten führte Florence Nightingale in dem Harley-Street-Hospital etliche Neuerungen durch: Heißwasserleitungen in allen Stockwerken, Speiseaufzüge und ein Läutewerk mit Nummerntafel. Ohne diese technischen Hilfen zur Arbeitseinsparung »würde die Krankenschwester in ein paar Beine verwandelt«. Ferner forderte Miss Nightingale gegen erheblichen Widerstand des Kuratoriums, daß das Krankenhaus nicht nur Angehörigen der anglikanischen Staatskirche offenstehe, sondern Mitgliedern aller Konfessionen, und daß jeder Kranke von dem Geistlichen seiner Glaubensgemeinschaft besucht werden dürfe.
1854 brach der Krimkrieg aus, in dem England und Frankreich Rußlands Griff nach Konstantinopel abwehrten. Mit Empörung lasen die Engländer in The Times mehrere Berichte vom Kriegsschauplatz, in denen auf die Leiden der kranken und verwundeten Soldaten aufmerksam gemacht und festgestellt wurde, daß für die Behandlung der Verwundeten nicht die nötige Vorsorge getroffen worden sei. Es fehle in den britischen Lazaretten an ausgebildetem Personal. Die Franzosen seien mit ihren Feldlazaretten den Engländern weit überlegen. »Ihre medizinischen Einrichtungen sind äußerst gut, ihre Ärzte sind zahlreicher, und außerdem haben sie die Hilfe der Barmherzigen Schwestern... Diese frommen Frauen sind ausgezeichnete Krankenpflegerinnen.« Der englische Nationalstolz bäumte sich wütend auf. Die Times eröffnete eine Spendenaktion für die Verwundeten und Kranken an der Front. Ein Leserbrief in The Times fragte zornig: »Warum haben wir keine Barmherzigen Schwestern?«
Diesen Leserbrief las Sidney Herbert, der Kriegsminister. Es wurmte ihn, daß Privatleute für die Betreuung jener zahlten, die ihr Blut für das Land vergossen hatten. Er schrieb seiner alten Freundin Florence Nightingale einen langen Brief, in dem er sie bat, die Leitung einer Schwesternschar zu übernehmen und mit ihnen die Lazarette in der Türkei zu betreuen. »Sie würden natürlich volle Befehlsgewalt über alle Schwestern haben, und ich denke, ich könnte Sie der vollen Unterstützung und Mitarbeit von seiten der Ärzte versichern, und Sie hätten auch unbeschränkte Vollmacht, die Regierung um alles anzugehen, was Sie für den Erfolg Ihrer Sendung für nötig erachteten.« Der Brief kreuzte sich mit einem Schreiben Florences an Sidney Herbert, in dem sie sich anbot, mit Krankenschwestern auf den Kriegsschauplatz zu gehen.
Innerhalb von vier Tagen stellte Florence die Expedition zusammen. Lady Canning, die ihr dabei half, schrieb: »Sie hat solche Kraft und Geschicklichkeit und ist so sanft, klug und ruhig. Sogar jetzt ist sie in keiner Hetze oder Eile, obwohl sie so viel zu tun hat.« Aus zahllosen Bewerberinnen wählte Florence zehn katholische Schwestern, acht anglikanische Schwestern, sechs Pflegerinnen aus dem St. Johns-Haus, vierzehn Pflegerinnen aus verschiedenen Krankenhäusern, insgesamt 38 Frauen. Mit diesen landete sie nach einer strapazierenden Reise in Skutari, einer Vorstadt von Konstantinopel auf der asiatischen Seite des Bosporus.
Was sie jetzt zu sehen bekam, war die Hölle. Eine riesige baufällige Kaserne, eilig in ein Lazarett verwandelt, empfing sie mit unbeschreiblichem Schmutz. Die Fußböden waren so verfault, daß sie nicht geschrubbt werden konnten; die Wände wimmelten von Ungeziefer. Im Binnenhof stand ein See von Schlamm voller Abfälle, Müll und Kadaver. Aus Kloaken stiegen Giftschwaden hoch, Ventilation gab es nicht. Miss Nightingale hatte in vielen Großstädten Europas die übelsten Slumwohnungen gesehen, aber in einer solchen Luft wie hier war sie nie gewesen. Hier wurden die Verwundeten von den Schlachtfeldern der Krim auf den Fußboden niedergelegt, in ihren zerfetzten, verschmutzten und blutgetränkten Uniformen. In dichten Reihen lagen sie in den Korridoren. Ratten flitzten umher und machten sich an den Bewegungsunfähigen zu schaffen. Es fehlte an allem. Es gab keine Betten, Laken und Hemden, keine Waschbecken, Handtücher und Seife, keine Tabletts, Teller und Bestecke, keine Tragbahren und Schienen, kein Verbandszeug, keine Medikamente. Küche und Wäscherei waren, gelinde gesprochen, unzulänglich.
In diesem Kasernen-Lazarett wurden Miss Nightingale und ihren entsetzten Schwestern Räume zugewiesen, die man in England nicht einmal den anspruchslosen irischen Landarbeitern als Unterkunft anzubieten gewagt hätte. Die Ärzte wollten die Frauen überhaupt nicht an die Kranken und Verwundeten heranlassen, weil es so etwas in der britischen Armee noch nie gegeben hatte: daß Frauen in einem Kriegslazarett Soldaten pflegten. Wochenlang mußte Florence und ihre Schar untätig bleiben, während Hunderte starben, die mit ihrer Hilfe vielleicht hätten gerettet werden können. Trotzdem hatte Florence den strikten Befehl gegeben, keine Schwester dürfe einem Kranken etwas reichen ohne ärztliche Verordnung. Nur so konnte sie das Vertrauen der Ärzte gewinnen, von deren Mitarbeit der Erfolg des Unternehmens abhing. Allmählich sahen die Ärzte ein, daß Miss Nightingale nicht vorhatte, sich in ihren Zuständigkeitsbereich einzumischen. Sie durfte zunächst die Küche reorganisieren, wo es ihr bald gelang, mehr Abwechslung in die Verpflegung zu bringen und zusätzlich stärkende Rationen zu beschaffen. Später stellte sich ihr der französische Küchenchef Alexander Soyer zur Verfügung, der einer ihrer glühendsten Bewunderer wurde und dessen kulinarischem Genie und Organisationsgeschick es gelang, für eine große Zahl von Menschen große Mengen von Essen in bester Form bereitzustellen. Sodann richtete Florence eine Wäscherei ein, damit die Bettwäsche und die Hemden endlich in heißem Wässer gewaschen werden konnten. Es gelang ihr nach einigen Wochen, einige Sauberkeit im Kasernen-Lazarett herzustellen. An dem erschreckenden Zustand der Abortanlagen, der Wasserversorgung und der Abwässer vermochte sie zunächst nichts zu ändern.
Bald konnten die Ärzte nicht umhin, sich der Schwestern als Helferinnen in der Krankenpflege zu bedienen; denn die Lage wurde katastrophal. Massen von Verwundeten wurden aus den Schlachten von Balaklawa und Inkerman eingeliefert. Das Riesengebäude war schon überfüllt. Auf eigene Kosten ließ Florence einen baufälligen Flügel durch 200 Arbeiter instandsetzen und reinigen, so daß für 800 weitere Betten Platz geschaffen war. Die sich durch den ganzen Winter hinziehende Belagerung von Sebastopol brachte Ströme von Soldaten mit Erfrierungen, Cholera und Ruhr. Weihnachten 1854 lagen allein im Kasernen-Lazarett zweieinhalbtausend Mann. Auch die anderen Lazarette in Skutari, um die Florence sich zu kümmern hatte, waren überfüllt. Die Sterblichkeitsziffer war erschreckend hoch: 42%. Im Januar und Februar 1855 starben im Kasernen-Lazarett 2315 Mann. Die meisten erlagen nicht den Wunden oder Krankheiten, mit denen sie eingeliefert worden waren, sondern den Seuchen, die sie sich in diesem furchtbaren Lazarett zugezogen hatten. Bis Anfang 1855 waren auch sieben Ärzte und drei Schwestern gestorben.
Die Lady Superintendent — so lautete Florences Titel — war oft zwanzig Stunden an einem Stück auf den Beinen. Die Soldaten verehrten sie wie eine Heilige. Wenn sie einen Krankensaal betrat, verstummten die Flüche, und es wurde still wie in einer Kirche. Jeden, der niedergedrückt war, heiterte sie durch ihr freundliches Wesen auf. Die schwersten Fälle pflegte sie selbst. Sie blieb bei denen, die im Sterben lagen, denn sie wollte keinen allein sterben lassen. Mehreren Tausend Männern hat sie persönlich das Sterben erleichtert. Nachdem sie nach Anbruch der Dunkelheit mit einer Lampe die sechs Kilometer langen Reihen der Liegenden entlang gegangen war und überall nach dem Rechten gesehen hatte, begann ihre Schreibarbeit: Briefe an Hinterbliebene, Listen, Formulare, Materialanforderungen, offizielle Berichte, außerdem, auf Bitten Sidney Herberts, mehr als dreißig lange Briefe mit einer Fülle detaillierter und sorgfältig ausgedachter Reformvorschläge, manche vom Umfang einer Broschüre — das alles mit eigener Hand bei schlechtem Licht in ihrem ungeheizten Verschlag geschrieben.
Den anfänglichen Widerstand der Ärzte hatte Florence bald durch ihr diplomatisches Geschick und ihren Charme überwunden, und es entwickelte sich unter diesen härtesten Bedingungen eine kameradschaftliche Zusammenarbeit. Nicht so schnell fertig wurde sie mit dem Widerstand sturer Offiziere und schwerfälliger Heeresbeamten. Unter dem schlecht organisierten System der Kommiß-Bürokratie war die Versorgung der Lazarette in Skutari ebenso wie der Krim-Armee zusammengebrochen. In dem Durcheinander von Stellen und Kompetenzen blühte der Stumpfsinn, und die menschliche Unzulänglichkeit feierte Triumphe. Das hätte sie nicht gedacht, daß sie hier erbittert um Nachtgeschirre und Entlausungsmittel kämpfen mußte. Tausend Hemden wurden im Lazarett benötigt, sie waren auch vorhanden, aber niemand wollte sie herausrücken, da keiner seine Zuständigkeit zu überschreiten wagte. Anfang Dezember 1854 kamen 20.000 Pfund Zitronensaft für die Truppen an, aber sie konnten erst im Februar ausgegeben werden. In der gleichen Zeit waren 173.000 Rationen Tee auf Lager, von denen die Soldaten nichts sahen. Warum? Weil es keinen Befehl gab, Zitronensaft und Tee in die Tagesration einzuschließen. Mancher Mangel war durch Dummheit, mancher auch durch Gaunerei verursacht. Ganze Schiffsladungen verschwanden auf rätselhafte Weise. Eine Riesenmenge Stiefel traf ein, von denen kein Paar paßte, da sie alle unmöglich kleine Größen hatten. Kriegsgewinnler in der Heimat machten ein Vermögen, indem sie sonst nicht absetzbare Ausschußware an das Heer verkauften.
Kein Wunder, daß es an den notwendigen Dingen fehlte. Wo die Dienststellen versagten, sprang Miss Nightingale ein. Obwohl ihr vor ihrer Abreise vom Kriegsministerium gesagt worden war, an Medikamenten und Verbandstoff sei alles reichlich vorhanden, hatte sie in Marseille einen großen Vorrat eingekauft. Den konnte sie jetzt gut brauchen. Was sonst fehlte, kaufte sie in Konstantinopel ein: Bettpfannen, Schrubber, Eßbestecke, Badewannen. Sie hatte reichlich Geld zur Verfügung: den Times-Fond, ihr eigenes Einkommen und sogar Geld von der Regierung. So konnte sie die Lazarette ausstatten und obendrein die unzulänglich gekleidete Armee, die über ein Jahr lang Sebastopol belagerte, mit Mänteln versorgen.
Als ob es noch nicht genug gewesen wäre, daß sie sich mit hilflosen Behörden abzuplagen hatte, wurde ihre Arbeit noch erheblich beeinträchtigt durch Unbotmäßigkeit und Zank unter ihren Schwestern. »Ich nehme den Rang eines Brigadegenerals in der Armee ein, weil vierzig britische Frauen, mit denen ich zu tun habe, schwieriger zu behandeln sind als viertausend Mann.« Einige Schwestern, die sich der Disziplin nicht fügten, schickte sie nach Haus. Andere erwiesen sich als unfähig, wieder andere hatten es nur auf Liebeleien abgesehen. Von gewissen vornehmen Pflegerinnen schrieb Florence: »Sie passen besser in den Himmel als in ein Lazarett. Sie schweben wie Engel ohne Hände zwischen Patienten umher und besänftigen ihre Seelen, lassen aber ihre Körper schmutzig und vernachlässigt.« Am Ende des Krieges unterstanden ihr 125 Schwestern; doch oft genug fürchtete sie um den Ruf ihrer Mission. Ihre Hoffnung war gewesen, im Krimkrieg würde es sich erweisen, daß Krankenschwestern unter solchen Umständen Männer pflegen können, und dann wäre ein schweres Vorurteil beseitigt und dem Beruf der Krankenpflegerin in Friedenszeiten eine ehrenvolle Bahn eröffnet. Aber mehr als einmal hatte sie während des Krieges das Gefühl, ihr Unternehmen sei gescheitert.
Dabei hatte sie Ungeheures geleistet. Sie hatte in einem halben Jahr erreicht, daß die schlimmsten Mißstände in den Lazaretten in Skutari beseitigt wurden und die Sterblichkeitsziffer stark zurückging. Nachdem sie in den Lazaretten der Etappe Ordnung geschaffen, unternahm sie drei Reisen auf die Krim, wo sie Truppenverbandsplätze und Feldlazarette inspizierte. Zu Pferd reiste sie von Lazarett zu Lazarett, bis sie am Krimfieber erkrankte. Doch bald machte sie sich wieder an die Arbeit. Sie sah die Soldaten als arme Opfer an, die sie verteidigen und schützen mußte. Deshalb lehrte sie Offiziere und Beamte, die Soldaten nicht mehr wie Vieh, sondern wie Menschen zu behandeln. Sie ließ von England Schreibmaterial, Spiele, Fußbälle und Bücher kommen, richtete Soldatenheime, Lesehallen und Cafés ein und sorgte dafür, daß die Soldaten ihren überschüssigen Wehrsold, statt ihn zu vertrinken, ihren Familien nach Hause schicken konnten.
Das alles hatte Florence Nightingale gegen eine Welt von Widerständen durchgesetzt durch die Gewalt ihrer Sanftmut. Ein Beoachter schrieb von der Krim: »Miss Nightingale ist eine bezaubernde Person, keiner von uns kann sie genügend bewundern. Eine vollendete Frau, die jeden gewinnt und beherrscht. Der gröbste Beamte wird weich beim Klang ihrer feinen Stimme. Alle gehorchen ihren Befehlen sofort.« Ein anderer Mitarbeiter schrieb rückblickend: »Sie war immer ruhig und selbstbeherrscht. Sie war in allem eine vollkommene Dame, nie anmaßend. Ich habe sie nie mit veränderter Stimme sprechen hören.« Eine andere Augenzeugin bestätigt ihre Selbstbeherrschung: »Sie ist so besonders sanft in Stimme, Auftreten und Bewegung, daß man, wenn man in ihrer Nähe ist, die Unbeugsamkeit ihres Charakters nicht spürt.« Florence Nightingale hat in jener Hölle von Grauen, Schikane und Sturheit nie den Kopf verloren. Krach zu schlagen, hatte sie nicht nötig. Als die Wärter sich weigerten, die großen Abortkübel der Kranken zu leeren, pflanzte sie sich stumm neben einem vollen Kübel auf und stand so lange, bis die Kerle beschämt nachgaben.
Obwohl sie gedemütigt, schikaniert und verleumdet wurde, zeigte sie keine Empfindlichkeit bei persönlicher Beleidigung und Bosheiten. An eine Schwesternschülerin, die wegen gekränkter Würde den Dienst aussetzen wollte, schrieb sie: »Glauben Sie vielleicht, ich hätte irgendwo Erfolg gehabt, wenn ich ausgeschlagen, Widerstand geleistet hätte und mich hätte erbittern lassen? Man hat mich nicht in Spitäler hineingelassen, in die mich der Oberkommandierende befohlen hatte, ich mußte bis in die Nacht vor der Tür im Schnee stehn. Man hat mir zehn Tage lang für meine Pflegerinnen die Rationen verweigert. Und am Tag nachher bin ich mit den Beamten, die dies anzettelten, genauso gut Freund gewesen wie vorher und habe alles ignoriert des Werkes wegen.«
Nach dem Friedensschluß im März 1856 ging sie nach Balaklawa und blieb dort, bis im Juli die Lazarette aufgelöst wurden. Erst als der letzte Soldat heimgekehrt war, reiste sie nach Hause. Sie war inzwischen eine Nationalheldin geworden. Die genesenen Heimkehrer hatten allenthalben ihren Ruhm verkündet. Fantasiebilder von ihr und pathetische Lebensbeschreibungen wurden in Massen verbreitet, Schiffe und Rennpferde erhielten ihren Namen, Tausende Mädchen wurden auf den bisher nicht üblichen Namen Florence getauft, die Königin zeichnete sie mit einem eigens für sie geschaffenen Orden aus, Dichter schrieben Gedichte auf sie, und zahllose Volkslieder verherrlichten ihre Taten. Die Regierung wollte sie im Triumph auf einem Kriegsschiff heimholen lassen. Regimenter sollten ihr mit klingendem Spiel entgegenmarschieren, Städte wollten ihr Ovationen darbringen. Um all diesen Ehrungen zu entgehen, reiste Florence allein und inkognito nach England. Ihr erster Weg nach der Landung war zum Kloster der Nonnen von Bermondsey, wo gerade Exerzitien waren. Florence verbrachte einen Tag in Schweigen und Gebet.
Zermürbender Papierkrieg
Man stellt sich Florence Nightingale als Krankenschwester am Krankenbett vor. Aber seit ihrer Rückkehr von der Krim nach England, die restlichen 54 Jahre ihres Lebens, hat sie nie mehr Kranke gepflegt, obwohl sie darin doch ihren Lebensberuf gesehen hatte. Was hatte es gekostet, diesen Lebensberuf zu verwirklichen! Jetzt sollte sie dies alles aufgeben, um fortan gegen dieselbe Bürokratie, der sie in Skutari machtlos gegenübergestanden hatte, einen endlosen, zermürbenden Papierkrieg zu führen.
Florence hatte die Hölle gesehn. »Ich kann es nie vergessen«, schrieb sie immer wieder. Im Krimkrieg waren siebenmal soviel Soldaten an Krankheit gestorben wie an Verletzungen. Durch das unglaublich primitive Gesundheitswesen waren mehr Menschen umgekommen als durch russische Kugeln und Bajonette. »Neuntausend meiner Kinder liegen aus Gründen, die man hätte verhindern können, in ihren vergessenen Gräbern«, schrieb Florence ein Jahr nach dem Ende des Krimkrieges. »Aber ich kann es nie vergessen.« Unter ihren Augen waren Tausende Menschen gestorben als Opfer eines Systems, das immer noch herrschte. Täglich mordete dieses System in den Kasernen und Militärhospitälern Englands ebenso sicher das Leben junger Männer wie in Skutari. Das Blut der Opfer von Skutari schrie »nicht nach Rache, sondern nach Erbarmen mit den noch Lebenden«. Schon gleich nach ihrer Rückkehr von der Krim schrieb Miss Nightingale: »Für jene, die im Dienste ihres Landes gelitten haben und gestorben sind, können wir nichts mehr tun. Sie brauchen unsere Hilfe nicht mehr. Ihr Geist ist bei Gott, der ihn gab. Uns bleibt nur, dafür zu kämpfen, daß ihre Leiden nicht vergeblich waren — aus der Erfahrung zu lernen, damit solche Leiden in Zukunft durch Vorsorge und gute Einrichtungen verringert werden.«
Obwohl von den ungeheuren Strapazen des Krieges noch geschwächt, machte sich Florence sofort an die Arbeit. Nie trat sie in der Offentlichkeit auf, nie hielt sie Reden. Einladungen, Empfänge zu ihren Ehren, Interviews lehnte sie ab. Nur eine Einladung der Königin Viktoria nach Balmoral nahm sie an. Sie kam mehrere Male auf das Schloß, und mehrmals wurde sie von der Königin besucht. Jedesmal hatte sie lange Gespräche mit der Queen, die ganz von ihr bezaubert war. Noch wichtiger war es, den Kriegsminister zu gewinnen. Sidney Herbert war von Lord Panmure abgelöst worden, einem schwerfälligen Mann, der ungern eine Initiative ergriff und dem Florence den Spitznamen »der Büffel« gab. Ihn zu bezaubern, war schier unmöglich, doch Miss Nightingale gelang auch das. Auf ihr Betreiben beantragte er die Bildung einer Königlichen Kommission, die dann auch zustande kam. Sidney Herbert wurde ihr Vorsitzender. Miss Nightingale durfte als Frau nicht Mitglied einer Royal Commission sein, doch bat der Kriegsminister sie um ein Gutachten für diese Kommission. Auch die Dienstanweisung für die Mitglieder der Kommission stammte aus der Feder von Miss Nightingale, und sie wurde vom Minister ohne Änderung angenommen.
Florence selbst hielt sich klugerweise im Hintergrund, aber ihre Freunde in der Kommission und im Ministerium wurden von ihr eingepaukt und waren ihr Mundstück. In kürzester Zeit beschaffte und bearbeitete Florence eine Riesenmenge von Berichten, Statistiken und Vergleichsmaterial aus anderen Ländern. Zum erstenmal in der Geschichte wurden Ernährung und Unterkunft des Soldaten in Friedenszeiten wissenschaftlich untersucht. Die Ergebnisse waren erschütternd. Die Sterblichkeitsziffer unter den jungen Soldaten in den Kasernen war in Friedenszeiten doppelt so hoch wie die in der Zivilbevölkerung; an einigen Orten war sie sogar fünfmal so hoch — obwohl es sich bei den Soldaten um lauter junge, ausgesucht kräftige Männer handelte, die Zivilbevölkerung aber auch Alte, Schwache und Kranke umfaßte. Die Jugend holte sich in den Kasernen den Tod. Es war, schrieb Miss Nightingale, als ob man Jahr für Jahr anderthalbtausend der gesundesten jungen Männer erschösse.
Miss Nightingales Denkschrift (Notes on Matters Affecting the Health, Efficiency, and Hospital Administration of the British Army. Founded Chiefly on the Experience of the Late War. Presented by Request to the Secretary of State for War. Privately printed for Miss Nightingale, London 1858), die auf über tausend eng bedruckten Seiten die skandalösen Zustände enthüllte, ging — natürlich nicht ohne aufregende Hindernisse und Verzögerungen — in die Denkschrift der Kommission ein. Florence verfocht die Ansicht, daß die Erhaltung der Gesundheit durch vorbeugende Maßnahmen ebenso wichtig sei wie die Wiederherstellung der Gesundheit. Es war nicht damit getan, daß die Ubelstände erwiesen und die notwendigen Maßnahmen zu ihrer Abhilfe auf dem Papier dargestellt worden waren. Es galt, die Pläne auch in die Tat umzusetzen. Die Notwendigkeit der Reform war unabweisbar. Doch »der Büffel« lehnte es ab, etwas zu tun.
Jetzt brach Florences Gesundheit zusammen. Schon auf der Krim hatte sie Dysenterie, Rheuma, Krimfieber, Ischias, Ohrenleiden, dauernde Erkältungen und Erschöpfungszustände gehabt. Sie war in einem zerrütteten Zustand nach England zurückgekehrt, hatte dann aber trotz Nervenleiden, Herzattacken und Ohnmachtsanfällen geschuftet wie zehn Mann. Sie hatte zahllose Kasernen und Militärhospitäler besichtigt. Aber jetzt lag sie auf den Tod danieder. Sie erholte sich, aber fortan bis an ihr Ende verbrachte sie ihr Leben auf dem Sofa oder im Bett, und kaum einmal verließ sie ihre Wohnung. Sie litt an Neuralgien, Arthritis, Magen- und Gallenleiden, und jahrelang glaubte man, sie werde jeden Augenblick sterben.
Die Ärzte verschrieben ihr absolute Ruhe. Ihre Familie beschwor sie, sich zu schonen. Sie aber wollte nichts von Ruhe wissen. Sie hatte eine Aufgabe, sie mußte arbeiten, koste es was es wolle. Sie war geradezu besessen von ihrem Auftrag und trieb ihre Mitarbeiter unerbittlich an. Konnte sie nicht mehr zu den Mächtigen gehen, nun wohl, dann mußten die Mächtigen zu dem kranken Fräulein Nightingale kommen und sich von ihr sagen lassen, was sie zu tun hätten und was sie verkehrt gemacht hätten. Und so geschah es auch.
Ihr Wesen wandelte sich. Die Eigenschaften, die ihre Bekannten an ihr früher gerühmt hatten, ihre Geduld, ihr Wohlwollen, ihre außerordentliche Güte und Freundlichkeit, schwanden. Ihr scharfer, durchdringender Geist, ihr eiserner Arbeitswille und ihre Ausdauer traten stärker hervor, und neu hinzu kamen Zorn und Wut, die sich in flammenden Ausbrüchen Luft machten, wenn sie ihr Werk wieder einmal von Borniertheit oder Bosheit behindert sah.
Nach vielen Enttäuschungen schöpfte Florence erneut Hoffnung, als 1859 Sidney Herbert wieder Kriegsminister wurde. Er war ihr alter Freund und seit langem ihr überzeugter Mitstreiter für die Reform. Er übte selbstlose Pflichttreue und hatte feste Grundsätze. Dieser erfahrene Staatsmann schrieb: »Täglich bin ich immer mehr davon überzeugt, daß in der Politik, wie in allem, nichts recht sein kann, das nicht in Einklang steht mit dem Geist des Evangeliums.« Er unterschrieb Verfügungen und Erlasse im Sinne der Gesundheitsreform, doch ihre Ausführung wurde von der sich sträubenden, ständig quertreibenden Ministerialbürokratie vereitelt. Das Dickicht verworrener Kompetenzen ermöglichte es jedem Beamten, Verordnungen von oben mit gutem Gewissen zu sabotieren. Der Verwaltungsapparat erwies sich als Hindernis für die Gesundheitsreform. Wer diese wollte, mußte zuerst das Kriegsministerium reformieren.
Florence Nightingale und Sidney Herbert packten also die Reform des War Office an. Bald aber erhob sich ein neues Hindernis: Sidney Herbert war schwer krank und wurde immer schwächer. Er zwang sich trotzdem zur Arbeit, schaffte es aber nicht. Die Ärzte forderten absolute Ruhe. Florence protestierte: Sie liege seit Jahren auf den Tod und habe trotzdem gearbeitet; ihr Fall beweise, daß die Ärzte zu schwarz sähen. Jetzt, wo es ums Ganze gehe, dürfe Sidney Herbert nicht nachlassen. Unerbittlich trieb sie ihn an, die Reform des Kriegsministeriums zu Ende zu bringen, und Frau Herbert unterstützte sie dabei. Doch Sidney Herbert erlag seinem Leiden. Seine letzten Worte waren: »Die arme Florence ... die arme Florence ... unser gemeinsames Werk unvollendet.«
Florence brach zusammen und lag viele Wochen schwer krank und wie betäubt danieder. In diesem einen Jahr 1861 hatte sie ihre fünf besten Mitarbeiter verloren. Sie haderte mit Gott. Als sie wieder etwas zu Kräften gekommen war, schrieb sie auf Bitten Gladstones eine Würdigung Sidney Herberts: Er sei »der erste Kriegsminister gewesen, der sich ernstlich die Aufgabe gesetzt habe, Menschenleben zu retten« (Army Sanitary Administration and its Reform under the late Lord Herbert, London 1862).
Weiter ging die Arbeit. In einem einzigen Jahr z. B. wurde Miss Nightingale unter anderem beschäftigt mit einer neuen Dienstanweisung für Apotheker, Vorschlägen für die Ausstattung von Militärhospitälern, einem Plan für die Revision der Heeresrationen, Instruktionen für Stabsärzte, Vorschriften für die Behandlung von Gelbfieber und für das Lieferantenwesen in den Kolonien, einem verbesserten Verpflegungsplan für Truppentransportschiffe, Vorschlägen für Stellenbesetzungen in den Militärhospitälern von Netley und Chatham, Anweisungen zur Behandlung von Cholera. Das alles erledigte sie neben der Hauptarbeit für die Verbesserung der Truppenunterkünfte. Sie kümmerte sich um den Bau von Latrinen, Pferdeställen, Kasernen und Lazaretten. Für den Sanitätsdienst des Heeres entwarf sie ein Kostenberechnungssystem, das um 1865 eingeführt wurde und noch achtzig Jahre später in Gebrauch war. 1947 hat ein Parlamentsausschuß mehrere Systeme, die in anderen Abteilungen erst vor wenigen Jahren eingeführt worden waren, als unzulänglich verworfen, dieses eine aber als bewundernswert bezeichnet und sich nach dem Urheber erkundigt. Man bekam die Antwort: »Miss Nightingale.« (Florence Nightingale, Observations on the Evidence Contained in the Stational Reports Submitted to the Royal Commission on the Sanitary State of the Army in India, London 1863.)
Als die Meuterei der Truppen in Indien ausbrach, erklärte sie sich trotz ihres schlechten Gesundheitszustands bereit, sofort dorthin zu reisen und Dienst zu tun. Daran war nun nicht zu denken. Aber ihre Aufmerksamkeit wurde auf das indische Gesundheitswesen gelenkt. Sie begann eine riesige Korrespondenz mit Eingeborenen und Beamten in Indien, forderte von allen Militärstationen in Indien Berichte an und analysierte sie. Das Aktenmaterial über die indischen Verhältnisse, das sie durcharbeitete, umfaßte viele Tonnen von Papier, füllte ein ganzes Zimmer in ihrem Hause und benötigte bei jedem Umzug allein zwei Möbelwagen. Ihr zusammenfassender Bericht war provozierend und sollte es auch sein. Die Todesrate der britischen Truppen in Indien betrug 69 pro mille. Alle zwanzig Monate starb in Indien von jedem Regiment eine Kompanie — nicht an Tropenkrankheiten, sondern an Baumängeln der Kasernen, an Schmutz und schlechtem Wasser. Florence Nightingale wurde eine Expertin für indische Probleme: Bewässerung, Ackerbau, Kanalisation, Transport, Bodenreform und Steuern. Sie versuchte Gesetzgebung, Verwaltung und Personalpolitik zu beeinflussen, manchmal mit Erfolg, manchmal vergeblich.
An Enttäuschung fehlte es ihr nie. Mehrere Male fegte ein plötzlicher Wechsel des Kabinetts ihre schon der Verwirklichung nahegebrachten Pläne zur Seite. Wie oft schrieb sie in Briefen und auf Tagebuchblättern, sie sei »völlig gescheitert«! Schon auf der Krim hatte sie solche Anfälle von Schwermut. Sie sah immer nur das nicht Erreichte, nie die errungenen Erfolge, die doch wahrhaftig beträchtlich waren.
Dank ihrer Bemühungen sank die Sterblichkeit in der Heimatarmee, die 1857 noch 17,5 ‰ betrug, stetig bis auf 2,4 ‰ im Jahre 1911. Ihr Rat wurde gesucht von ausländischen Regierungen, so während des amerikanischen Bürgerkrieges 1862—64 und während des Deutsch-Französischen Krieges von 1870—71 von beiden Seiten. Obwohl sie nie in Indien gewesen, ließen sich neuernannte Gouverneure und Vizekönige von ihr in ihren Amtsbereich einweisen, denn niemand verfügte über eine so umfassende und zugleich detaillierte Kenntnis der indischen Dinge wie Miss Nightingale. Die Army Medical School, die auf ihre Veranlassung hin gegründet worden war und künftige Truppenärzte ausbildete, wurde in Deutschland und Frankreich nachgeahmt. Henri Dunant erklärte 1872: »Obgleich ich als der Gründer des Roten Kreuzes und als Schöpfer der Genfer Konvention bekannt bin, kommt doch alle Ehre der Schaffung der Konvention einer Engländerin zu. Was mich während des Krieges von 1859 dazu brachte, nach Italien (auf das Schlachtfeld von Solferino) zu gehen, war das Werk der Florence Nightingale in der Krim” (Woodham-Smith, S. 510).
Lange hatte Miss Nightingale gemeint, die Zivilkrankenhäuser seien in einem wesentlich besseren Zustand als die Militärhospitäler. Sie war entsetzt, als sie gewahr wurde, daß sie »genauso schlimm oder noch ärger« waren. Auch sie hatten eine viel zu hohe Sterblichkeitsziffer, weil sie die elementarsten Grundsätze der Hygiene mißachteten und eine Menge typischer »Hospitalkrankheiten« hervorriefen, mit denen die Patienten erst nach ihrer Einlieferung angesteckt wurden und die ihren Tod verursachten. Florence war der Meinung: Die Abhilfe dieser Übelstände liegt nicht in Gebet und Selbstaufopferung, sondern in besserer Durchlüftung, größerer Sauberkeit, besserer Entwässerung und besserer Ernährung.
Bald dehnte sich ihre Arbeit auch auf das zivile Gesundheitswesen aus. Sie verfaßte ein Buch über Hospitäler, in dem sie von der Farbe der Krankenzimmerwände bis zur Warmhaltung von Speisen alle zu verbessernden Dinge behandelte (Florence Nightingale, Notes on Hospitals, London 1859; 3rd edition, almost completely rewritten, London 1863). Sie erstattete Gutachten über Krankenhauspläne in Berlin, Lissabon und Holland. Sie kümmerte sich um die Organisation von Wochenpflege, Hebammenschulung, Armenhauskrankenpflege, ländlicher Gesundheitspflege, Hauspflege und der Pflege für arme Wöchnerinnen. Sie schrieb Bemerkungen über Krankenpflege, ein Buch, das viele Auflagen erlebte und ins Deutsche, Französische und Italienische übersetzt wurde (Florence Nightingale, Notes on Nursing: What it is, and what it is not, London 21860; dt.: Leipzig 1861; Ratgeber für Gesundheits- und Krankenpflege, hg. v. Niemeyer, 1878). »Es ist ein Buch von großem Charme, mitfühlend, vernünftig, intim, voll von geistvollen und beißenden Sätzen und im Besitz einer beachtlichen Frische... Man kann es heute noch mit Vergnügen lesen« (Woodham-Smith, S. 338).
Mit den 45.000 Pfund Sterling, welche das englische Volk am Ende des Krimkrieges für sie gesammelt hatte, gründete Florence Nightingale 1860 in London eine Schwestern-Schule, an der künftige Krankenpflegerinnen ihre Berufsausbildung erhielten. Die Schule sollte technisches Können vermitteln und Charaktere bilden. Jedes eintretende Mädchen wurde von Florence persönlich geprüft und weiter beobachtet. Mit den Krankenpflegerinnen, die nach ihrer Ausbildung eine Stelle angetreten hatten, blieb Florence brieflich in Verbindung. Sie hörte nie auf, ihren Schülerinnen die geistliche Natur ihrer Berufung vor Augen zu halten und sie nicht nur zu einem hohen Leistungsstandard anzuspornen, sondern auch zu einem Wandel in der Gegenwart Gottes. Ihre persönliche Fürsorge für die Schülerinnen war rührend. Trat eine Pflegerin eine neue Stelle an, so sandte Florence Blumen dorthin. Kranken Pflegerinnen ließ sie besondere Gerichte zubereiten. Manchmal schickte sie erholungsbedürftige Schwestern auf ihre Kosten an die See oder aufs Land. Schon 1887 hatten alle fünf Erdteile Oberinnen aus der Nightingale-Schule.
Trotz ihrer Erfolge schrieb die Einundsechzigjährige in einem Brief an eine Freundin: »Ich möchte noch ein wenig arbeiten, ein wenig besser arbeiten, bevor ich sterbe.« Nie war sie mit dem Erreichten zufrieden. Selbstgefälliges Ausruhn auf Lorbeeren kannte sie nicht.
Geschäftigkeit und Mystik
Nach dem Tode Sidney Herberts trat Benjamin Jowett (Benjamin Jowett (1817-1893), Life and Letters, ed. by Evelyn Abbott & Lewis Carnpbell, 2 Bde., London 1897) in ihr Leben, dessen Mitgefühl und Verständnis sie gerade damals sehr brauchen konnte. Dieser Professor für Griechisch war einer der beliebtesten Lehrer in Oxford, weil er sich um jeden Studenten ganz persönlich kümmerte und ihm freimütig und liebevoll zugleich seine abzulegenden Charakterfehler sagte. Wer sein Schüler war, wurde sein lebenslanger Freund. Jowett war auch ein gläubiger Theologe und anglikanischer Geistlicher, und er wurde Miss Nightingales bester Vertrauter, ja eine Art Seelenführer (Woodharn-Srnith, S. 351 f., 431 f., 522). Von ihm nahm sie Kritik an. Er allein durfte ihr sagen, sie solle ruhiger werden, sie solle die Welt nicht mit aller Gewalt zu ändern suchen, sie solle nicht dauernd übertreiben, sie solle nicht andere Menschen verachten.
Unter seinem Einfluß vollzog sich bei ihr ein auffallender Wandel. Bisher war sie absolut sicher, daß sie recht handelte; jetzt aber kommen ihr Zweifel. In einem Brief bekennt sie, sie fühle sich wie ein Vampir, der Sidney Herbert das Blut ausgesogen habe. An Jowett schrieb Florence, sie sei demütig und verwirrt. »Sie haben recht in dem, was Sie von mir sagen... Ich will versuchen, Ihre Ratschläge anzunehmen. Ich habe meine überlegene Ruhe vor einigen Jahren verloren.« Wer hätte sie damals nach der Katastrophe von Skutari nicht verloren? Aber so konnte es nicht weitergehen, Florence sah es ein. Ihr Zorn hatte ein Ausmaß angenommen, der ihre Arbeit eher hinderte als vorantrieb. Humorvoll stellte die Siebenundvierzigjährige fest:
»Ich werde ein ganz zahmes Biest, von einer Dame zu reiten oder zu lenken, wie die Roßhändler von ihren boshaftesten Tieren sagen« (Woodham-Smith, S. 502). Die Güte, die sie als junge Frau ausgezeichnet hatte, kam wieder zurück. Ihr Umgang mit Menschen wurde wieder warm und herzlich. Sie brachte es sogar fertig, sich mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, die ihr das Leben so schwer gemacht hatten, zu versöhnen.
Diesem seelischen Wandel entsprach ein körperlicher. Wer sie als Zwanzig- oder Fünfunddreißigjährige kennengelernt hatte und ihre gertenschlanke, hohe Gestalt im Gedächtnis behielt, war erstaunt, sie jetzt als eine stämmige, rundliche Matrone mit breitem, freundlichem Gesicht wiederzusehn. Sie spielte gern mit Kindern und freute sich, wenn junge Leute sie besuchten. Sechs Katzen durften nach Herzenslust in ihrem Zimmer umherwandern, sie hatte ihren Spaß an ihnen, und es störte sie nicht, wenn sich eine ihr bei der Arbeit um den Hals schlang und eine andere ihre Pfoten auf ihren Papieren abdruckte.
Mit Jowett führte sie gern theologische Gespräche. Sie hatte Zweifel, glaubte nicht alles, was die anglikanische Kirche glaubt, der sie ihr Leben lang angehörte. Trotzdem fragte sie ihn eines Tages, ob er ihr einen besonderen Gefallen tun wolle. Ob er nach London käme und ihr, trotz ihrer abweichenden Ansichten, die Eucharistie spenden wolle? Er zögerte nicht.
Florence war in dieser Freundschaft nicht nur die Nehmende. Sie half Jowett bei seinen Predigten, bei der Revision seines Platon-Werkes und bei anderen wissenschaftlichen Arbeiten mit Anregung und Kritik. Sie erteilte ihm besorgte Mahnungen für seine Lebensführung. Und sie war es, die Jowett mit der Mystik bekannt machte. »Miss Nightingale war eine Mystikerin... Wie die heilige Elisabeth von Thüringen war sie eine Verwalterin, und wie die heilige Elisabeth führte sie neben ihrer geschäftigen Aktivität ein verborgenes Leben mystischer Erfahrung« (Woodham-Smith, S. 523).
Sie hatte zwei katholische Mystikerinnen kennen und lieben gelernt. Madre Santa Colomba in Rom und Reverend Mother Bermondsey in Skutari. Beide Ordensfrauen waren zugleich hervorragende Organisatoren und glühende mystische Seelen. Daß mystisches Leben und Geschäftstüchtigkeit sich nicht ausschließen müssen, fand Florence auch in den klassischen Büchern der Mystik bestätigt. Seit ihrem 28. Lebensjahre las sie regelmäßig die katholischen Mystiker, besonders Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Angela von Foligno und Juliana von Norwich [1].
Unter Florence Nightingales Papieren finden sich zahllose geistliche Betrachtungen, die sie viele Jahre hindurch aufgezeichnet hat. Meditationen in der Sprache der Mystik über das Einwohnen Gottes in der Seele. Da lesen wir etwa: »Religion ist nicht Andacht, sondern Arbeit und Leiden aus Liebe zu Gott.« — »Wir können nur durch Ihn handeln und sprechen und denken. Was wir nötig haben, ist die Entdeckung jener Gesetze, die uns in den Stand setzen, stets in bewußter Übereinstimmung mit Ihm zu handeln und zu denken... Es wird keinen Himmel geben, wenn wir ihn nicht machen. Und es ist eine sehr kümmerliche Theodizee, die uns lehrt, daß wir uns nicht für diese Welt bereiten sollen, sondern für eine andere. Müssen wir Gott nicht schon hier ‘besitzen’, wenn wir Ihn im Jenseits ‘besitzen’ wollen?« — »Gott, du weißt, daß ich durch all diese schrecklichen zwanzig Jahre von dem Glauben unterstützt wurde, daß ich mit dir arbeite, der du jeden zur Vollkommenheit führst, auch unsere armen Schwestern« (Woodham-Smith, S 524—526, 529 f.)
Mit Mother Bermondsey führte Florence einen umfangreichen Briefwechsel über das mystische Leben. Nach 1872 machte sie Auszüge aus den Schriften der mittelalterlichen Mystiker und sandte sie Jowett, der zunächst nichts von diesen Dingen, die ihm nicht lagen, wissen wollte. Aber allmählich bekehrte sie ihn. Sie begann, eine Anthologie aus Texten der mittelalterlichen Mystiker zusammenzustellen, die sie selbst übersetzte. »Miss Nightingale hat ihr Buch über die Mystiker nie beendet; aber sie tat etwas viel Besseres: Sie lebte es« (Sir Edward Cook, The Life of Florence Nightingale, 2 Bde., London 1913). Ihren Schwesternschülerinnen suchte sie nahezubringen, daß Krankenschwester eine religiöse Berufung sei und heiligen Eifer erfordere; Routine genüge nicht. Um ihnen Vorbilder zu zeigen, suchte sie in der Geschichte der Heiligen nach vorbildlichen Gestalten, die in der Caritas gewirkt hatten. Das lebendige Vorbild war sie selbst, die ihre Aufgabe als Gottes Willen ergriff und sich im Dienste ihrer Sendung verzehrte.
Als ihr Freund General Gordon, dessen pietistische Art der Frömmigkeit ihr nicht behagte, dessen heiligmäßiges Leben sie aber bewunderte, in Khartum besiegt und ermordet worden war, schrieb Florence in einem Brief von dem Glauben, den sie mit Gordon teilte. Leiden, Enttäuschungen, Mangel an Erfolg — das sei der Tribut, den Gott zu zollen das größte Privileg der Seele sei. Gordons Tod zeige »den Triumph des Scheiterns, den Sieg des Kreuzes« [2].
Als die Zeitungen 1907 meldeten, daß Miss Nightingale als erste Frau den Order of Merit, Englands höchste Auszeichnung, erhalten habe, waren die meisten überrascht; sie dachten, sie sei schon vor einem halben Jahrhundert verstorben. So sehr war ihre bahnbrechende Arbeit im Dienste der Menschheit im Verborgenen geschehn. Aus aller Welt regnete es jetzt Auszeichnungen auf sie herab. Von diesen Ehrungen hat sie nichts mehr wahrgenommen, denn seit 1901 war sie blind und meistens geistig abwesend. Erst 1910 starb sie, neunzig Jahre alt. [3]
Anmerkungen:
[1] Über Angela von Foligno (1248—1309): Ulrich Köpf, Angela von Foligno, in: Religiöse Frauenbewegung und mystische Frömmigkeit im Mittelalter, hg. v. Peter Dinzelbacher, Köln—Wien 1988, S. 225—250. Über Juliana von Norwich (1342—1416): Gisbert Kranz, Europas christliche Literatur von 500 bis 1500, München 21988, S. 357—365, 486.
[2] Woodham-Smith, S. 553—556. Über General Charles George Gordon (1833— 1885): A. Nutting, Gordon of Khartum, New York 1966; Giles Lytton Strachey, Eminent Victorians, London 1918 (dieses Buch verhöhnt das Christentum in vier Persönlichkeiten: neben General Gordon auch Kardinal Manning und Florence Nightingale. Jerôme von Gebsattel, Kindlers Literatur-Lexikon im dtv, Bd. 8, München 1974, S. 3080, urteilt mit Recht: »Gordon hat mehr Anspruch auf Mitleid als auf Verachtung, und Florence Nightingales Kampf ist nach wie vor als heldenhaft zu bezeichnen.«).
[3] A bio-bibliography of Florence Nightingale, ed. by W. J. Bishop & S. Goldie, London 1962; Florence Nightingale‘s Indian Letters. A glimpse into the agitation for tenancy reform, Bengal 1878—1882, ed. by Priyaranjan Sen, Calcutta 1937.
Personen
(Auswahl)
Lewis C. S.
Malagrida G.
Marescotti J.
Manning H. E.
Marillac L.
Maritain J.
Martin Konrad
Massaja G.
Meier H.
Mieth Dietmar
Mixa Walter
Mogrovejo T.A.
Moltke H. v.
Montalembert
Montecorvino J.
Moreno E.
Moreno G. G.
Mosebach M.
Müller Max
Muttathu-padathu
Nies F. X.
Nightingale F.
Pandosy C.
Paschalis II.
Pieper Josef
Pignatelli G.
Pius XI.
Postel M. M.
Poullart C. F.
Prat M. M.
Prümm Karl
Pruner J. E.
Quidort
Radecki S. v.
Ragueneau P.
Rahner K.
Ratzinger J.
Reinbold W.
Répin G.
Rippertschwand
Rudigier F. J.
Ruysbroek
Salvi Lorenzo
Sanjurjo D. S.
Saventhem E.
Schamoni W.
Schreiber St.
Schynse A.
Sierro C.
Silvestrelli C.
Simonis W.
Solanus
Solminihac A.
Spaemann C.
Spaemann R.
Stein Karl vom
Steiner Agnes
Sterckx E.
Stern Paul
Stolberg F. L.
Talbot Matt
Therese
Thun Leo G.
Tolkien J.R.R.
Tournon Ch.
Vénard Th.
Vermehren I.
Vianney J. M.
Walker K.
Wasmann E.
Waugh E.
Wimmer B.
Windthorst L.
Wittmann G. M.
Wurmbrand R.
Xaver Franz







