zur katholischen Geisteswelt
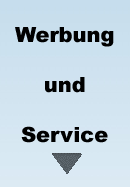
|
Zum
Inhalts- verzeichnis |
|
Zum
Rezensions- bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im biographischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
Datenschutzerklärung
|
Zum philosophischen Bereich
|
|
Zum
liturgischen Bereich |
Personen
(Auswahl)
Albert d. Große
Allouez C.
Amadeus v. L.
Auden W. H.
Bacon Francis
Bain James
Balmes J.
Barón R.
Barbarigo G. Baronius C.
Basset J.
Bataillon P. M.
Bélanger Dina
Bellarmin R.
Benninghaus A.
Benno v. M.
Bernanos G.
Billot Louis
Billuart C. R.
Bobola A.
Böhm D.
Borghero F.
Borja Franz v.
Boscardin B.
Brendan
Brisson L.
Bryson Jennifer
Calvin J.
Capestrano J.
Capitanio B.
Cassian v. N.
Castro A. de
Chambon M.M.
Chaumonot
Claret A.M.
Cornacchiola B.
Crockett Clare
Dawkins R.
Deku Henry
Delp Alfred
Döblin Alfred
Döring H.
Duns Scotus
Ebner F.
Eltz Sophie zu
Ferrero
Ferretti G.
Fesch Jacques
Flatten Heinrich
Focherini O.
Gallitzin A.v.
Geach P. T.
Gerlich M.
Green Julien
Haecker Th.
Hasenhüttl G.
H. d. Seefahrer
Hengelbrock W.
Hildebrand D. v.
Hochhuth Rolf
Höffner Joseph
Hönisch A.
Homolka W.
Hopkins G. M.
Husserl E.
Ignatius v. L.
Innozenz XI.
Jakob Max
Janssen A.
Jogues Isaak
Jones David
Jörgensen J.
Kaltenbrunner
Knox R. A.
Konrad I.
Kornmann R.
Kutschera U.
Lamy J. E.
Laurentius v. B.
Le Fort G. v.
Lehmann Karl
Leisner Karl
G. K. Chesterton
Von Carl Christian Bry
Es handelt sich bei diesem Text um einen Artikel, der in der von Karl Muth herausgegebenen Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und Kunst Hochland erschienen ist, Viertes Heft 1922/23. Carl Christian Bry (1892-1926), Verfasser von Verkappte Religionen. Kritik des kollektiven Wahns, war einer der frühesten Kritiker Hitlers.
And a voice valedictory . . . Who is for victory?
Who is for Liberty? Who goes home?
The Flying Inn
1
Was er will
Tauchnitz stellt Chestertons Bücher unter die Humorous and Satirical Works. Einer der bekanntesten deutschen Anglisten sagte mir, Chesterton schreibe den ‚größten und geistreichstes Blödsinn‘, den er der, der Anglist, zeitlebens angetroffen. Kellners Englische Literatur der neuesten Zeit spaltet in einem etwas zaghaften Hiebe von acht Zeilen unseren Autor in einen ‚schriftstellerischen Clown‘ und in einen ‚Dichter‘, Tonquédec, in dessen kleiner Monografie (Paris 1920, Nouvelle librairie nationale) Chesterton mit dem Prädikat ‚Im ganzen gut‘ wegkommt, bleibt zuletzt doch die Frage, ob nicht die Weinflasche auf seine Arbeit unmittelbaren Einfluss hat.
Niedergeschlagen durch diese Autoritäten, wandte ich mich an Bekannte, die z. B. Shaw hochschätzen, was sie denn von dem Gegenpol, von Chesterton, wüssten? ‚O ja, das ist doch der Mann mit dem Märchen und Riesen‘, sagte der eine. ‚Chesterton‘, rief der zweite, ‚ist das nicht der irische Salonkatholik?‘ Der dritte hatte einen glänzenden Anarchistenroman ‚mit den Wochentagen‘ gelesen; und der letzte war etwas verletzt, dass ich ihm zutraue, ‚er werde Chestertons Paradoxe nicht genossen haben‘. – Ja: Berühmt sein heißt manchmal wirklich von denen gekannt sein, die einen nicht kennen. [1]
Der Widerspruch, der überall um unseren Autor lagert, kommt manchmal selbst in Äußerlichkeiten zutage. Für diese Arbeit erbat ich die deutsche Ausgabe von Chestertons Detektivgeschichten. Die Detektivgeschichten kamen; eingewickelt in schöne, zweifarbig gedruckte Ausfallbogen eines Gebetbuches.
Zwar versichern uns Chestertons Übersetzer, er sei mehr als ein Witzbold. Aber ihre Begründung wirkt etwas engbrüstig. Chesterton wolle die Detektivgeschichte erhöhen und verfeinern? Zugegeben. Es gibt größere Ziele. Er sei eine große, ethische Energie, einsam und verehrungswürdig? Aber wo sitzt die ethische Energie eines Mannes, der ausgerechnet in Verbrechergeschichten religiöse Fragen erörtert und der in seine Verteidigung christlicher Grundtugenden beinahe mit Wollust weiße Elefanten, blaue Tiger und Einhörner hineinspazieren lässt? Chestertons Selbstverteidigungen können erst recht zum Beweis seiner Clownerie dienen. Macht er doch würdigen, wohlmeinenden Männern, die ihn ob seiner Witze angreifen, ganz einfach den Vorwurf, dass sie nicht fröhlich sind und nicht tanzen.
Ist nicht der ganze Mann aus lauter Sprüngen, Rissen und Widersprüchen zusammengesetzt? Er verfolgt mit Spott und Hohn Aristokratie, Reformer jeder Spielart, Hygiene, Militarismus, Amor fati, Parlamente, Mystagogen jeder Gattung, Übermenschen, Determinismus und vieles andere. Er ficht begeistert für Katholizismus, Krieg, Klatsch, konzentrierten Alkohol, Demokratie, Demut, Theatralik, Mittelalter, gutes Essen, Sensationsjournalismus, Kneipenlust und körperliche Unsauberkeit. Nimmt man hinzu, dass dieser lärmende Ausrufer des Katholizismus laut Tonquédec n’a pas fait sa soumission sous l’eglise [2], und dass seine Bücher stilistisch eine Achterbahn mit wilden Überraschungen sind, so scheint die ethische Energie und die Einheit des Autors nur noch durch ein Zauberkunststück festzustellen.
Und der Kern in diesem Wirbel verschwindet überhaupt, wenn man wie Tonquédec, der in Chesterton eine Art Bundesbruder der Restaurationsbestrebungen des Daudetkreises sieht, an den Autor gleich heran tritt mit zerlegender Kritik. Man behält dann nur etwa die obgenannten Zu- und Abneigungen Chestertons übrig. Der Franzose folgt denn auch Chesterton so wenig, dass er es wagt, ihm in einigen Punkten, die in sein eigenes Programm passen, begeisterte Lobsprüche zu spenden, und andere, wie z. B. die Demokratie Chestertons, als naive Velleitäten abzutun.
Dieses Teils-Teils geht Chesterton gegenüber nicht an. Meist ist ja die Einheit des Kritisierten erst Kritikererschleichnis. Gerade Chestertons Arbeiten darf man aber keine dieser bedenklichen nachträglichen Synthesen unterlegen. Denn an Chestertons Anfang steht Synopsis, ganz natürliches Zusammensehen. Bekäme er einen Verlagsauftrag auf ein mathematisches oder astronomisches Lehrbuch, so würde auch in ihnen seine Grundeinsicht jedes Wort durchdringen. Kennt man diese Grundeinsicht, dann versteht man plötzlich jedes Wort bei ihm und begreift mit seinen Vorzügen auch seine Mängel. Denn beide haben dieselbe Ursache.
Der ganze Mann ist besessen von der Wahrheit, dass diese Welt nicht, wie es heute den Anschein hat, ein Kampfplatz ist für alle möglichen und noch mehr unmöglichen ‚Bewegungen‘, sondern ein Wohnplatz für Menschen, für Mann, Frau und Kind. In der Mitte seines Fühlens und Denkens stehen nicht Ismen, Ionen und Parteien; nicht einmal, wie man bei einem so kriegerischen Katholiken vermuten könnte, Religionen und Bekenntnisse. In der Mitte steht ihm immer der Mensch.
‚Der Mensch in der Mitte‘, ‚Der Mensch ist gut‘, versichern uns auch andere Leute. Der moderne Gedanke meint aber gar nicht, dass der Mensch das wichtigste, und dass er gut sei. Er spricht bloß (in einem Dutzend wechslerischer Formen, denen hilflose Kritik das Kompliment ‚Chaotisch‘ macht) die bescheidene Hoffnung aus, dass der Mensch eines Tages gut sein werde – wenn nämlich, diese alte Welt erst einer neuen gewichen, die alten Einrichtungen beseitigt, neue zu Raum gekommen seien. Erst wenn die neue Welt und der neue Mensch sich vollendet hätten, werde das rechte, gute, strahlende, wirklich menschliche und menschenwürdige Leben anfangen; erst dann werde der Mensch wirklich in der Mitte stehen.
Chestertons Werk ist nun weiter nichts, als eine einzige Verkündigung der Tatsache, dass dieses rechte, gute, strahlende, wirklich menschliche und menschenwürdige Leben immer da war und da ist – da ist, ohne dass Worte darum gemacht würden, ohne dass es eines neuen unerhörten Antriebes bedürfte. Die Kehrseite davon ist, dass das verzweifelte Streben nach einer neuen Welt und neuen Menschen den alten Menschen aus Haut, Heim und Seele treibt. Dieser Kehrseite gilt Chestertons gesamter, unendlich vielfältiger Angriff: Der einzige sichere Erfolg des neuen Menschen ist die Austreibung des Menschen aus seiner Menschlichkeit, aus allem, woran er hängt und worin er webt und lebt; das einzige gewisse Ergebnis der neuen Welt ist, dass die Welt freudlos, unbequem, kalt, unheimlich, unbewohnbar wird.
Nun vergleiche der Leser die scheinbar so widerhaarige Liste von Chestertons Zu- und Abneigungen. Stolz und Verschlossenheit, verlogene, sich selbst belügende Verliebtheit ins eigene ‚Schicksal‘, Reformen aller Art, Geheimrezepte zur Welterlösung, bewusste Gesundheitspflege, Verbot starker Getränke, Vorsicht im Essen, allumspannende Organisation, Übermenschen: das sind wenigstens einige – Chesterton kritisiert weit zahlreichere – Bestandteile der ‚neuen Welten‘, mit deren Plänen und Entwürfen unsere geplagte Menschheit und Menschlichkeit sich bewundernd malträtieren lässt. Raufen, militärische Ehre und Soldatenruhm, Frömmigkeit, selbst Aberglaube, Geschwätz, sentimentale Theatralik, bei Tisch herzhaft einhauen, trinken und rauchen, seine kostbare Gesundheit nicht in acht nehmen und in abenteuerlichen, romantischen, schundigen Schwarten schmökern – kurz in einem Durcheinander hausen: das alles ist die natürliche Welt, der natürliche Mensch. Ihm gilt Chestertons ganze Zuneigung: dem ‚bierdurstigen, religionsstiftenden, kämpfenden, unterliegenden, sinnlichen und respektablen Menschen‘, der ‚schreienden, fechtenden, trinkenden Menschenliebe‘. –
Schade, dass diese Vorrede so lang geworden ist. Denn nun erst, nachdem der (nach Tonquédec) ‚rätselhafteste der Schriftsteller‘ und seinen Hauptrösselsprung gelöst hat, stoßen wir auf seine eigentliche Leistung.
Mit jedem Tage treten ja heute mehr Menschen und Bücher hervor, die uns versichern und anflehen, dass wir auf falschem und tödlichem Weg sind; dass Organisation unsere Seele mordet; dass wir durch Cupiditas rerum novarum Länder und Reiche zerstören: dass auch der denkbar beste Enderfolg das Wagnis nicht lohne; dass sich jeder von uns doch wieder bescheiden möge mit dem, was er ist und hat; und dass wir doch, trotz aller Müh‘ und Plage, als ‚alte Menschen‘ bequemer und friedlicher leben könnten als auf der ewigen Jagd nach dem neuen; kurz, dass das sichere Alte doch dem riskanten Neuen vorzuziehen sei. Die Leute, die so klagen und predigen, haben in der Sache recht – mehr recht, als sie oft sich selber zuzugeben wagen – nicht in den Gründen. Die größeren und tieferen unter ihnen werden flugs auch zu Reformern. Sie lehnen den sozialistischen neuen Menschen ab, um sich dem Nietzscheschen neuen Menschen an die Brust zu werfen. Wenn sie den Zwang der sozialistischen neuen Welt bekämpfen, so flüchten sie sich in den noch viel grauenhafteren Zwang einer neuen Welt überlegter Rassezüchtung. Ihnen gilt deshalb Chestertons Kritik ebenso wie den Fortschrittlern.
Noch weniger überzeugend wirken die, die uns gutgläubig und unbewusst Umkehr zugunsten ihres Bankkontos und ihrer Stellung predigen. Als ängstliche Konservative möchten sie bremsen, erhalten, retten, was zu retten ist. Sie selbst sehen ihre Niederlage als sicher, mindestens als wahrscheinlich an und bemühen sich nur, den Ausgang der Schlacht hinauszuziehen. Wenn es aber sicher ist, dass Neues, Anderes mit Gewalt und unaufhaltsam über uns kommen muss, werden sich gerade die Unternehmendsten und Mutigsten, auch wenn ihnen die alte Welt teuer, die neue fragwürdig scheint, immer sagen: Geschlagen werden – ja! Aber sich stemmen, ängstlich abwehren – nie! Dann schon lieber mit Kopfsprung mitten ins Neue hinein und gesehen, ob es wirklich so fürchterlich und menschenfeindlich ist. – Die Tieferen unter den Predigern der Umkehr gewinnen keinen Boden, weil sie den Menschen gründlicher aus seiner Haut treiben wollen, als selbst die Männer des Fortschritts; die oberflächlicheren verlieren ständig Boden, weil sie an einen Sieg ihres eigenen Gedankens nicht oder nicht mehr glauben, weil sie zaghaft sind.
Zaghaftigkeit nun ist gerade das, was selbst der schärfste Kritikus Chesterton nicht vorwerfen kann. Sehr häufig kommt bei ihm das Wort ‚Verteidigung‘ vor. Aber der Ausdruck führt irre. Sieht doch Chesterton im Durchschnittsmenschen nichts, was zu verteidigen, zu behüten und zu bewahren wäre um des Heiles der Welt, um unserer Zukunft oder sonst einer großen Sache willen. Er verteidigt nicht den Normalmenschen, nein, er verherrlicht ihn: als ein Wesen, das nicht für die Welt, sondern für das die Welt da ist, zu seiner eigenen Plage und Freude. Für Chesterton ist der Durchschnittsmensch der Mensch überhaupt: voll von Spannkraft und Schlagkraft, immer bereit, der Fahne zu folgen und sich einzulassen in Kampf, Fährlichkeiten und Abenteuer, nicht aus Begierde nach einer neuen Welt, sondern aus dem Trieb seiner unbedachten, unüberlegten Natur – und gerade in dieser Unbedachtheit erst ganz Mensch, erhaben und schwach zugleich.
Diese Art unbedachtes, durcheinanderquirlendes, sich balgendes, krakeelendes Menschentum findet Chesterton etwa im Mittelalter ebenso wie in der wirbelnden Volksmasse der französischen Revolution, die dem Mittelalter den Kehraus blies. Derartige Weitherzigkeit mag im ersten Augenblick noch manchen so verblüffen, wie sie Tonquédec verblüfft hat. Fühlt man aber erst, worauf es bei Chesterton ankommt, so bestätigt gerade der scheinbare Widerspruch, dass Chesterton nicht einer von den viel zu vielen ist, die in den Wirrwarr von Bewegungen noch eine neue – ihre eigene – einschmuggeln möchten, sondern dass es sich bei ihm tatsächlich ohne Vorbehalt und Hintergedanken um die Grundfrage alles Lebens und Zusammenlebens handelt. Chestertons Bücher sind voll von Antworten, nein, sie sind eine einzige große Antwort auf die Frage, die heute in Europa durch Krampf, Kampf und Revolution, durch Zeitungsartikel, volkswirtschaftliche und pädagogische Werke nicht etwa schon ausgefochten, nein, erst langsam erkannt und herausgearbeitet wird – auf die Frage: wie soll der Mensch beschaffen sein? Was ist dem Menschen bekömmlich, und was bekommt ihm schlecht?
Aber steht Chesterton mit der letzten Frage nicht doch bei denen, die aus Schwäche das Alte zu erhalten suchen? Nein. Seine Begründung ist genau entgegengesetzt. Einem dieser furchtsamen Konservativen, dem wie Tonquédec seine Tendenz sympathisch war, sein Ton aber auf die Nerven ging, hat Chesterton erwidert: “... so glaubt er, dass ich mit dem Schwinden des religiösen Gefühls eine zunehmende Sinnlichkeit befürchte; ganz im Gegenteil bin ich geneigt, eine Abnahme der Sinnlichkeit zu prophezeien, weil ich eine Abnahme der Vitalität befürchte. Ich glaube nicht, dass der Materialismus unseres Westens die Anarchie heraufbeschwören wird. Ich frage mich, ob wir genug Lebensmut und Kraft besitzen werden, um uns Freiheit zu verschaffen. Es ist ein ganz altmodischer Irrtum, zu glauben, dass wir den Skeptizismus verdammen, weil die Zucht durch ihn verdrängt wird; wir verdammen ihn, weil er des Lebens Triebkraft untergräbt.”
"Weil er des Lebens Triebkraft untergräbt!" Kürzer lässt sich wohl kaum ausdrücken, was Gilbert Keith Chesterton, den reaktionären Revolutionär, den rebellischen Reaktionsmann, von den wohlmeinenden, aber schwächlichen Leuten scheidet, die sich nur an das Alte anklammern.
2
Was er schreibt
Hier liegt auch ein Grund, und zwar gleich ein widerspruchsvoller Doppelgrund für seine berühmten und berüchtigten Paradore. Fürs erste leben wir alle heute in einer Welt, die im ursprünglichen wie im gewöhnlichen Sinne des Wortes verrückt ist, und in der das Normale und Durchschnittliche, an dem Chestertons Herz hängt, ganz von selbst außergewöhnlich wirkt. Zum zweiten muss ein Mann, der den Mut hat, zu sagen, dass zweimal zwei gleich vier ist, wohl überraschende rhetorische Mittel brauchen, damit nicht seine vorurteilsvollen Zuhörer ihm nach den ersten Worten durchgehen.
Natürlich hat Chesterton Mutterwitz mit allen seinen Gefahren. Wie jeder, der seiner Sache sicher, seines Wortes Meister ist, lässt er sich hinreißen vom Einfall und vom Wort. Für alle Schriftsteller von persönlicher und schwieriger Schreibweise, ob für Kant oder für Shaw, gilt dieselbe Leseregel – auch für Chesterton. Man muss diesen ‚geistreichsten lebenden Schriftsteller Europas‘ lesen wie eine Kinderfibel: zunächst nichts dahinter suchen, alles so nehmen, wie es dasteht und – alles ernst nehmen.
Das wird allerdings erschwert durch die unzureichende Art der deutschen Chestertonübersetzungen und durch das eigentümliche literarische und verlegerische Schicksal Chestertons in Deutschland. Man darf umso ruhiger zugeben, dass es ihm bei uns allzu gut nicht gegangen ist, da es ihm in seinem eigenen Lande und im verbündeten Frankreich womöglich noch schlechter gegangen ist. Verwunderlich allerdings bleibt es, dass Deutschland einen Mann von Chestertons Energie nicht erkannt hat. Denn wenn wir schon nicht mehr das Volk der Dichter und Denker sind, so haben wir doch in den letzten Jahrzehnten den allerdings noch misslicheren Ruhm erworben, das Volk der besten Versteher und Verkünder zu sein.
Der Mann, der Donnerstag war, das erste Buch Chestertons, das deutsch erschienen, hatte das Unglück, Heinrich Lautensack in die Hände zu fallen. Seine Übersetzungskunst bestand zum guten Teil darin, möglichst nach jedem Beiwort einen Punkt zu setzen, während Chestertons Satzbau, schon wegen der fortwährenden, scharf ausgearbeiteten Gegensatzpaare, beinahe pedantisch ist. Das ohnehin schwer zu ergründende Buch wirkt in der Übertragung wie die Titelei zu einem amerikanischen Großfilm.
Kritische Werke von Chesterton hat gleichzeitig oder kurz danach Franz Blei übertragen oder übertragen lassen. Diese Übertragungen sind besser. Mit Glück, obgleich noch ohne festen Entschluss, ist häufig versucht, die lokal englischen Bilder Chestertons durch lokal deutsche zu ersetzen. Vor allem bleibt dem Chestertonschen Wort auch im Deutschen sein Doppelton, seine Fernschau vom Gewöhnlichen ins Höchste bewahrt.
Dennoch liegt auch um diese Übertragungen eine Luft, die Chesterton fremd, wenn nicht feindlich ist. Man hat vor ihnen allzu oft die Empfindung, sie könnten entstanden sein etwa aus der Überlegung: welch einzigartiger Fall! Hier ist ein in Deutschland nahezu Unbekannter, der sämtliche Mittel heutigen Schrifttums verblüffender und wirksamer beherrscht als die meisten anderen Zeitgenossen, und der doch – wie merkwürdig! – in allem anderer Meinung ist. Zudem ist er – wie fesselnd! – noch ein feuriger Katholik. Vielleicht finden seine Bücher (wie Blei es für die Heretiker hofft) "viele neue Freunde im Lager der Gegner". Worauf sich aus Chestertonscher Anschauung nur erwidern lässt, dass das der Welt nichts nützt, sondern schadet – solange die freundlichen Gegner nämlich Gegner bleiben. Kurz, auch diesen Übertragungen scheint es noch nicht völlig ernst um Chestertons Sache.
Anders herum sündigt die bisher letzte Chestertonübersetzung, die der Innocence of Father Brown. Behandelt Franz Blei den Autor als ein esoterisches Stück moderner Literatur für ganz kleine Kreise, so drückt ihn Frau von Lama, abgesehen von wirklichen, manchmal absichtlichen Schnitzern und von Sprachsteifheit, um ein halbes Dutzend literarischer Stufen herab. Schwer verständlich, weshalb der ganz klare englische Titel in die klobige Aufschrift ‚Priester und Detektiv‘ (Pustet-Regensburg) verwandelt wurde, die dazu noch den Anschein erweckt, als seien hier beide Antagonisten. Gewiss war der Gedanke glücklich, uns gerade dieses zugänglichste, spannendste Buch Chestertons näher zu bringen und für einen großen Leserkreis auch einen starken Anreiz zu schaffen. Doch sollte es dazu nicht genügt haben, unter den richtigen deutschen Titel ‚Die Einfalt des Vaters Brown‘ zwar in freier Hinzufügung, aber doch Chestertonscher Denk- und Sprechweise einigermaßen nahe, einfach den Untertitel zu setzen: "Ein Dutzend Detektivgeschichten"?
Auch das äußere Gewand stört und verzerrt. Haben die Detektivgeschichten (auch in der englischen Ausgabe) ein Buchumschlagbild, das die Ansprüche des Lesers noch weiter herabzusetzen geeignet ist, so machen die deutschen Ausgaben anderer Bücher Chestertons (bei Hans v. Weber und Georg Müller) schon von außen durch Umschlag, Type, Spiegel den Eindruck, nur für Kenner, für Literaten zu sein. Auch Bücher sind Lebewesen. Man kann ihnen nicht jedes Kleid anziehen, ohne sie und ihre Wirkung zu gefährden. Wer Chesterton wirklich in sich aufnehmen will, ist deshalb bis heute auf Tauchnitz angewiesen, der zwar nur vier, darunter aber drei der kräftigsten Bücher des Autors hat; Bücher, die – um ein Wort Shaws abzuwandeln – die Welt ändern könnten, wenn man die Leute dazu bringen könnte, sie zu lesen und – ernst zu nehmen.
Die Orthodoxie allerdings, Chestertons Zentralwerk, ist nicht bei Tauchnitz. In der deutschen Ausgabe wird sie auf nicht ganz wenigen Kolumnen zu einem schwer lesbaren, jedenfalls nicht anlockenden Buchstabenbandwurm. Von der Orthodoxie müsste einmal eine deutsche Taschenausgabe aufgelegt werden: in Kleinoktav, ja vielleicht in Duodez, auf Dünndruck, mit wenig Text auf der Seite, biegsam gebunden. Denn dieses Buch schöpft man nicht beim ersten, auch nicht beim zehnten Lesen aus. Es müsste ein Vademekum sein.
Chesterton erzählt in der Orthodoxie die Geschichte seiner Selbstbekehrung. Hindurchgegangen durch alle modernen Ansichten und Redeweisen, sah er eines Tages die lebendige Welt an. Er fand, dass die Gedanken, die den Menschen glücklich und frei zu machen versprachen, in der Wirklichkeit genau das Gegenteil erreichten: weil sie der logischen Geschlossenheit die menschliche und weltliche Wirklichkeit opfern; und zweitens, weil ihre “Vorurteilslosigkeit und Freiheit” sie daran hindern, auch nur ihren eigenen Plänen ganz und dauernd zu trauen und ihnen mit voller Kraft nachzutrachten. “An jeder Straßenecke kann uns ein Mensch begegnen, der die frevlerische und tolle Behauptung aufstellt, er sei vielleicht im Irrtum, seine Anschauung könne wohl nicht die rechte sein.” In dieser Unsicherheit zieht der moderne Revolutionär “nicht nur die Institution in Frage, die er angreift, sondern das Prinzip selbst, kraft dessen er sie angreift ... Ein russischer Pessimist wird einen Polizisten verklagen, weil er einen Bauern erschoss und dann eine ganze Reihe von philosophischen Beweisführungen vorbringen, wieso dieser Bauer sich selbst hätte töten sollen. Da klagt einer die Ehe als Lüge an und wirft dann aristokratischen Lebemännern ihre Nichtachtung der Ehe vor. Er nennt eine Flagge einen nichtssagenden Fetzen und tadelt dann die Unterdrücker von Polen oder Irland, weil sie diesen Fetzen fortnahmen ... Kurz, der moderne Revolutionär, der ein unbegrenzter Skeptiker ist, wird stets am Werke sein, seine eigenen Minen zu zerstören ... Darum zeigt sich der moderne Rebell zu allen wirklichen Rebellionen untauglich. Indem er gegen alles rebellierte, hat er sich das Recht weggenommen, gegen dies oder jenes Beschwerde zu führen.” Dieselbe Entdeckung über die Unfruchtbarkeit der Fortschrittsidee haben viele Menschen gemacht, auch ohne Chesterton. Ein Teil von ihnen erfindet dann eine neue, seine eigene Art des Fortschritts und der Menschheitserneuerung, die Unbeständigkeit noch erhöhend; die übrigen schwenken zur Autorität ab, nur um zu entdecken, dass die Autorität dem Menschen auch nicht mehr gerecht wird als der Fortschritt.
Chesterton hingegeben bleibt Demokrat, ja, sollte es nötig sein, geneigt zur Rebellion, “Anhänger des elementaren, liberalen Prinzips einer sich selbst regierenden Menschheit”. Dieses Prinzip bestimmt sich für Chesterton nach zwei Theorien: dass die allen Menschen gemeinsamen Interessen wichtiger sind als die privaten Interessen eines jeden; und dass der politische Instinkt oder Drang zu jenen gemeinsamen Dingen gehört.
Mit diesen drei sich so widersprechenden Hauptgedanken, die in tausend anderen Ausdrücken wiederkehren, nämlich: Gedankenfreiheit macht sklavisch; zweitens: stramme Autorität macht leibeigen; drittens: wir müssen uns einigermaßen selbst regieren, nicht irgendwelchen neuen Theorien des Fortschritts zuliebe, sondern unseren Instinkten und unserem Menschentum folgend – mit diesen drei widerspruchsvollen Grundgedanken und Urgefühlen des natürlichen Menschen stößt nun Chesterton auf den überraschenden Umstand, dass “die ganze Geschichte schon entdeckt war”, und zwar im Katholizismus. Misstrauisch erst und zunächst nur durch überraschende, sonst unerklärliche Einzelbeispiele angezogen, gelangt er zur Einsicht, dass die katholische Kirche die eine, in tausendfacher Form auftauchende Grundfrage beantwortet hat, wie wir uns auf und zu dieser Welt verhalten sollen: “Wie könnten wir es fertig bringen, über die Welt erstaunt zu sein und uns zugleich heimisch in ihr fühlen? Der Mensch muss Vertrauen in sich haben, um sich in Abenteuer zu stürzen, und Zweifel genug, um sie als wirkliche Abenteuer zu empfinden.” Im Katholizismus nun sieht Chesterton diesen Weltsinn gegeben: “Eine Frage nach der anderen stieß da auf eine Antwort ... ich glich einem, der in ein feindliches Land eingedrungen war, um eine Festung einzunehmen. Und als diese eine Festung gefallen war, ergab sich das ganze Land.”
In der Orthodoxie geben sich alle Gedanken und Gefühle Chestertons Stelldichein. Seine Vorliebe für Märchen und seine scharfe Kritik gegen Naturwissenschaftler, die von “Naturgesetzen” reden, ohne doch vom Grunde dieser “Gesetze” und “Gesetzlichkeit” auch nur einen Deut erklären zu können; seine Neigung, in Menschen und Welt nur ein Spiel Gottes zu sehen; schärfste Scheidung und doch weitestes Geltenlassen der Menschen und des Denkens (vorausgesetzt, dass sie die Welt nicht sinnlos nennen): alles das steht in der Orthodoxie neben- und durcheinander, wie es – nach Chestertons Beweisthema – auch in der Orthodoxie ohne Anführungszeichen neben- und durcheinander geht. – Nur einzelne, besonders starke Fäden konnten hier aus dem zickzackigen, aber doch ganz einheitlichen Gewebe des Buches herausgezogen werden, und niemand gibt bereitwilliger als der Verfasser zu, dass selbst das nur zum Teil gelungen ist. Denn jeder Gedanke der Orthodoxie ist zwar klar und bestimmt, aber jeder eröffnet auch weite Sicht, beleuchtet die anderen, wird von ihnen beleuchtet und erhält erst dadurch, bei aller absoluten Bestimmtheit, seinen Wert in der unendlichen Verflechtung der Welt.
Chesterton bestreitet, “einen Beitrag zur christlichen Apologetik” geliefert zu haben. Es steht einem Protestanten kaum an, zu beurteilen, wie sich Chestertons Bild des Katholizismus zum kirchlichen Bild des Katholizismus und seiner Sendung verhalten mag. Aber auch der tolle Draufgänger Chesterton selbst weicht der Metaphysik der Kirche ehrfürchtig aus. Er bietet eine Physik der Kirche, eine sprühende Darlegung ihrer sozusagen körperlichen und sichtbaren Wirkung auf das Befinden von Welt und Menschen: nicht Mystik, sondern “transzendenten Menschenverstand”.
Denn Chesterton schreibt nicht, um Katholiken im Glauben zu festigen, auch nicht, um Gegner zu dämpfen. Er schreibt, um sie zu bekehren. Er greift sie an, indem er ihnen zeigt, dass ihr dauernder Vorwurf, das Christentum sei lammfromm, weich, weltabgewandt und unpraktisch, ganz falsch ist. Und er sucht sie zu bekehren, indem er demonstriert, wie gerade die Kirche das geschaffen hat, wozu der Fortschritt sich als außerstande erweist, nämlich Demokratie, Fortschritt und kräftiges Wohlgefühl des Menschen.
Bei aller literarischen Kultur und aller Schnelligkeit seiner Gedanken steht Chesterton doch jenen Salonkatholiken fern, denen Katholizismus nur die letzte Sensation, ja die letzte Perversität einer müden Literatenexistenz ist. Er ist Konvertit und hat gegenüber dem Altgläubigen den Vorteil, dass ihm alle Dinge frisch und wie eigens für ihn persönlich gemacht vorkommen, dass er das alte Land wie einen fremden Erdteil entdeckt; Bilder, die er denn auch unermüdlich abwandelt. Aber er entgeht der Gefahr des Konvertiten, nämlich einiges abzulehnen und in anderem wieder päpstlicher zu sein als der Papst. Die Kirche ist ihm ein lebender Meister, der ihn morgen das lehren wird, was er heute noch nicht begreift. Fromme Leute empfinden sicherlich manche Gedankenzusammenhänge und Bilder Chestertons nicht als Verstoß, aber als so ungewöhnlich, dass sie unpassend wirken. Nur in einem hat dieser wilde Kämpfer, dieser “taktlose Mensch” unverbrüchlich Takt bewahrt: darin, dass er nie den Katholizismus zu verbessern oder zu reformieren gesucht hat. Denn darin gerade liegt für ihn Wesen und Wert der Kirche, dass sie alles Menschliche, Frieden und Krieg, Prachtliebe und Dürftigkeit, Aszese und Sinnenfreudigkeit, Frauenfeindlichkeit und Frauenverehrung, feierlichen Pessimismus und siegreichen Optimismus gelten lässt, ja zur Ekstase steigert und doch allen diesen Regungen und Trieben die feste Form aufprägt als die tatsächlich Allumfassende.
Soll darum in der wirklichen Welt alles bleiben wie heute? Chesterton antwortet in What’s Wrong with the World (Tauchnitz). Wer in Chesterton hinein will, tut gut, mit diesem Buche anzufangen. Es ist zur Orthodoxie das weltliche Gegenstück, ein “donnernder Galopp der Theorie”, aber geritten in der wirklichen, tätigen Welt. Gleich das zweite Kapitel heißt “Unpraktischer Mann gesucht” – der “unpraktische” Mann nämlich, der mit dogmatischer Entschiedenheit prüft, was wir denn eigentlich wollen und brauchen. Das tut Chesterton. An alle Programme stellt er die eine Frage, nicht, was sie mit Staat, Nation, Gesellschaft, sondern was sie mit dem lebendigen Menschen anfangen wollen. Dass Mann, Frau, Kind wieder ihren ursprünglichen Lebensspielraum, ihre eigene Lebenslust, wenn auch dicke, qualmige Lebenslust um sich haben, an Stelle allgemeinen, logisch klaren Frostes, erscheint ihm als das Bekömmliche und Menschliche und mit allen Mitteln zu erstreben.
Den Grundgehalt dieser beiden Bücher hat Chesterton in anderen Werken einzeln ausgeschöpft. Er hat die Familie verteidigt, nicht als eine Bürgschaft für Ruhe und Ordnung, sondern als einen intimen Kampfplatz, und gerade deshalb “menschlich und fesselnd und nicht langweilig”. Er hat die Demut verherrlicht, weil sie den Menschen für Leben und Mitmenschen offen hält, während Stolz ihn absperrt. Er hat die echte Schundliteratur und ihre Leser in Schutz genommen, um die moderne und ihre Leser ins Gebet zu nehmen. Dem Nietzscheschen neuen Gesetz: Seid hart hat er den Vorwurf gemacht, dass es lieber gleich heißen könnte: Seid tot, “Empfindung ist die Definition des Lebens”. Er hat bleichsüchtigen, geschmäcklerischen Literaten, die sich nicht “festlegen” wollen, die Tatsache vorgehalten, dass die grimmigsten Dogmatiker wie Shaw und er die besten Künstler sind, weil sie etwas zu sagen und deshalb alle ihre Waffen bei sich haben.
Häufig haut Chesterton in den Einzelheiten daneben, anstatt durch. Aus Liebe zum Normalen begibt er sich der Kritik auch anormaler Albernheiten. So etwa, wenn er noch an der Northcliffeschen Zeitschrift Answers, einer gerissenen Spekulation auf unechten angelsächsischen Boygeist, der (aus wohlberechneten Nützlichkeitsgründen) auch eine Lächelwoche organisiert, noch die große Tatsache der völlig zwecklosen, lebenerfüllten Neugier des gemeinen Mannes zu verteidigen findet. Auch Chestertons Auffassung von Demokratie, allwo jedermann einfach mitredet und mittatet, ist höchstens für die Angelsachsen möglich – durch ihre Inselsicherheit. Trotzdem ist, wie in allen Chestertonschen Gedanken, ein Zug darin, der auch uns einleuchten könnte. "Unsere Demokratie hat bloß einen großen Fehler: sie ist nicht demokratisch" sagt Chesterton. Demokratie, nicht nur in Deutschland, ist heute praktisch Ressentiment, Lebensneid und Angst der Demokraten vor den Nichtdemokraten. Fällt jedoch das Ressentiment fort, das Chesterton seiner Gesamtneigung nach nicht in seiner ganzen Hinderlichkeit sieht, fassen erst die Demokraten selbst rechten Mut und ganzes Vertrauen zur Demokratie, so ist ihre vielleicht wichtigste Voraussetzung da.
In anderen Dingen aber hat gerade Chesterton haarscharf und allgemeingültig geschieden. An allen Ecken und Enden wird z. B. heute für das Mittelalter geworben. Auch Chesterton sieht in ihm die Zeit, die vielleicht am menschlichsten gewesen ist. Gerade darum erkennt er mit besonderer Schärfe, dass die meisten, die "zurück zum Mittelalter" rufen oder gar vom "gotischen Menschen" reden, Schwindler und Literaten sind, die den Dom haben wollen ohne den Glauben, die blaue Blume der Romantik ohne das quirlende Treiben ringsum; blasse Schönheitssucher, stolz verschlossen in ihre eigene Umwelt und jeden menschlichen und mittelalterlichen Lebens bar. Ihnen wirft er in seinem Dickens-Buch eine Anekdote an den Kopf: "Man behauptet, dass während der Wiederbelebung des Feudalismus, unter Viktoria ... ein Edelmann sich einen Einsiedler mietete ... Es wird auch behauptet, dass der Einsiedler stürmisch um mehr Bier einkam. Ob diese Anekdote nun wahr ist oder nicht, sie wird immer erzählt, um den Absturz des mittelalterlichen Ideals auf die heutige Ebene zu zeigen. Aber in dem bloßen Akt, dass er um mehr Bier einkam, war der heilige Mann viel mittelalterlicher als der Narr, der ihn anstellte." –
Von Chestertons Geschichten ist "Der Mann, der Donnerstag war", vielleicht in Deutschland am bekanntesten geworden. Das ist schade, auch abgesehen von der Übersetzung, denn diese "Nachtmahr" ist nicht geglückt. In einem Geheimklub von sieben blutdürstigen Anarchisten, die den Namen der Wochentage führen, entpuppt sich einer nach dem anderen als gesetzestreuer Bürger und ehrgeiziger Polizist – bis auf "Sonntag", der das Ganze angestiftet hat. Diese Rahmenerzählung ist leidlich klar. Sonntag ist, wie die englischen Kritiker mit Recht annehmen, Gott. Die sechs anderen sind die Menschen. Sie denken alle, wie wunderbar heroisch, opferwillig oder sonst so etwas sie sind, und jeder hält den anderen für einen schlechten Kerl und Anarchisten und hat schlotternde Angst vor ihm, während er zugleich bereit ist, sein Leben hinzugeben. Unausgesprochene These des Buches ist: Das Leben ist romantisch und gefährlich wie eine Anarchistenverschwörung, aber es ist zugleich auch fürchterlich harmlos, denn es ist ein Spiel, das Gott mit uns spielt. Sonntag, Gott, ist der einzige, der für wirklichen Anarchismus, für wirkliche Herrschaftslosigkeit erhaben genug ist; die Menschen sind alle unter den verschiedensten Masken gesetzestreu. – Auch wenn man sich auf den Vorwurf der Unehrerbietigkeit gegen Gottes Macht, einen Vorwurf, der bei stärkerer künstlerischer Gestalt und Gewalt des Werkes vielleicht an Gewicht verlöre, nicht einlässt, bleiben in der Erzählung selbst starke Mängel. In den meisten Abenteuern der sechs loyalen Anarchisten folgt Chesterton mehr dem fabulierenden Einfall und einzelnen seiner Zu- und Abneigungen, als der eigenen Grundidee. Sollte diese durchgeführt werden, so durften vor allem, ganz abgesehen von der Langeweile der sechs Demaskierungen, nicht alle am Schluss gesetzestreue Bürger sein. Im Gegenteil war zu verkörpern, was auch am wirklichen Anarchisten göttlich und christlich ist. Sagt doch Chesterton selbst im Dickens-Buch, dass Jesus Christus in den Dieb hineinschaute, um den ehrlichen Mann zu finden. Er selbst macht es sich im Donnerstag etwas leichter – allzu leicht.
Auch in den kleinen Detektivgeschichten "The Innocence of Father Brown" zieht ihn der Polizist als Vertreter der Ordnung an. Dann aber will er auch mit dieser als volkstümlich verachteten Form eine blut- und erfindungslos gewordene Literatur ins Gesicht schlagen, ihr zeigen – um wiederum annähernd in Worten seines Gegners Shaw zu sprechen –, dass die Hand eines Künstlers und Menschen solche Stoffe ebenso leicht vermenschlichen kann, wie sie in unkünstlerischen Händen die Dichtung entmenschlichen können. Gerade in der Detektivgeschichte konnte Chesterton an einem Spitzenbeispiel zeigen, dass die dürr hochmütige Logik, die Kette der Kausalität, die Welt nicht beherrscht. Deshalb – nicht nur einem paradoxen Einfall zuliebe – ist sein Detektiv Priester. Der kleine, unscheinbare Vater Brown mit seiner Demut und seiner Aufnahmefähigkeit für alles Menschliche bringt es weiter als der Künstlerstolz des Sherlock Holmes. Tonquédec klagt auf Grund des sinnlosen französischen Titels La clairvoyance du père Brown den Priester der Hellseherei an. Mit Unrecht; denn Vater Browns Gabe, Zusammenhänge zu sehen, bringt Chesterton sorgfältig in Zusammenhang mit seiner priesterlichen Berufserfahrung. Gewiss entstehen alle überraschenden Entdeckungen und Enthüllungen des kleinen Mannes im verschlissenen Priesterrock zunächst aus Ahnung und Schau. Er produziert sich nicht als Denkmaschine, die dem Zuhörer eitel und geringschätzig vorrechnet, es sei ja alles so logisch und einfach, und dem anderen fehle es nur an ein wenig Hirnschule. Im Gegenteil, gerade diesen Stolz auf die Analyse von vornherein führt Vater Brown, der aus Instinkten und Lebenserfahrungen denkt, gern ad absurdum. Gibt er doch einmal für einen geheimnisvollen, nicht zusammenzureimenden Tatbestand nicht weniger als drei Erklärungen, die alle ganz logisch und – alle vollkommen irrsinnig sind. Logik allein führt in die Irre; und Ahnung allein führt in die Irre. Erst als beide zusammentreffen, wird die wahre Erklärung gefunden. Sie aber hält nicht nur jeder logischen Nachprüfung stand, sondern ist auch – menschlich.
Weil er die Menschlichkeit sucht und zu finden weiß, kann Chesterton seinen Vater Brown Geschichten erleben lassen, die zunächst grauenhafter anmuten als jede Novelle von Poe. Denn sobald die, wenn auch noch so seltsame und verirrte Menschlichkeit aus ihrem Dunkel tritt, schwindet das Grauen. Wo in diesen Geschichten des "Optimisten‘"Chesterton aber wirkliches Grauen waltet, handelt es sich immer um hochmütige Irreligiosität, die sich alles zutraut und darob zusammen bricht.
Dem findigen Vater Brown steht ganz nach Herkommen der Meisterspitzbube Flambeau gegenüber. Nicht Eleganz und Witz, wie die Raffles, Lupin und Colin, sondern Lebenskraft und Humor im Überschuss haben ihn dazu gemacht. Nach etlichen ruhmreichen Streichen wird er von Vater Brown zur Ehrbarkeit bekehrt.
Und infolgedessen passiert diesen tief erdachten und glänzend erzählten Geschichten, in denen eine Fülle lebendiger, unvergesslicher Figuren mitspielen im Gegensatz zu der Durchschnittsdetektivgeschichte, die nur eine logische Schachpartie mit blassen abgebrauchten Typen ist – passiert Chestertons Buch das Missgeschick, das gerade ihm unter allen Autoren auf den weiten Fluren europäischer Literatur nicht hätte zustoßen dürfen. Sobald Flambeau ehrbar wird, wird er uninteressant, passiv und kann nichts mehr. Er tritt ganz in den Schatten von Vater Brown. Gerade Chesterton aber hätte zeigen müssen und zeigen können, wie sich die Tatenlust des wieder ehrbar Gewordenen befeuert und erhöht. –
In anderen Dichtungen ist Chesterton, der vom Gedanken ausgeht, der Gefahr des Gedankens erlegen. Trotz aller Kurven und Seitenwege nach rechts und links bleibt die Straße seiner Phantasie eng. So kommen in Romane, wie Manalive, wie Ball and Cross (in einigen Kapiteln vielleicht den tiefsten, was Chesterton überhaupt geschrieben) Wiederholungen, ermüdete, ermüdende Abschnitte. So gibt er sich oft, z. B. in der einzigen mir bekannten dramatischen Arbeit ‚Magie‘ über Tragkraft und Ertrag eines Gedankens wenig Rechenschaft. An Stelle der Dichtung tritt dann die Bauskizze, noch überreich an Einfällen, aber peinlich wächsern, streckenweise langweilig in ihrer Breite, nicht aus Flüchtigkeit und Mangel an Feile, sondern weil der lebende Mensch der Dichtung nicht mehr Herr wurde über den kämpfenden Gedanken des Dichters.
Gleich vollendet als Dichtung wie als Gedankenwerk ist das Flying Inn (Tauchnitz 4770. Inzwischen leider nicht mehr rechtzeitig genug für eine ausführliche Würdigung der Übersetzung, auch deutsch im Musarion-Verlag München), das fliegende Wirtshaus, der beste der Chestertonschen und einer der bedeutendsten zeitgenössischen Romane überhaupt.
Wie alle seine anderen Romane (vielleicht wie jeder ursprüngliche, d. h. romanhafte Roman) ist auch das fliegende Wirtshaus eine Odyssee. Nicht umsonst bringt es Patrick Dalroy im Anfang seiner Karriere zum ‚letzten König von Ithaka‘. Ire von Geburt, englischer Seeoffizier, dann politischer Abenteurer, der den Türken schlägt und daraufhin von der europäischen Diplomatie schleunigst seines Thrones entsetzt wird, kehrt er zurück nach England: Ein Mann von sechs Fuß, der Olivenbäume mit der bloßen Faust ausreißt, wenn es darauf ankommt; aber kein verschlossener Übermensch, sondern singend, lachend und trinkend. Er kommt heim zu seinem Jugendbekannten Humphrey Pump, Alleinbesitzer des Wirtshauses zum Alten Schiff, und zu seiner Jugendliebe Lady Joan Brett. Aber er findet das Jugendland nicht mehr. Lord Ivywood, englischer Premierminister und verwandt mit Joan und Patrick, will die Welt neu, den Menschen hygienisch, die Gesellschaft vernünftig machen. Er hat zunächst das Alkoholverbot durchgesetzt. Starke Getränke dürfen nur noch an ein paar besonderen Orten – wie im Hotel Adlon und der Vier-Jahreszeiten-Bar, ‚wo dringende Notwendigkeit bereits nachgewiesen‘ – verschenkt werden. Diesen Plätzen ist ihr Wirtshausschild verblieben, damit jedermann, der Geld und gesellschaftliche Stellung hat, sehe, dass er hier mit obrigkeitlicher Bewilligung trinken darf. Der verflossene König von Ithaka landet bei seinem Freunde Pump in dem Augenblick, als Lord Ivywood, schon Gegenspieler Patricks auf der diplomatischen Orientkonferenz und bei Lady Joan, auch noch das alte Schiff zerstören will – durch Limonade. Da packt Patrick das letzte große Rumfass, das letzte große Käserad aus den Vorräten des Wirtshauses, reißt das Wirtshausschild aus dem Boden und flieht; Humphrey Pump, der die Bauern, ihre Weise und Wege kennt, dient ihm als Führer, nein, als Scout. Sie flüchten; flüchten durch ganz England, erst zu Fuß, dann mit Eselskarren, schließlich im Auto, überall ihr Wirtshausschild als Fahne der Fröhlichkeit einer unbekümmerten, unbekehrten Welt aufpflanzend, überall Rum und Käse an die gewaltsam ernüchterte, kalt gemacht Menschheit verabfolgend; singend, zechend, lachend; und ihren Gästen mit dem Trank auch den Sang, mit dem Lied auch das Gelächter zurück bringend, ‚das seit dem Mittelalter geschlafen hat‘.
Aber Lord Ivywood geht weiter; die Trockenlegung war nur harmloses Vorspiel. Er will eine neue Welt voll Reinlichkeit und Regel ohne Ende. Und er will – Joan Brett, nicht als seine Frau, als eine Herrin Subeide, die ihm, dem König dieser neuen Welt, leuchte. Für sie lässt er seinen Landsitz umbauen: reich und kahl, ornamental und kalt, weich und unheimisch, ganz übersichtlich und doch ohne Festigkeit. So wird er auch das Reich umbauen: der Abschaffung der Kneipen folgt die der Kasernen, der Vernichtung der Kirche folgt die der Kunst; und der Fanatismus, der eine neue Welt zustande bringen will, blendet sich selbst gegen die eigene Ehre. Lord Ivywood fällt einem kleinen, lächerlichen orientalischen Mystagogen anheim; Lord Ivywood bricht sein Wort, als sein Versprechen seinen Plänen im Wege steht, wie sein Name sagt, ein Efeuholz, zäh und nicht selbständig.
Bis dann plötzlich, wie auch in anderen Romanen Chestertons, diese ganze neue Welt mit einem kleine Vordonner der Offenbarung zusammenbricht. Zusammenbricht nicht erst vor der Stoßkraft der Menge, die Patrick Dalroy gegen Ivywoods Landsitz und seine türkische Leibwache (des Landes einzig verbliebene Militärmacht) heranführt. Sie war schon vorher zusammengebrochen; vielmehr, sie war gar nicht, an keinem Ort, an keinem Menschen Wirklichkeit geworden. Auf Lord Ivywoods Landsitz trank man Champagner; in den Londoner Apotheken trank man Schnaps. Nur der Übermensch Ivywood selbst wird von den Trümmern seiner neuen Welt begraben: sein Wahnsinn bricht aus. ‚Er ist vollkommen glücklich,‘ sagt traurig seine Schwester. ‚Und wir sind so glücklich,‘ sagt unbedacht Joan von sich und Patrick.
Den Inhalt von einigen dreihundert Tauchnitzseiten auf den Gehalt von einigen dreißig Hochlandzeilen zu drängen, ist natürlich ein Unrecht an Chesterton und gerade am fliegenden Wirtshaus. Kaum je hat Chestertons Gedanke so lebendig und unterschiedlich und in solcher Zahl Menschen beschworen wie hier. Nie ging seine Melodie stärker und strömender; in keinem anderen seiner Bücher nimmt sie mehr gefangen. Wir Deutsche haben Bücher ähnlich quellenden Lebens etwa in den beiden großen Geschichten von Hermann Löns, dem ‚Wehrwolf‘ und dem ‚Zweiten Gesicht‘. Sie sind (wie deutsche Dichtung überhaupt) stärker in der Menschengestaltung und -beschwörung, weniger polemisch, aber enger nach dem menschlichen und geistigen Horizont, schwächer als Motor und Lebensantrieb.
Nur eines gelingt Chesterton nicht, selbst im ‚Fliegenden Wirtshaus‘ nicht: Frauengestalten. Die Frau, die die immer wieder schief werdende Welt immer wieder bei Kleinem ins Gleiche bringt, die selbst den Mann erträgt, gelassen seufzend oder überlegen humoristisch, weil sie fühlt, dass er ein verbohrter Spezialist, ein windiger Wichtigtuer ist im Angesicht des Tages und der Ewigkeit, der von den tausend kleinen Arbeiten dieser Erde und von ihrer tiefsten Freude nichts mehr ahnt – diese Frau, die normale, durchschnittliche, geplagte Frau, ist für Chesterton die in einem und durch ein kleines Reich Allmächtige, der Welt wirkliche Königin hinter den Kulissen. Ihr hat er in What’s Wrong gehuldigt. Frauen aber kümmern ihn wenig. Braucht er sie in seinen Romanen, so nimmt er sie von der Tuckpostkarte, verbessert durch einige handkolorierte Striche. Er, der nach literarhistorischem Schema am ehesten unter die modernen irrationalistischen Philosophen und unter die Salonkatholiken zu stehen käme, ist in der unvorteilhaftesten Position, in die ein Buchschreiber heute kommen kann, nämlich ein Schriftsteller und Dichter für Männer zu sein.
3
Was er taugt
Aber ist er nicht einfach ein Literat? Wittern nicht am Ende die doch etwas Wahres, die ihn einen Exzentrik nennen, auch wenn sie sich unbeholfen ausdrücken? Hier ist ganz scharf zu scheiden.
Eher für als gegen Chesterton spricht, dass er soviel Schlechtes geschrieben hat. Hugo Hofmannsthal arbeitet, ob in so lang flutender Woge wie der alte Goethe oder so gelenksteif wie der junge Lessing, stets schlackenfrei und bringt deshalb nie ein überwältigendes Buch fertig. Da ich nur einen Teil von Chestertons Arbeiten kenne, weiß ich nicht, wie schlecht er schreiben kann. Aber es ist mir sicher, dass er eines nicht kann: unchestertonisch schreiben. Doch eben diese Schreibart, verrät sie nicht den Literaten in jeder Zeile? Wozu die Paradoxe und ausfallenden Bilder? Merken Sie denn nicht, wie er sich interessant macht?
Gewiss, Chesterton ist auch Zeitungsschreiber, englischer Zeitungsschreiber. Die englische Zeitung, vielleicht die beste Schule für die Schlagkraft des geschriebenen Wortes, hat ihn geschult – und verschult, nicht nur stilistisch. Häufig kritisiert er an Stelle der ursprünglichen Sache bloß die öffentliche Meinung über diese Sache. Chesterton würde sich wohl damit rechtfertigen, dass der normale Mensch selten von den ursprünglichen Sachen wisse, fast immer von der öffentlichen Meinung darüber bestimmt werde. Umso sorgfältiger muss man aber zwischen Dingen erster Hand und ihren Folgen scheiden – was Chesterton oft nicht genügend tut.
Seine Schreibweise hat noch einen anderen Grund. Ein Mensch seiner Anlage und Anschauung konnte zum Mystiker werden. Dazu fehlte ihm das letzte Unnennbare, und soll er dieserhalb ein Literat heißen, so mag es sein. Aber wenn er trotz seiner schönen Verherrlichung der Demut zu sehr G. K. C. bleibt, um zum Mystiker zu werden, so hat er doch auch die andere Gefahr gemieden, ein irrationaler Philosoph zu werden. Irrationale Philosophie hat zwei Gefahren: sich aufzulösen in selbstberauschtes Gerede oder in mystagogischen Rationalismus, der schlimmsten Unart von Rationalismus zu erstarren. Vor beidem rettete sich Chesterton durch das Paradoxon, das einen Gedanken in schärfster Bestimmtheit ausdrückt und doch die Flechtfäden mit der Welt immer neu knüpft.
Bleibt noch der Vorwurf der Übertreibung. Übertreibung ist die Definition der Kunst, sagt Chesterton. Wer nun hinter seine Übertreibungen schaut, merkt mit Erstaunen und Grauen, dass hinter ihnen nicht nur Wahrheit, nein, hausbackene Wirklichkeit steckt. Starke Getränke zu verherrlichen, während viele Familie daran zugrunde gehen, scheint ein Verbrechen. Aber neben mir liegt der Bericht nicht eines whiskytrinkenden Angelsachsen, eines weinfrohen Romanen, eines bierdurstigen Deutschen, sondern das Buch eines nüchternen Skandinaviers. Als Folgen der Trockenlegung der Vereinigten Staaten bezeichnet er “eine gewisse stumme Niedergeschlagenheit . . . vor allem in den niederen Volksschichten, Ungeduld und Langeweile, ohne die mindeste Aussicht auf Anregung bei den körperlichen Arbeitern der niederen Klasse”; während “für die höheren Gesellschaftsklassen das Alkoholverbot bisher nur wenig Unannehmlichkeiten mit sich gebracht” und “in der Goldschmiedebranche einen neuen Zweig entwickelt hat, nämlich den der Alkoholbehälter, z. B. in Gestalt von Futteralen für Operngläser und Brillen, von Zigarettenetuis usw.”. – Es mag unfruchtbare Romantik scheinen, im düsteren Mittelalter eine springlebendige Zeit zu sehen. Sicher ist aber – um gleich das modernste und extremste Beispiel zu nehmen –, dass sich damals die Dirnenhäuser örtlich an den Dom herandrängten. Chesterton übertreibt, wenn er einen englischen Premierminister auf eine morgenländische Leibwache sich stützen lässt; aber dem Abendland ist sein Untergang philosophisch verbrieft. Übertrieben ist es auch, wenn Lord Ivywood dem kleinen türkischen Mystagogen zum Opfer fällt; jedoch die Nachricht, Rudolf Steiner weile als Gast des englischen Unterrichtsministers in Oxford, hat keinen Widerspruch erfahren. Es klingt grausig, körperliche Ungepflegtheit gegen den Hereinbruch der Hygiene zu verteidigen. Aber dürre statistische Zahlen weisen uns nach, dass in der Zeit des verheerenden Durcheinanders, der furchtbaren Ungepflegtheit – in der Zeit nach dem Kriege – die Sterblichkeitsziffer in allen Ländern zurückgegangen ist. Dass die Irrenärzte schließlich die Könige einer neuen Welt sein würden, ist – genug, ich gerade zu sehr in Chestertons eigene Tonart und Gefahr.
Denn Chesterton liebt überscharfe Gegensatzpaare. Nicht einmal Zeitangaben kann er ruhig machen; “Dombey und Sohn ist die letzte Geschichte in der ersten Manier; David Copperfield ist die erste Geschichte in der letzten.” Ganze Seiten, Abschnitte, Bücher schreibt Chesterton in Antithesen. Er missbraucht dieses Stilmittel, des Kritikers Reim, öfter bis zur Erschöpfung der Rede und des Lesers. “Shaw hat etwas von der schrecklichen Gerechtigkeit einer Maschine”, sagt Chesterton. Das Gleiche gilt von einigen Tausend seiner eigenen Gegensatzpaare. “Dickens sagte die Wahrheit einmal zu oft”, steht in seinem Dickensbuch. Dasselbe lässt sich – in anderem Bezug – von Chesterton sagen.
Das Dickensbuch! Wenn irgendwo, so liegt hier ein Maß dafür, was an Chesterton sterblich ist. Mit vollem Recht preist er Dickens als den Dichter der Unbekümmertheit, als den großen Volkstümlichen im Schreiben und Leben. Nun, Chestertons Dichten ist nicht volkstümlich.
But who will write us a riding song
Or a fighting song or a drinking song,
Fit for the father of you and me
That knew how to think and thrive?
But bring me a quart of claret out,
And I will write you a clinking song,
A song of war and a song of wine
And a song to wake the dead
lautet ein Kampflied im Flying Inn. Selten hat Chesterton vermocht, diese Sehnsucht zu erfüllen. Aber wenn es Dichter wieder vermögen, so werden sie mit durch Chestertons Schule gelaufen sein.
Sie werden es wieder vermögen. Sie werden die Welt wieder zu ihren Sinnen und zu Sinn bringen. “Was der menschlichen Natur wider den Strich geht”, sagt in ganz anderem Bezuge Francesco Nitti, “hat keinen Bestand.” In diesem Vertrauen, nein, in dieser selbstverständlichen Gewissheit atmet und arbeitet Chesterton. Er nimmt sie kühn und ohne Anfechtung in sich vorweg. Ihm ist der moderne Gedanke, dem er mit der Witterung des Jägers, mit der Tapferkeit des Soldaten noch in den äußersten Schlupflöchern zuleibe geht, kein Teufelswerk, das Erde und Menschen verderben wird oder gar schon verdorben hat. Chesterton weiß, nein, fühlt bis in den letzten Pulsschlag, dass die Häresie nur dazu dient, die Wahrheit der Orthodorie immer mit neuer Frische zu erweisen; dass die vergänglichen und wechslerischen neuen Bewegungen nur das Unvergängliche wieder frisch machen; dass die modernen Ideen, menschen- und weltfeindlich wie sie sind, uns nur eines neu, voll Reiz und Geheimnis und ganz von frischem entdecken lassen: die alte Welt mit ihren alten Menschen.
Hier liegt die allerletzte Erklärung und Rechtfertigung für Chestertons Mutwilligkeit, die wirklich Mut-Willigkeit ist. Sein Streit ist kein Kampf, grämlich und verbissen, er ist ein Kampfspiel, laut, froh und siegessicher. Chesterton hasst den Gegner nicht, den er bekämpft. Im Gegenteil: je überzeugter, je klarer, je schärfer der Gegner ist, desto mehr ist Chesterton ihm zugeneigt und dankbar. Denn desto leuchtender wird sich an diesem Feinde die Wahrheit und die Wirklichkeit bestätigen, dass der rechte Glaube aus dem Herzen, der rechte Mensch aus seiner Haut nicht zu vertreiben ist. Um dieser Tatsache willen liebt Chesterton schließlich den Feind. Ja, Chesterton liebt Shaw, Vater Brown Flambeau, der Katholik Mac Jan den Atheisten Turnbull, der Abendländer Patrick Dalroy den Orientalen Oman Pascha. Nicht nur fühlt Chesterton froh und voll Zuversicht, dass die Sache des Glaubens und der Welt nie verloren sein kann. Er weiß auch das weit Tiefere, Erlösende, dass sein eigenes kleines Kampfspiel nur ein Duell ist, “in dem selbst der Sieger sterben muss”.
Umkehrer, zaghaft sich abwendend von der heutigen Welt und ihren Menschen, aus unserer Zeit sich flüchtend und Krampf, Traum, Vergangenheit und Klage um die verlorene Schöne haben wir genug. Wenn sonst keiner, rettet Chesterton die Ehre seiner Zeit, unserer Zeit. Er kehrt heim, nicht hochmütig und allein, nicht “einsam und verehrungswürdig”. Das Lied der Heimkehr ist der Marsch der Menschheit. Trommeln und Posaunen, Trompeten und Pauken spielen, anknüpfend an einen alten Brauch des englischen Unterhauses, im schönsten Liede des Flying Inn diesen Marsch auf:
In the city set upon slime and loam
They cry in their parliament ‘Who goes home?’
And there comes no answer in arch or dome,
For none in the city of graves goes home.
Yet these shall parish and understand,
For God has pity on this great land.
Men that ar men again; who goes home?
Tocsin and trumpeter! Who goes home?
For there’s blood on the field and blood on the foam
And blood on the body when Man goes home.
And a voice valedictory . . . Who is for Victory?
Who is for Liberty?
Who goes home?
Anmerkungen:
[1] Das könnte, im Zusammenhang, besonders mit dem späteren Urteil über Chestertons deutsche Übersetzer, so klingen, als wisse noch niemand die Wahrheit über ihn. Umso mehr freut es mich, bei Hans Heinrich Ehrler, der allerdings Chesterton verwandt ist – er spielt die Chestertonsche Weise in Moll – und der deshalb in anderer Art – als ‚Heimatdichter‘ – hartnäckig missverstanden wird, eine ganz andere Wertung Chestertons zu finden. Auf dem Bücherbord des Nikolaus Köstlin, in den Briefen aus meinem Kloster (vgl. ‚Hochland‘ XX, 1, 111), steht Chesterton zwischen Goethe und Augustin, zwischen Homer und Meister Ekhart, zwischen Platon und Wolfram.
[2] Inzwischen [1922] hat Chesterton seinen Übertritt vollzogen.
Die menschliche Handlung
Ein philosophischer Blick auf etwas Vertrautes, der über unser Menschenbild entscheidet.
Personen
(Auswahl)
Lewis C. S.
Malagrida G.
Marescotti J.
Manning H. E.
Marillac L.
Maritain J.
Martin Konrad
Massaja G.
Meier H.
Mieth Dietmar
Mixa Walter
Mogrovejo T.A.
Moltke H. v.
Montalembert
Montecorvino J.
Moreno E.
Moreno G. G.
Mosebach M.
Müller Max
Muttathu-padathu
Nies F. X.
Nightingale F.
Pandosy C.
Paschalis II.
Pieper Josef
Pignatelli G.
Pius XI.
Postel M. M.
Poullart C. F.
Prat M. M.
Prümm Karl
Pruner J. E.
Quidort
Radecki S. v.
Ragueneau P.
Rahner K.
Ratzinger J.
Reinbold W.
Répin G.
Rippertschwand
Rudigier F. J.
Ruysbroek
Salvi Lorenzo
Sanjurjo D. S.
Saventhem E.
Schamoni W.
Schreiber St.
Schynse A.
Sierro C.
Silvestrelli C.
Simonis W.
Solanus
Solminihac A.
Spaemann C.
Spaemann R.
Stein Karl vom
Steiner Agnes
Sterckx E.
Stern Paul
Stolberg F. L.
Talbot Matt
Therese
Thun Leo G.
Tolkien J.R.R.
Tournon Ch.
Vénard Th.
Vermehren I.
Vianney J. M.
Walker K.
Wasmann E.
Waugh E.
Wimmer B.
Windthorst L.
Wittmann G. M.
Wurmbrand R.
Xaver Franz







