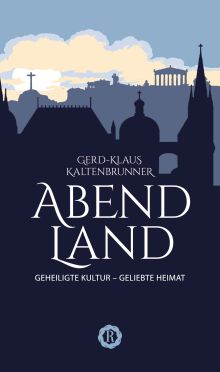zur katholischen Geisteswelt
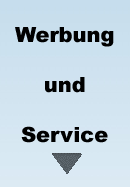
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
biographischen Bereich |
|
Zum englischen
und polnischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im ersten Teildes blauen Bereichs des PkG (Buchstaben A bis G)
Zum zweiten Teil
Zum dritten Teil
Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum philosophischen Bereich
|
|
Zum
liturgischen Bereich |
Themen
68er
Abba
Abschuß
Abtreibung
Abtreibung II
Advent
Ägypten
AIDS
Amoris laetitia
Amtsverzicht
Annaverehrung
Antisemitismus
Apokalypse
Ärgernis
Auer Alfons
Auferstehung
Auster
B16 Bundestag
B16 Missbrauch
Barmherzigkeit
Barmherzigkeit II
Barmherzigkeit III
Barmherzigkeit IV
Befreiungstheol.
Beichte
Bekehrung
Belgrad
Benedikt XVI.
Benedikt-Option
Besessenheit
Beten
Bischof
Bischofsamt
Bischofsberater
Bischofsweihen 88
Bischofsweihen II
Borromäusverein
Brigittagebete
Chesterton G.K.
Christenverfolgung
Christkönigtum
Christozentrismus
CiG
Cloyne Report
Corona
Darwinismus
Demokratie
DH
Dialog
Discretio
Dogma
Dogma u. Leben
Doppelwirkung
droben
Drusen
Effetha
Ehe
Ehe und Familie
Einwohnen
Eizellenhandel
Ekklesiologie
Embryo
Emmaus
* * *
27. Juni
Heilbringende Berührung
In der Welt steckt der Kranke den Gesunden an. Bei Jesus ist es umgekehrt, wenn er den Aussätzigen berührt. In dieser Podcastfolge zeige ich, was Jesus uns durch seine Wunder offenbart.
Der nächste Beitrag auf kath-info ist für den 3. Juli geplant.
27. Juni
Die Tür zur Wirklichkeit
Nun habe ich auch auf Soundcloud mein Buch "Wirklichkeitserschließendes Sollen" vorgestellt.
27. Juni
Raymond Leo Burke
Vor 50 Jahren, am 29. Juni 1975, einen Tag vor seinem 27. Geburtstag, wurde im Petersdom in Rom Raymond Leo Burke von Papst Paul VI. zum Priester geweiht. 1995 empfing er die Bischofsweihe, 2008 wurde er Präfekt der Apostolischen Signatur, 2010 Kardinal. Er setzt sich für die traditionelle Liturgie ein.
Am selben Tag, den 29. Juni 1975, wurden in Ecône Tissier de Mallerais (1945-2024), Donald J. Sanborn und Pierre Blin von Erzbischof Marcel Lefebvre zu Priestern geweiht.
27. Juni
Wen beschützt der Herr?
Zum dritten Sonntag nach Pfingsten kann ich diese zwei Predigten anbieten:
Das verlorene Schaf und die Moraltheologen
26. Juni
Johannes Hirschberger
Vor 100 Jahren, am 29. Juni 1925, wurde der Philosoph Johannes Hirschberger (1900-1990) zum Priester geweiht. 1930 promovierte er bei Joseph Geyser. Er lehrte in Eichstätt und Frankfurt. Bekannt wurde er vor allem durch seine zweibändige Geschichte der Philosophie. Den Naturbegriff der Enzyklika Humanae vitae verteidigte er gegen ihre Kritiker.
26. Juni
Georg Ratzinger
Vor fünf Jahren, am 1. Juli 2020, starb in Regensburg im Alter von 96 Jahren Georg Ratzinger, der Bruder von Joseph Ratzinger.
26. Juni
Hippolytus Galantini
Vor 200 Jahren, am 29. Juni 1825, wurde Hippolytus Galantini (1565-1619), der Apostel von Florenz, von Papst Leo XII. seliggesprochen.
26. Juni
Michael Dummett
Vor 100 Jahren, am 27. Juni 1925, wurde in London der Philosoph und Logiker Michael Dummett geboren. 1944 konvertierte er zur katholischen Kirche, nachdem er durch Werke Chestertons, Christopher Dawsons u.a. zum Glauben an Gott gefunden hatte. In Oxford lehrte er viele Jahre als Nachfolger von Alfred Ayer.
In einem Aufsatz, der in der Internationalen Katholischen Zeitschrift Communio erschien, kritisierte er die wunderleugnende Bibelexegese moderner Theologen.
Im Historischen Wörterbuch der Philosophie (Bd. 12, S. 1070) heißt es dazu im Artikel Wunder:
“«Ausnahmslos schildern die Wunder-Geschichten keinen historischen Verlauf von so und so Passiertem» (R. PESCH: Jesu eigene Taten? Ein Beitrag zur Wunderfrage (1970), S. 143); das NT enthält Erzählungen, die Vorbilder des AT «grotesk überbieten». Vor diesem Hintergrund kam es zu dem nicht alltäglichen Vorgang, daß von philosophischer Seite (M. DUMMETT) Einspruch gegen die theologische Exegese erhoben wurde: Eine christliche Theologie, die das im Offenbarungstext mit klaren Worten berichtete und als fundamental («Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig»; 1. Kor. 15, 17) ausgezeichnete Wunder des leeren Grabes ins Zwielicht rückt oder gar leugnet, verliert ihre Glaubwürdigkeit (M. DUMMETT: Biblische Exegese und Auferstehung. Int. kath. Z. Communio 13 (1989) 271–283)”.
Dummett starb am 27. Dezember 2011 in Oxford.
26. Juni
José Maria Escrivá de Balaguer
Vor 50 Jahren, am 26. Juni 1975, starb in Rom im Alter von 73 Jahren José Maria Escrivá de Balaguer, der Gründer des Opus Dei. 1992 wurde er selig-, 2002 heiliggesprochen. Sein bekanntestes Buch ist Der Weg, das in 43 Sprachen übersetzt wurde und 999 Aphorismen umfasst.
„Mit einem einzigen liebevollen Wort erreichst du mehr als mit drei Stunden Streit“ (Der Weg, Nr. 10).
„Jesus ist dein Freund. - Der Freund. - Er hat ein Herz aus Fleisch wie du. - Er hat Augen voller Liebe, die um Lazarus weinten… Und so wie den Lazarus, liebt Er dich.“ (Der Weg, Nr. 422).
25. Juni
Wie das Studium in der DDR eine Amerikanerin in die Kirche führte
Von Dr. Jennifer S. Bryson
Vierter Teil
Eine andere Wendung nahm die Geschichte, als ich in Leipzig in einem Antiquariat in einem Hinterzimmer eine englische Ausgabe von „Mere Christianity“ von C.S. Lewis fand. Ich kannte Lewis durch den wunderbaren Jugendpfarrer meiner Kindheit, dessen Saat nun aufzugehen begann. Ich liebte den ersten Teil von „Mere Christianity“ über die Existenz Gottes und den zweiten Teil, der erklärte, was es bedeutet, eine Quelle zu haben, einen Maßstab für Gut und Böse. Aber den dritten Teil über Jesus mochte ich nicht. „Warum muss das alles so kompliziert sein?!“, dachte ich. Ich konnte nicht erkennen, wie Jesus da hineinpasste. Aber ich wusste intuitiv aus meiner Erfahrung mit Gott und aus meinen Freundschaften mit den polnischen Studenten, dass mein Glaube an Gott und die christlichen Überzeugungen in den wesentlichen Aspekten über Gott übereinstimmten – Gott als der Schöpfer, Gott, der nicht fern, abstrakt und getrennt von uns ist, sondern der mit uns kommuniziert und uns zuhört. Abgesehen von Jesus hatte ich keine Zweifel am Inhalt des Buches.
Als ich im Sommer 1987 in die USA zurückkehrte, wollte ich unbedingt andere Menschen finden, die Gott kennen. In den USA dachte ich, das sei einfach. Jeder man sprach hier öffentlich über solche Dinge, oder? Aber was ich in der Gegend von San Francisco und an der Stanford University fand, war entweder Desinteresse an Gott, leidenschaftliche Ablehnung seiner Existenz oder verschiedene Formen von Neuheidentum/New Age.
Zuerst ging ich in die lutherische Kirche meiner Heimatstadt, um mit dem Pastor zu sprechen. Leider war er völlig desinteressiert an dem, was ich ihm über meine Erfahrungen in der DDR erzählte. Diese Kirche war viel zu sehr damit beschäftigt, den neuesten ökumenischen Trends und gesellschaftlichen Themen hinterherzulaufen, um Zeit für Gott zu haben. Ich war am falschen Ort.
Als ich im Herbst 1987 nach Stanford zurückkehrte, war ich sicher, dass zumindest einige Studenten Gott so kannten wie meine polnischen Freunde in der DDR. Aber ich wusste monatelang nicht, wie ich sie finden sollte. Wenn Studenten auf diesem liberalen Campus erfuhren, dass ich zwei Semester in der DDR verbracht hatte, sagten sie: „Oh! Du warst in einem sozialistischen Land?!? Das muss sooooo cool gewesen sein!“ Nein, es war nicht „cool“. Es war eine Diktatur. Aber das wollten sie nicht hören. Offensichtlich waren sie keine Menschen, die sich für Gott interessierten.
Monate später, im Frühjahr 1988, noch verzweifelter, Menschen zu finden, die Gott kannten, ging ich allein zu einem Ostergottesdienst in der lutherischen Kirche neben dem Campus. Dieser Versuch, andere Gläubige zu finden, scheiterte so gründlich, dass er rückblickend fast grotesk wirkt. Von allen möglichen Themen für eine Osterpredigt predigte der Pastor darüber, warum wir die Sandinisten in Nicaragua unterstützen müssen. „WAAAAAAS?!?????“ war die Antwort in meinem Kopf. Das war seine Predigt und das an Ostern! Ich hatte gerade mit Sandinisten aus Nicaragua in der DDR den Marxismus-Leninismus studiert. Sie studierten atheistisch-materialistische Philosophie und lernten, wie man Religion gewaltsam aus der Gesellschaft entfernt. Ich war wieder am falschen Ort. Und ich war tief enttäuscht; ich sehnte mich immer noch danach, andere zu finden, die Gott kannten.
Eine Veränderung in meinem Leben nach dem Aufenthalt in der DDR war, dass ich mich politisch engagierte. Die DDR war ein politischer Schock für mich. Ich lernte auf die harte Tour zu schätzen, dass wir im Westen an Gutem haben, zum Beispiel die Freiheit von staatlichem Mikromanagement in unserem Leben. Und mir wurde bewusst, dass es Menschen gab, die ihre ganze wache Zeit damit verbrachten, die westlichen Gesellschaften zu zerstören. Ich fühlte eine neue Verantwortung, sie zu schützen. Bequemlichkeit wäre töricht. Unmittelbar nach meiner Rückkehr nach Stanford 1987 trat ich den Stanford College Republicans bei. (Es war die Ära unseres großen Präsidenten des Kalten Krieges, Ronald Reagan). Ich begann auch, für die konservative Campuszeitung „The Stanford Review“ zu schreiben. 1988 war ich Präsidentin der Stanford College Republicans.
Im Frühjahr 1988 begann ich mich mit einem der beiden Studenten zu daten, die die Stanford Review gegründet hatten. Er war ein überzeugter evangelikar Christ. Er lud mich zu einer Campusgemeinde ein, wo ich Studenten und andere fand, die Gott kannten. Was für eine Erleichterung. Was für eine Freude. Ich wusste, diesmal war ich am richtigen Ort. Die Thematiken mit diesen evangelikalen Christen waren mehr oder weniger die gleichen wie mit meinen polnischen Freunden in der DDR. Allerdings gab es zwei Streitpunkte zwischen meinem Freund und mir: der christliche Glaube und die Abtreibung.
Was den christlichen Glauben betraf, so glaubte er an die Bibel, während ich immer vorschlug, dass alles nur symbolisch sei. Mir war nicht bewusst, wie sehr die liberale Geschichtskritik, der ich in meiner Kindheit in der lutherischen Kirche und in der Schule ausgesetzt war, mein Denken geprägt hatte. Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, warum wir uns so stritten. Aber ich wusste, dass er Gott kannte, und deshalb vertraute ich ihm und war bereit, auf ihn zu hören. Ich freute mich auch, mit ihm in die Kirche zu gehen.
Wird fortgesetzt
Die Gläubigen knien im kühlen Gras. Alle Blicke sind auf den Altar gerichtet, an dem Schneider die Wandlung vollzieht. Zu Beginn des Hochgebets fordert er die Gläubigen auf: „Sursum corda – Erhebet die Herzen.“ Alle antworten: „Habemus ad Dominum – Wir haben sie beim Herrn.“ In den meisten Messen klingt das nach einem Versprechen. Hier auf dem von Ehrfurcht beherrschten Feld kommt es einer Feststellung nahe. Kurz nach dem Gottesdienst setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Uns treibt die Aussicht, am Abend schon die Türme der Kathedrale von Chartres in der Ferne erspähen zu können.
Aus der großen Bildreportage der FAZ über die dreitägige Pfingstwallfahrt von Paris nach Chartres (Text: Gregor Brunner, Fotos: Stefan Nieland) Unterwegs mit dem Heiligen Geist.
24. Juni
Nicht Erlöser, sondern Kantianer
Dazu passt auch die abenteuerliche Interpretation der Gestalt Jesu als frühen Kantianer, wie sie Striet seinen Lesern anbietet (…) Deshalb habe Jesus den Kreuzestod nicht gewollt; dieser sei für ihn vielmehr ein „Desaster“ gewesen, das ihn unfreiwillig getroffen habe. Jesus sei nicht für unsere Sünden gestorben (…) Ungewollt zeigt der Autor damit, wie die Ablehnung der Lehre vom Sühnetod Jesu Christi letztlich die ganze Christologie ins Wanken bringt und von Jesus nur mehr ein liberaler Lehrer und netter Mensch übrig bleibt…
Aus: Manuel Schlögl, Entkerntes Credo, in der Tagespost vom 15. Mai 2025
Über Striets Kantinterpretation
24. Juni
Walter Ramm
Heute wird Walter Ramm 80 Jahre alt. Er widmete sein ganzes Leben dem Lebensrecht der ungeborenen Kinder. 1979 gründete er die Aktion Leben e.V., deren Zentrum sich in Oberflockenbach befindet, das zu Weinheim an der Bergstraße gehört.
23. Juni
Download-Freigabe 85
In den Standardeinstellungen von Soundcloud ist die Downloadmöglichkeit ausgeschlossen. Die Option existiert allerdings. Deshalb gebe ich nach und nach meine Predigten zum Download frei. Hier folgt die nächste Predigt:
Wie lädt man die Predigt herunter? Klicken Sie auf den Button mit den drei Punkten, dann auf Datei herunterladen.
23. Juni
Francoise-Marguerite von Silly
Vor 400 Jahren, am 23. Juni 1625, starb im Alter von 45 Jahren Francoise-Marguerite von Silly, die Frau von Philippe-Emmanuel von Gondi (1580-1662). Dieser war der General der französischen Galeeren. In deren beider Dienst trat 1613 auf Vermittlung von Pierre de Bérulle und Charles de Fresne der hl. Vinzenz von Paul (1581-1660). Das Ehepaar war tief religiös, setzte sich für eine echte Glaubenserneuerung ein, insbesondere für eine Intensivierung der bislang vernachlässigten Galeerenseelsorge. Von König Ludwig XIII. erwirkten sie die Einrichtung des Amtes eines königlichen Galeerenseelsorgers. Am 8. Februar 1619 wurde dem hl. Vinzenz von Paul dieses Amt übertragen.
23. Juni
Johann Gabriel Meurin
Vor 200 Jahren, am 23. Juni 1825, wurde in Berlin Johann Gabriel Meurin geboren. Er wurde 1848 Geheimsekretär des Erzbischofs Geissel und Domvikar in Köln, 1853 Jesuit, kam 1858 als Missionar nach Indien und wurde 1867 Apostolischer Vikar der vereinten Sprengel Bombay-Puna. Er „wurde als Gründer von Missionsstationen, Schulen, Vereinen und Wohlfahrtsanstalten der Hauptorganisator der Mission, hervorragend auch als Kontroversredner und apologetischer Schriftsteller“ (LThK, 1. Auflage). 1887 wurde er Bischof von Port-Louis, der Hauptstadt von Mauritius, wo er am 1. Juni 1895 starb.
23. Juni
Bertonianer
Vor 100 Jahren, am 23. Juni 1925, wurden die Bertonianer päpstlich bestätigt. Es handelt sich dabei um die Kongregation der Priester von den hl. Wundmalen, die 1816 in Verona vom hl. Kaspar Bertoni (1777-1853) gegründet worden war.
22. Juni
Das Leben des heiligen Franz Xaver
Von Wolfgang Reithmeier, bearbeitet von Joseph Firnstein und Paolo D'Angona
55. Folge
Pater Ignatius hatte Xaver geschrieben, er möge einen geeigneten Mann nach Europa schicken, damit dieser dem König von Portugal und dem Papst über die Angelegenheiten des Orients genauen Bericht erstatte - um von ersterem zeitliche Unterstützung und vom anderen geistliche Gnaden zu erhalten, die zur Ausbreitung des Christentums in der neuen Welt notwendig seien. Pater Xaver hatte denselben Gedanken gehabt, jedoch erhielt er die betreffenden Briefe erst nach seiner Rückkehr aus Japan. Er sandte sogleich Andreas Fernandez ab, einen verständigen und tugendhaften Mann, der noch nicht Priester war. Zuvor hatte er ihn genau über die Angelegenheiten Indiens unterrichtet. Er gab ihm auch Briefe an den König von Portugal, an Simon Rodriguez und Pater Ignatius mit.
Während man das Schiff zurüstete, welches die Missionare nach China und Japan bringen sollte, versammelte Xaver zur Nachtzeit die Patres des Kollegiums, weil er über Tag keine Zeit dazu gefunden hatte, und ermahnte sie mit solcher Herzlichkeit, in ihrer apostolischen Tätigkeit auszuharren, daß alle zu weinen begannen. Ein Augenzeuge sagt: "Ehe sich Pater Franz einschiffte, umarmte er jeden der Brüder mit Tränen in den Augen und legte ihnen Standhaftigkeit in ihrem Beruf ans Herz, tiefe, aus wahrer Selbsterkenntnis hervorgehende Demut, und besonders den bereitwilligen Gehorsam."
15. Kapitel
Xavers Abreise von Goa - Ankunft in Malakka - Pest in der Stadt - Xaver unterstützt die Kranken in ihrer Not - Wiederauferweckung eines Toten - Zerwürfnisse mit dem Statthalter; seine Exkommunikation - Abreise von Malakka; das süße Meerwasser - Xaver erweckt ein totes Kind zum Leben - Wunderbares Geschehen bei der Taufe in Cincheo - Ankunft in Sancian - Prophezeiungen - Xaver vertreibt die Tiger
Xaver trat seine Reise von Goa am 14. April 1552, dem Gründonnerstag, an. Das Schiff hielt in Cochin, eine Gelegenheit, die Xaver nutze, einen Brief an Caspar Barzäus zu schreiben. Als sie wieder von Cochin aus weiterreisten, war das Meer ruhig, bis sie zu den Inseln kamen, die nordwärts ein wenig oberhalb Sumatra liegen. Die Wellen gingen hoch, und in kurzer Zeit war der Sturm so heftig, daß man kaum noch Hoffnung hatte, ihm zu entkommen. Die Angst steigerte sich, als man sah, wie der Sturm bereits zwei Fahrzeuge zum Kentern gebracht hatte.
Xaver befand sich mit seinen Gefährten auf einem königlichen Schiff. Dieses war groß und schwer beladen und deswegen schwer zu lenken. Man hielt es daher für notwendig, es zu erleichtern. Schon wollte man die Kaufmannsgüter über Bord werfen, als Xaver den Kapitän um Aufschub bat. Weil aber die Matrosen sagten, der Sturm werde seine Stärke bis zum Abend verdoppeln, und man könne dann die Ladung nicht mehr bequem in das Meer werfen, beruhigte sie Xaver: Es bestehe kein Anlaß zur Sorge, das Meer werde sich beruhigen und vor Sonnenuntergang würden sie das Land erblicken.
Da der Kapitän von der Prophetengabe Xavers wußte, hielt er sich an seine Worte, und bald zeigte sich die Wahrheit der Voraussage. Das Meer wurde ruhig, und als die Sonne unterging, sahen sie das Land. Während sich alle freuten, weil man sich dem Hafen näherte, bemerkte man, daß Xaver traurig war und vor Schmerz seufzte. Als ihn einige nach der Ursache dafür fragten, sagte er ihnen, sie mögen für die Stadt Malakka beten, weil dort eine sehr ansteckende Krankheit ausgebrochen sei. Xaver hatte die Wahrheit gesprochen, denn die Krankheit schien der Anfang der Pest zu sein. Überall hatten die Menschen dort ein bösartiges Fieber, an dem auch die Kräftigsten in sehr kurzer Zeit starben. So sah es in Malakka aus, als das Schiff in den Hafen einlief. Noch niemals war den Einwohnern die Anwesenheit Xavers so erwünscht gewesen wie jetzt. Jeder versprach sich von ihm Trost für seine Seele und Linderung für seinen Leib, und niemand wurde in seiner Hoffnung enttäuscht.
Sobald Pater Xaver an Land gegangen war, besuchte er die Kranken und fand Gelegenheit genug, auf jede Weise Werke der Liebe zu verrichten. Alle wollten bei ihm beichten; man war der Meinung, daß jeder, der in den Armen Xavers sterbe, unfehlbar selig werden würde.
Xaver ging mit seinen Gefährten durch die Straßen der Stadt, um die Armen zu sammeln, die ohne Hilfe krank in den Straßen lagen. Er trug sie in die Spitäler und in das Kollegium der Gesellschaft Jesu, das bald das Aussehen eines Krankenhauses hatte. Und als alle Spitäler und das Kollegium mit Kranken voll belegt waren, ließ er aus dem Holz der Schiffe Hütten für die unglücklichen Kranken bauen. Er sorgte dann für Nahrung und Arzneimittel, die er von frommen Personen erbat. Tag und Nacht war er tätig. Es schien ein Wunder zu sein, daß Xaver und seine Gefährten immer gesund blieben, konnte doch niemand den Kranken dienen, den Sterbenden beistehen oder die Toten begraben, ohne sich anzustecken und zu sterben. Ein eindeutiges Wunder war aber die Auferweckung eines jungen Menschen vom Tode. Gott wirkte dieses Wunder durch Pater Xaver. Der junge Mann hieß Franz Ciavus und war der einzige Sohn einer frommen Frau, die seit langer Zeit unter der Leitung Xavers stand. Dieser junge Mann hatte, ohne an die Gefahr zu denken, das Eisen eines vergifteten Pfeils, wie sie die Orientalen dieses Landes haben, in den Mund genommen und war an diesem tödlichen Gift gestorben. Als man ihn begraben wollte, kam Xaver zufällig dazu. Er war von dem Wehklagen und den Tränen der Mutter so bewegt, daß er den Toten an der Hand nahm und ihn mit den Worten: "Franz, im Namen Jesu Christi steh auf!" wieder zum Leben erweckte. Der Auferweckte glaubte von diesem Augenblick an, ein so wunderbar zurückerhaltenes Leben Gott allein weihen zu müssen, und trat aus Dankbarkeit gegenüber Franz Xaver in die Gesellschaft Jesu ein.
Sobald Krankheit und Sterblichkeit aufgehört hatten, versuchte Xaver, mit dem Statthalter über die Ausführung des Vorhabens einer Gesandtschaft nach China zu unterhandeln. Bei der Rückkehr des Heiligen aus Japan hatte sich der Statthalter dem Plan Xavers günstig gezeigt. Aber zwei Eigenschaften, welche die vernünftigsten Ideen zunichte machen und die feierlichsten Versprechen in Vergessenheit geraten lassen, sind Neid und Eigeninteresse.
wird fortgesetzt
21. Juni
Ein Plädoyer für künstliche Dummheit
Am 19. Juni ist in der Tagespost eine neue Folge meiner Kolumne Fides et ratio erschienen.
21. Juni
Wie weit würdest du gehen, um ein Leben zu retten?
Am 8. August beginnt die diesjährige Pro-Life-Tour der Jugend für das Leben.
Sie startet in Innsbruck. Ziel ist Bregenz am 24. August.
Der Sinn der Pro-Life-Tour wird auf der Website folgendermaßen beschrieben:
„Jedes Jahr sterben allein in Österreich etwa 35.000 Babys durch Abtreibung, weil ihr Recht auf Leben nicht ausreichend geschützt wird. Weltweit sind es sogar über 70 Millionen, die noch vor der Geburt gewaltsam ihr Leben verlieren! Deswegen marschieren wir zu Fuß über 250 km von Innsbruck nach Bregenz, um eine gemeinsame Vision wahr werden zu lassen: Eine Gesellschaft, in der das Leben dieser Kinder geschützt ist, Frauen vollumfänglich unterstützt werden und sich Abtreibung erübrigt hat.“
Selbstverständlich besteht auch die Option, sich der Tour nur streckenweise anzuschließen.
Katholisch zu denken, heißt aber auch, sich nicht zu fürchten, in grundlegenden Dingen der gleichen Ansicht zu sein wie eine analphabetische Hirtin des fünfzehnten Jahrhunderts. Katholische Orthodoxie oder orthodoxe Katholizität ist einfach religiöse Normalität, welche die Kirche im Dorf stehen läßt. Katholisch ist das Vertrauen in den gesunden Menschenverstand, der, wenn wahrhaft gesund, ganz von selbst zu den Vorhöfen des Mysteriums gelangt. Häresie ist vielleicht eine bunte Hundehütte, Orthodoxie in katholischem Sinn jedoch ein Dom, der den ganzen Kosmos umfaßt, eingeschlossen das Universum des menschlichen Herzens und die selige Freiheit des Lebensspiels der Kinder Gottes. Dies ist die Botschaft des 1922 endgültig zur katholischen Kirche übergetretenen Engländers
Aus: Gerd-Klaus Kaltenbrunner, Abendland. Geheiligte Kultur, geliebte Heimat, herausgegeben von Michael K. Hageböck, Renovamen, S. 344 f.
Das Buch ist frisch im Renovamen-Verlag erschienen und enthält 34 bislang nicht als Buch edierte Texte sowie neun Nachdrucke des Philosophen und Publizisten Gerd-Klaus Kaltenbrunner. Unser Zitat ist dem Aufsatz über Chesterton entnommen. Andere Texte gehen über Vergil, Dante, Friedrich Schlegel, Görres, Guardini, Hugo Ball u.v.a.
21. Juni
Isaak Jogues
Vor 100 Jahren, am 21. Juni 1925, wurde der Indianermissionar Isaak Jogues (1607-1646) zusammen mit seinen Gefährten seliggesprochen. Die Heiligsprechung folgte 1930.
20. Juni
Sind Gottes Gebote eine Erpressung?
Zum zweiten Sonntag nach Pfingsten kann ich diese zwei Predigten anbieten:
Das Geheimnis der göttlichen Einladung
Das tägliche Gastmahl des Herrn
20. Juni
Verdunkelung des kirchlichen Zeugnisses
Von P. Engelbert Recktenwald
1995 erklärte der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Karl Lehmann zur Abtreibungsgesetzgebung in Deutschland: „Wir werden uns mit der bestehenden Gesetzgebung nicht abfinden. Für uns ist das Leben heilig, das geborene wie das ungeborene.“ 1999 beteuerte er dasselbe im Namen aller Bischöfe noch einmal: „Die deutschen Bischöfe haben stets erklärt – schon seit den 70er Jahren –, dass sie sich mit den nach ihrer Meinung unzureichenden Gesetzen nicht abfinden werden.“
Diese Zeiten sind vorbei. Der gegenwärtige Vorsitzende hat sich mit der geltenden Gesetzeslage nicht nur abgefunden, sondern lobt sie sogar: „Heute haben wir mit dem Paragrafen 218 als einen guten Kompromiss eine befriedete Situation.“ Dabei weiß er, dass jedes Jahr „in Deutschland rund 100.000 Schwangerschaften abgebrochen“ werden. „Das betrübt mich sehr.“
Trotzdem spricht er von einem „guten Kompromiss“. Worin besteht er? „Die Selbstbestimmung der Frau und der Lebensschutz für das ungeborene Kind sind Verfassungswerte. Wir können daher nicht das eine gegen das andere ausspielen.“ Also kein Wort davon, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass deshalb am Lebensrecht eines Menschen das Selbstbestimmungsrecht jedes anderen Menschen endet. Damit bleibt Bischof Bätzing sogar hinter der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts zurück, das ausdrücklich die Pflicht des Staates feststellte, das Leben des ungeborenenen Kindes sogar gegenüber der Mutter zu schützen. Wird der Staat dieser Pflicht gerecht, wenn jährlich 100.000 Kinder im Mutterleib getötet werden? Das sogenannte „Beratungsschutzkonzept“ hat sich schon längst als ein semantisches Trugwort herausgestellt, wie der renommierte Rechtswissenschaftler Herbert Tröndle 2007 feststellte. Es handele sich um „die de facto völlig schutzlose Preisgabe des Lebensrechts.“ 100.000 getötete Kinder – eine befriedete Situation?
Wer das Lebensrecht des ungeborenen Kindes einer Güterabwägung unterwirft, macht die Rede von dessen unantastbaren Würde zur Farce. Wenn es Fälle gibt, in dem das Lebensrecht des Ungeborenen hinter dem Selbstbestimmungsrecht der Mutter zurücktritt, dann gibt es tatsächlich auch ein Recht auf Abtreibung, und dann muss der Staat dieses Recht auch flächendeckend sicherstellen. Diese Konsequenz hat vor drei Jahren die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken gezogen: Sie sprach sich dafür aus, dass sichergestellt werde, dass die Tötung ungeborener Kinder („medizinischer Eingriff eines Schwangerschaftsabbruchs“ genannt) flächendeckend ermöglicht werde. Sie löste damit im deutschen Episkopat nicht etwa Entsetzen aus. Sie wurde nicht zum Widerruf oder gar zum Rücktritt aufgefordert. Stattdessen wurde sie vom Ständigen Rat der deutschen Bischofskonferenz zur Teilnehmerin an der europäischen Vorbereitungskonferenz der Weltsynode ernannt.
Johannes Paul II. warnte einst angesichts der Verstrickung der deutschen Kirche in die staatliche Abtreibungsregelung vor einer Verdunkelung des kirchlichen Zeugnisses. Er hat auf erschreckende Weise Recht behalten. Es ist dunkel geworden. „Wächter, wie lange noch dauert die Nacht?“
Dieser Text erschien zuerst am 15. Mai 2025 in der Tagespost. Sie können ihn auch hören.
19. Juni
Wie Gott die Fäden zog
Zum Fronleichnamsfest kann ich diese Predigt anbieten:
Die unerhörte Wahrheit.
19. Juni
Download-Freigabe 84
In den Standardeinstellungen von Soundcloud ist die Downloadmöglichkeit ausgeschlossen. Die Option existiert allerdings. Deshalb gebe ich nach und nach meine Predigten zum Download frei. Hier folgt die nächste Predigt:
Wie lädt man eine Predigt herunter? Klicken Sie auf den Button mit den drei Punkten, dann auf Datei herunterladen.
19. Juni
Jean de Brébeuf
Vor 400 Jahren, am 19. Juni 1625, kamen die ersten Kanadamissionare der Gesellschaft Jesu in Québec an. Sie wirkten unter den Huronen und den Irokesen. Der bekannteste unter ihnen ist der hl. Jean de Brébeuf (1593-1649). Mit ihm zusammen kamen Charles Lalemant, der erste Obere in Québec, und Énemond Massé. 1636 kamen Paul Ragueneau, Charles Garnier und der hl. Isaak Jogues dazu, 1639 Pierre Joseph Marie Chaumonot, 1658 Claude Allouez.
Im deutschsprachigen Bereich wird der Schriftsteller oder Historiker gesucht, der dieses ruhmvolle und berührende Kapitel der Missionsgeschichte beschreibt.
18. Juni
Autonomie braucht Moral II
Die auf dieser Seite unter dem Datum vom 5. Juni genannte Ausgabe der Zeitschrift "Wirtschaft und Ethik" ist als PDF öffentlich zugänglich. Folgen Sie dazu diesem Link. Das Interview mit mir finden Sie auf den Seiten fünf bis sieben.
18. Juni
Der Wert des Kreuzes
Vor 100 Jahren, am 18. Juni 1925, hatte die selige Dina Bélanger eine Vision über den Wert des Kreuzes. Sie schreibt darüber:
"Ich würde gerne allen Seelen (…) den Wert des Kreuzes verständlich machen. Der moralische oder physische Schmerz ist eine unermeßliche Goldgrube; er ist ein brennender Pfeil, den die Liebe vom Herzen des Unendlichen abschießt, um das menschliche Herz zu verzehren und es in die Gottheit einzutauchen. Das Kreuz! Es ist das blendende Szepter der inkarnierten Weisheit, der miterlösende Juwel der Unbefleckten Jungfrau, die leuchtende Palme der Seligen. Wenn wir wüßten, was für ein Maß an göttlicher Liebe jedes unserer Kreuze einschließt, würden wir diesen unendlichen Schatz so hochschätzen, daß wir Tag und Nacht nicht aufhören würden, Gott flehentlich um diesen Schatz zu bitten und für ihn übersprudelnd zu danken. Wenn wir den Wert unserer Kreuze verstünden, wären wir gelähmt vor Freude und Glück, sie zu empfangen; die Prüfungen, die Bedrängnisse, die Ängste aller Art würden uns zu Liedern des Jubels und der Begeisterung antreiben, und wir würden spontan das Te Deum anstimmen. Der Herr wird nicht verstanden! Nein, das Herz dieses anbetungswürdigen Bräutigams, das so zart und gut ist, wird nicht erkannt! Jesus hat das Kreuz erwählt als ein heiliges Gut. Er hat es mit Leidenschaft umarmt, Er hat es geliebt bis zur Torheit: und das für uns! Und wenn er uns ein Stückchen dieser geheimnisvollen Kostbarkeit anbietet, dann zögern wir, die Hand auszustrecken, zumindest zögern wir, es freudig zu tun. Ach! die gefallene menschliche Natur ist ein Abgrund von Finsternis. Gott weiß es; deshalb hat seine Barmherzigkeit stets Mitleid mit unserer Blindheit, und trotz unseres natürlichen Widerwillens bietet sie uns an und verpflichtet sie uns sogar, die unschätzbare Wohltat des Kreuzes anzunehmen. Oh! wie glücklich ist der göttliche Meister, ein anerkennendes Danke zu hören, wenn Er uns eine Dorne seiner Krone oder einige Tropfen seines bitteren Kelches anbietet! Wie sehr freut sich sein heiliges Herz, wenn eine verletzte und gekreuzigte Seele mit Liebe die Geißel, die Lanze und die kostbaren Nägel küßt! Oh! wenn wir die Gabe Gottes verstünden! Alle Leiden, alle Qualen, alle Martern würden meiner Seele süß erscheinen, um der zarten Vorsehung für den leichtesten Kummer zu danken. Wenn doch das Herz des Bräutigams wahrhaft erkannt würde! Oh Geist der Wahrheit, durch die Verdienste Jesu bitte ich dich, schenke den Seelen das Licht, lehre sie, die wahren Güter zu schätzen und die unendliche Güte anzuerkennen in den Stunden der Prüfung und der Demütigung."
18. Juni
Norbert Martin
Vor fünf Jahren, am 18. Juni 2020, starb im Alter von 83 Jahren der Soziologe Norbert Martin. Zusammen mit seiner Frau Renate war er seit 1981 Mitglied des Päpstlichen Rates für die Familie. Mit seiner profunden Kenntnis der „Theologie des Leibes“ und Treue zum Lehramt war er ein Außenseiter im deutschen Katholizismus.
17. Juni
Linke Sklavereiverherrlichung
Hier schlägt Brodkorb den Bogen zum Heute: Gönnerhaft wird Afrikanern die Wirkmacht abgesprochen. Zugleich gilt jede Kritik als koloniale Übergriffigkeit: Wer etwa moderne Sklaverei im Sudan anprangert, würde die Sudanesen ja wieder europäischen Maßstäben und damit dem kolonialen Joch unterwerfen! Statt sich also um den Freikauf afrikanischer Sklaven zu bemühen, sammeln Aktivisten lieber Geld, um einen im 19. Jahrhundert vom Kilimandscharo mitgebrachten Stein (!) dorthin zurückzubringen.
Aus: Anna Diouf, Mathias Brodkorb und sein Plädoyer gegen moralistische Hybris, auf TE vom 11. Mai 2025.
17. Juni
Nijole Sadunaite
Vor 50 Jahren, am 17. Juni 1975, wurde die christliche Dissidentin Nijole Sadunaite (1938-2024) vom Obersten Gericht der Litauischen Sowjetrepublik zu drei Jahren Lagerhaft und drei Jahren Verbannung verurteilt. In ihrem Schlusswort sagte sie: „Das ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Ich werde wegen der Chronik der Katholischen Kirche in Litauen verurteilt, die sich der geistigen und physischen Tyrannei entgegenstellt. Das bedeutet, dass man mich für die Wahrheit und die Liebe zu den Menschen verurteilt.“ 1989 sind in deutscher Übersetzung ihre Aufzeichnungen Geborgen im Schatten deiner Flügel erschienen.
16. Juni
Kathinfo-Orientierungsservice
Wo sind die Beiträge von der Startseite hingekommen?
Die Seite, auf der die Frage nach der intellektuellen Redlichkeit gestellt wird, wurde mit drei kritischen Beiträgen von Regina Einig, Peter Winnemöller und Bernhard Meuser bereichert. Das Youtube-Video mit meinem Vortrag über „Autonomie und Naturrecht bei Kant“ wurde auf der Wiederverzauberungsseite eingebettet. Vincent Ribetons FSSP Deutung der traditionellen Liturgie als Antwort auf die anthropologische Krise findet sich auf der Drobenseite, Ostritschs Kritik an Kants Banalisierung durch seine theologischen Nichtversteher auf der Seite mit Denekes Überwindung der Kluft.
16. Juni
Verherrlichung des Heiligsten Herzens Jesu
Der 16. Juni 1875, der zweihundertste Jahrestag der Erscheinung des Heiligsten Herzens Jesu an die hl. Maria Margareta Alacoque, war der Anlass einer ganzen Reihe von Akten der Verherrlichung des heiligsten Herzens.
Drei Beispiele seien herausgegriffen:
1. In Paris wurde der Grundstein zur Erbauung der Basilika Sacré-Coeur de Montmartre gelegt.
2. Der hl. Arnold Janssen und seine ersten Mitarbeiter im Blick auf die Gründung des Missionshauses in Steyl weihten sich dem Herzen Jesu.
3. König Karl VII. von Spanien weihte in Orduña (Vizcaya) sich, sein Heer und ganz Spanien dem Heiligsten Herzen Jesu. Außerdem wurde in den Provinzen und Städten die Herz-Jesu-Weihe nach dem Willen des Papstes Pius IX. durchgeführt.
15. Juni
Download-Freigabe 83
In den Standardeinstellungen von Soundcloud ist die Downloadmöglichkeit ausgeschlossen. Die Option existiert allerdings. Deshalb gebe ich nach und nach meine Predigten zum Download frei. Hier folgt die nächste Predigt:
Wie lädt man eine Predigt herunter? Klicken Sie auf den Button mit den drei Punkten, dann auf Datei herunterladen.
15. Juni
To bolster Faith in the Real Presence
Following the national Eucharistic Congress in the summer of 2024 in Indianapolis, the largest survey ever of laity was conducted to gather intelligence from lay Catholics as to what they believe ought to be done to bolster faith in the Real Presence. On issues potentially contributing to a loss of faith in the Real Presence, the first response was the distribution of Holy Communion in the hand.
(…) Permit me to offer three bits of fraternal correction.
(…) Second, since you pride yourself on being a “Francis bishop,” you might want to echo his famous retort, “Who am I to judge?”
Aus dem offenen Brief von Peter M.J. Stravinskas an Erzbischof Bruno Forte, auf CWR vom 29. April 2025.
Zum Thema: Spaemann über Handkommunion
15. Juni
Al Kresta
Vor einem Jahr, am 15. Juni 2024, starb in Michigan im Alter von 72 Jahren Al Kresta. Er war ein protestantischer Pastor, der 1992 katholisch wurde und das Ave Maria Radio gründete.
14. Juni
Was dir passiert, wenn du die falsche Meinung hast
Einen skandalösen Fall der Beschneidung von Meinungsfreiheit in Brüssel schildert Franziska Harter, die Chefredakteurin der Tagespost, auf dem Youtube-Kanal der Tagespost.
14. Juni
On the Day of Judgement
John Henry Newman says somewhere that his status as a prominent theologian didn’t make him holy, but it did make him more accountable on the Day of Judgement. All believers, great and humble alike, will someday stand before God and render an account of their lives. Imagine a pope, bishop, or priest – imagine anyone – standing before the Lord on the Day of Judgement. Imagine he invokes the fig-leaf words to cover the shame of his heresy and mastery over God’s Church: “Lord, I was a progressive Catholic! I was inclusive! People liked me!”
Aus: Jerry J. Pokorsky, The Fig-Leaf Vocabulary of Heresy, auf The Catholic Thing vom 6. Mai 2025.
14. Juni
Meinrad Eugster
Vor 100 Jahren, am 14. Juni 1925, starb in Einsiedeln im Alter von 76 Jahren Bruder Meinrad Eugster OSB. Am 23. Oktober 1960 wurde ihm im Verlauf des Seligsprechungsprozesses der heroische Tugendgrad anerkannt.
14. Juni
Bernadette Soubirous
Vor 100 Jahren, am 14. Juni 1925, wurde Bernadette Soubirous (1844-1879), die Seherin von Lourdes, seliggesprochen. Ihr Leichnam war unverwest. Die Heiligsprechung folgte am 8. Dezember 1933.
13. Juni
Herr, Vater und Bräutigam
Zum Dreifaltigkeitsfest kann ich diese vier Predigten anbieten:
Gott über uns, Gott mit uns, Gott in uns
Ist die Dreifaltigkeit eine nutzlose Wahrheit?
Der Heilige Geist, der Vollender
13. Juni
Faith has content
Second, faith has content. The disciples proclaim to Thomas a specific truth, the Resurrection. And Thomas makes this article of faith even more specific: “Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nail marks and put my hand into his side, I will not believe.” This is faith not only in the Resurrection but in the physical resurrection. We don’t believe in God in some vague or general way. We believe in a particular, specific God, Who has revealed Himself by word and deed, and is known by the articles of the Creed.
Aus: Paul D. Scalia, Faith and the Papacy, auf The Catholic Thing vom 27. April 2025.
Zum Thema: Das Gut des Glaubens
12. Juni
Populistische Kirche
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat 2019 eine Petition für ein Tempolimit von 130 km/h gestartet – beim Bundestag vorgebracht, unterstützt von Landeskirchen und Bistümern. Offenbar glaubt man, die Welt zu retten, indem man sie regelt. Hier verkehrt sich das Mandat der Kirche ins Gegenteil: Statt Orientierung zu geben, läuft sie politischen Themen hinterher – nicht mehr prophetisch, sondern populistisch. Der göttliche Auftrag schrumpft zur verkehrspolitischen Intervention.
Aus: Carl-Victor Wachs, Kreuzweg ohne Christus. Eine Berliner Karfreitagsprozession zeigt, dass Julia Klöckner recht hat, auf Communio am 24. April 2025.
12. Juni
Katholische Wahrheit und katholisches Dogma
Von Matthias Joseph Scheeben
18. Folge
434 Während der letzten Jahrhunderte sind unter dem Namen regula fidei, oder ähnlichen, verschiedene Werke erschienen, welche es sich zur Aufgabe machten, den streng dogmatischen Lehrstoff gegenüber den freien Meinungen auszusondern. Zuerst unternahm dies der Franzose Veronius im 17. Jahrhundert in seiner Regula fidei, um das Quantum von Lehren zu bestimmen, die man von den zur Kirche zurückkehrenden Protestanten fordern könne und müsse; etwas später der in Paris lebende Engländer Heinrich Holden in seiner Analysis fidei catholicae, und, auf den Schultern beider stehend, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts Chrismann in seiner Schrift: Regula fidei catholicae et collectio dogmatum credendorum. Alle drei Werke, besonders die beiden letzteren, leiden aber mehr oder minder stark an der minimistischen Tendenz; das letzte gehört auch einer sehr minimistischen Zeit, der Aufklärungsperiode, an (der Verfasser zitiert sogar, freilich bona fide, als einen Hauptgewährsmann den berüchtigten Aufklärer Blau) und wurde daher auch bei den minimistischen Bestrebungen der neueren Zeit stark ausgenützt. Vgl. über diese Schriften besonders Kleutgen (Theologie der Vorzeit, I. Bd, I. Abt. passim, besonders S. 141); über Christmann insbesondere [die Zeitschrift] Katholik 1869 I 266. Die beiden ersten Werke wurden in der Hermesischen Zeit von dem Hermesianer Braun in seiner Bibliotheca regularum fidei herausgegeben; alle drei bei Migne in Band I und VI seines Cursus theologiae.
Wird fortgesetzt.
11. Juni
Download-Freigabe 82
In den Standardeinstellungen von Soundcloud ist die Downloadmöglichkeit ausgeschlossen. Die Option existiert allerdings. Deshalb gebe ich nach und nach meine Predigten zum Download frei. Hier folgt die nächste Predigt:
Wie lädt man eine Predigt herunter? Klicken Sie auf den Button mit den drei Punkten, dann auf Datei herunterladen.
11. Juni
Hedwig Spiegel
Vor 100 Jahren, am 11. Juni 1925, am Fronleichnamsfest, lernte in Speyer die Jüdin Hedwig Spiegel (1900-1981) die hl. Edith Stein kennen, die selber erst am 1. Januar 1922 getauft worden war. Von dieser wird sie im katholischen Glauben unterrichtet, so dass sie sich am 1. August 1933 im Kölner Dom taufen lässt. Ihre Taufpatin wurde Edith Stein, die am 14. Oktober 1933 in den Kölner Karmel eintrat.
11. Juni
Helmut Gressung
Vor drei Jahren, am 11. Juni 2022, starb im Saarland im Alter von 103 Jahren der Priester Helmut Gressung. Er war tieffromm, marianisch und hielt noch in seinem letzten Lebensjahr jeden Tag eine Stunde eucharistische Anbetung. In seiner Jugend war er auf dem Saarbrücker Ludwigsgymnasium ein Schulkamerad und Gesinnungsfreund von Willi Graf.
10. Juni
Centralization
We can look at the effects of his actions, but Pope Francis never gave us a manifesto. For example, he took a number of measures to centralize the Church, weakening the powers of bishops to establish new religious communities, and to manage the celebration of the pre-Vatican II (“Traditional”) Latin Mass. He also created a vast bureaucracy of “synodality,” which channeled local questions to Rome, where the answers could be carefully stage-managed or else indefinitely postponed. He never made the case for centralism, however, insisting that he wanted local autonomy, while preventing conservative American bishops from making the Traditional Mass a major part of their pastoral strategy, liberal Brazilian bishops from creating deaconesses, and gay-friendly German bishops from authorizing liturgical texts for same-sex unions.
Aus: Joseph Shaw, Pope of Ambiguity, in: First Things am 23. April 2025
10. Juni
Andreas Avellino
Vor 400 Jahren, am 10. Juni 1625, wurde Andreas Avellino (1521-1608) seliggesprochen. Die Heiligsprechung folgte am 22. Mai 1712.
9. Juni
Monatsranking Mai 2025
| Platz | Monatsranking Mai 2025 Ausschnitt aus der Platzbelegung von über 793 Seiten |
Verän-derung ggü. dem Vormonat |
| 1 | + 1 | |
| 2 | + 1 | |
| 3 | + 2 | |
| 10 | - 6 | |
| 20 | - 13 | |
| 30 | + 16 | |
| 40 | neu | |
| 50 | - 32 | |
| 60 | + 14 | |
| 100 | + 67 | |
|
Letzter Platz: Eduard Kamenicky: Mea res agitur
|
||
8. Juni
Auftrag und Wahrheit
Soeben ist die 15. Ausgabe von Auftrag und Wahrheit, der Ökumenischen Quartalsschrift für Predigt, Liturgie und Theologie erschienen. Sie enthält wieder eine Predigt von mir, und zwar zum Fest des Heiligsten Herzens Jesu am 27. Juni. Die Zeitschrift kann in der Verlagsbuchhandlung Sabat bestellt werden.
8. Juni
Die Unermesslichkeit seiner Milde
Vor 100 Jahren, am 8. Juni 1925, hatte die selige Dina Bélanger eine Vision über die unendliche Liebe Gottes, über die sie in ihrem Tagebuch schrieb:
"Oh! Wie gut ist der Herr! Wie mild ist er! Welche Zärtlichkeit besitzt er! Wenn ich nur alle schüchternen und ängstlichen Seelen von der Unermeßlichkeit seiner Milde überzeugen könnte! Wenn ich bloß die armen Seelen, die ihrem Vater im Himmel mißtrauen, mit grenzenlosem Vertrauen einhüllen und durchdringen könnte! Die unendliche Barmherzigkeit betätigt sich in uns um so mehr, je mehr Elend sie in uns findet; wir bereiten Gott Freude, wenn wir ihm durch unsere Reue und unser Vertrauen Gelegenheit geben, seine Barmherzigkeit zu betätigen. Nichts verletzt sein väterliches Herz so sehr wie unser Mangel an Vertrauen. Und der Herr sucht Seelen, die Ihm mit Freude dienen. Die Dunkelheit wie das Licht, die Trostlosigkeit wie der Trost, die Bitterkeit wie die Süßigkeit, alles kommt aus seiner freigebigen Hand, oder besser es entspringt seinem Herzen wie ein Pfeil, der von Liebe entzündet ist. Unser Leben müßte eine ununterbrochene Danksagung sein, ein freudiges Vorspiel auf den Gesang des ewigen Lobpreises. Der göttliche Meister sucht freudige Seelen überall auf der Welt, aber Er will um so mehr alle geweihten Seelen, jene, die Er sich auserwählt hat, um Ihn zu trösten, Ihn kennen und lieben zu lehren, jene, die Er seine bevorzugten Bräute nennt. Oh! Jesus spricht zu jeder Seele im Frieden, im Schweigen, in der Zeit der Sammlung. Was will Er von uns?... Wir sollen zuhören... und treu sein... denn Er will unser Glück, sei es, daß Er uns einen bitteren Kelch darbietet oder einen berauschenden, eine Krone von Dornen oder von Rosen, ein schweres oder ein leichtes Kreuz. «Servite Domino in laetitia», ja, dienen wir dem Herrn in der Freude und im Jubel."
8. Juni
Robert Murray
Vor 100 Jahren, am 8. Juni 1925, wurde in Peking als Sohn kongregationalistischer Missionare Robert Murray geboren. Während seiner Studienzeit in Oxford lernte er Tolkien kennen und wurde katholisch. Er trat der Gesellschaft Jesu bei und empfing am 31. Juli 1959 die Priesterweihe. Bei seiner Primiz am folgenden Tag ministrierte Tolkien. Tolkiens Briefe an Murray sind wichtige Quellen zum Verständnis des Herrn der Ringe. Murray starb am 24. Mai 2018 in Boscombe.
7. Juni
Download-Freigabe 81
In den Standardeinstellungen von Soundcloud ist die Downloadmöglichkeit ausgeschlossen. Die Option existiert allerdings. Deshalb gebe ich nach und nach meine Predigten zum Download frei. Hier folgt die nächste Predigt:
Wie lädt man eine Predigt herunter? Klicken Sie auf den Button mit den drei Punkten, dann auf Datei herunterladen.
7. Juni
Maria Michaela Desmaisieres
Vor 100 Jahren, am 7. Juni 1925, wurde Maria Michaela Desmaisieres (1809-1865) seliggesprochen. Die Heiligsprechung folgte am 4. März 1934. Auf kath-info wird sie hier vorgestellt. Ihr Beichtvater war der hl. Antonius Maria Claret.
7. Juni
Matthäus Talbot
Vor 100 Jahren, am 7. Juni 1925, starb in Dublin im Alter von 69 Jahren Matt Talbot. Seine ergreifende Geschichte vom Alkoholiker zum vorbildlichen Christen findet sich auf kath-info. Sein Seligsprechungsprozess ist eingeleitet.
6. Juni
Bist du eine Wohnung Gottes?
Zum Pfingstfest kann ich diese drei Predigten anbieten:
Wir werden Wohnung bei ihm nehmen
Der Hl. Geist als Seele der Kirche
Du wirst das Angesicht der Erde erneuern
6. Juni
Hugo Dyson
Vor 50 Jahren, am 6. Juni 1975, starb in Oxford im Alter von 81 Jahren der Literaturwissenschaftler Hugo Dyson. Er gehörte zu den Inlings und hatte zusammen mit Tolkien entscheidenden Anteil an der Bekehrung von C. S. Lewis.
6. Juni
Iwashita Soichi
Vor 100 Jahren, am 6. Juni 1925, wurde der japanische Philosoph Iwashia Soichi (1889-1940) in Venedig von Kardinal Pietro La Fontaine (1860-1935) zum Priester geweiht. Als Schüler hatte er sich katholisch taufen lassen. Nach seiner Priesterweihe kehrte er nach Japan zurück und wurde eine der bedeutendsten katholischen Persönlichkeiten Japans in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Begegnung mit der Theologie des hl. John Henry Newman hatte seine Priesterberufung geweckt. In Japan kümmerte er sich aufopferungsvoll um Leprakranke und war als Theologe apostolisch tätig.
5. Juni
Autonomie braucht Moral
Prof. Dr. Christian Müller hat mich für die Zeitschrift "Wirtschaft und Ethik" über das Thema "Autonomie" interviewt. Das Interview ist nun online auf der Internetpräsenz der Gesellschaft für Wirtschaft und Ethik erschienen.
5. Juni
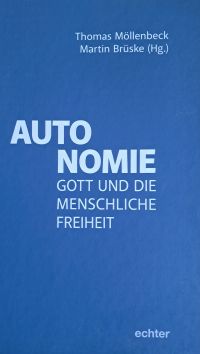 Gott und die menschliche Freiheit
Gott und die menschliche Freiheit
Ganz frisch ist im Echter-Verlag der Sammelband Autonomie. Gott und die menschliche Freiheit erschienen, herausgegeben von Thomas Möllenbeck und Martin Brüske.
Er enthält auf 308 Seiten dreizehn Aufsätze zum Thema, darunter meinen Vortrag Kants Autonomie im Strudel heutiger Theologie, den ich vor zwei Jahren in Münster auf dem Symposium "Freiheit von oder vor Gott?" gehalten habe.
Weitere Autoren sind Ludger Schwienhorst-Schönberger, Manuel Schlögl, Martin Brüske, Axel Schmidt, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Karl-Heinz Menke, Marco Haussmann, Dominikus Kraschl, Norbert Feinendegen, Helmut Müller, Andrzej Kucinski und Thomas Möllenbeck.
5. Juni
Alphonsus Rodriguez
Vor 200 Jahren, am 5. Juni 1825, wurde Alphonsus Rodriguez SJ (1531-1617) seliggesprochen. Die Heiligsprechung folgte am 6. September 1887. Als Witwer trat er in Valencia 1571 in die Gesellschaft Jesu ein, blieb dort sein Leben lang Laienbruder und übte seit 1580 bis viele Jahre lang die Aufgabe eines Klosterpförtners in Palma auf Mallorca aus, ähnlich wie der hl. Konrad von Parzham in Altötting.
Er war mystisch begnadet und sagte dem hl. Petrus Claver seine Zukunft als Missionar der afrikanischen Sklaven voraus.
Ein Teil der Aufzeichnungen seiner übernatürlichen Erkenntnisse wurden von Matthias Dietz SJ ins Deutsche übersetzt. Hier ein Ausschnitt:
„Die Erkenntnis der unendlichen Güte und Heiligkeit Gottes lehrt den Menschen, daß nur in Gott wahre Güte und Heiligkeit sein kann. In Gott ist die Fülle der Güte und Heiligkeit und jegliches Gut. In der Seele kann nichts Gutes sein, wenn Gott es nicht gibt. Gott wird deshalb das unendliche Gut genannt, weil er es wirklich ist; und weil er es ist, kann kein Geschöpf im Himmel und auf Erden von sich aus mehr Sein haben, als Gott ihm mitgeteilt hat. 'Niemand ist gut außer Gott allein', sagt der Herr selbst (Mk 10, 18). Das muß die Seele von Gott immer festhalten. Wenn Gott das Gute gibt, dann bleibt es seine Gabe, und was er schenkt, wird er wieder fordern; denn er gab es nur zu treuen Händen. Wenn die Seele einige Güter in ihrem Besitze erkennt, dann besitzt sie dieselben nicht, sondern Gott besitzt sie in ihr, und so soll sie alle Güter in Gott betrachten, denn ohne ihn bedeuten sie nichts.“
4. Juni
Maurus Wolter
Vor 200 Jahrenm, am 4. Juni 1825, wurde in Bonn Rudolf Wolter geboren. 1850 in Köln zum Priester geweiht, trat er 1856 in Rom in die Benediktiner-Abtei Sankt Paul vor den Mauern ein und erhielt den Namen Maurus. Am 29. September 1860 wurde er zusammen mit seinem Bruder Placidus Wolter (1828-1908) von Papst Pius IX. nach Deutschland gesandt mit den Worten: “Gehen Sie dorthin, wo Sie viele Novizen finden.” Sie gründeten das Kloster Beuron, das am 10. Februar 1863 kanonisch errichtet wurde. In seiner Spiritualität nahm es wichtige Anstöße von Dom Guéranger aus Solesmes auf. Maurus Wolter starb am 8. Juli 1890. Sein Nachfolger als Erzabt wurde sein Bruder Placidus.
4. Juni
John Kemble
Vor 400 Jahren, am 4. Juni 1625, kehrte John Kemble als Missionar in seine englische Heimat zurück. 1599 in Herefordshire geboren, wurde er am 23. Februar 1625 zum Priester geweiht, und zwar wegen der Katholikenverfolgung nicht in England, sondern in Douai. Als diese Verfolgung wegen der Titus-Oates-Verschwörung hysterische Ausmaße annahm, wurde er am 22. August 1679 zum Tode verurteilt – wegen des Verbrechens, katholischer Priester zu sein. 1929 wurde er selig-, 1970 heiliggesprochen.
4. Juni
Giovanni Gaetano Bottari
Vor 250 Jahren, am 4. Juni 1775, starb in Rom im Alter von 86 Jahren der Archäologe Giovanni Gaetano Bottari. Er war in Rom Professor der Kirchengeschichte und Bibliothekar der Vaticana.
3. Juni
Download-Freigabe 80
In den Standardeinstellungen von Soundcloud ist die Downloadmöglichkeit ausgeschlossen. Die Option existiert allerdings. Deshalb gebe ich nach und nach meine Predigten zum Download frei. Hier folgt die nächste Predigt:
Wie lädt man eine Predigt herunter? Klicken Sie auf den Button mit den drei Punkten, dann auf Datei herunterladen.
3. Juni
Franziskanische Entweltlichung
Franziskus forderte wie sein Vorgänger eine Entweltlichung der Kirche. Fast nirgends ist die Kirche derart verweltlicht wie in Deutschland. Manchmal erscheint die Kirche zwischen Flensburg und Traunstein wie ein Apparat, der Steuern erhebt, Immobilien verwaltet und den Glaubensverlust organisiert. Nichts war Franziskus mehr zuwider.
Aus: Alexander Kissler, Papst Franziskus hinterlässt ein zwiespältiges Erbe – doch in einem Punkt hatte er Recht.
3. Juni
Notre-Dame de la Sainte Espérance
Vor 10 Jahren, am 3. Juni 2015, wurde die Niederlassung der Petrusbruderschaft in Sainte-Cécile, Vendée, kanonisch errichtet, das Haus Notre-Dame de la Sainte Espérance. Der Petrusbruderschaft ist die Seelsorge an der dortigen Schule Institution L’Espérance anvertraut.
2. Juni
100.000 getötete Babys im Mutterleib
In den Neunziger Jahren erklärte der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Karl Lehmann, dass sich die deutschen Bischöfe niemals mit der bestehenden Gesetzgebung zur Abtreibung abfinden werden. Heute wird sie von Bischof Bätzing gelobt. Über diese traurige Entwicklung spreche ich in dieser Podcastfolge.
2. Juni
Kathinfo-Orientierungsservice
Wo sind die Beiträge von der Startseite hingekommen?
Die Rezensionen über mein Autonomiebuch habe ich auf einer eigenen Seite gesammelt. Meine Predigt über die Nacht, die alles verwandelt, habe ich auf der Seite des Lobpreisgottes eingebettet. Ostritschs Kritik an der Orientierungslosigkeit der Hirten findet sich auf der Herz-Jesu-Seite, Lennox‘ Theorie der Naturgesetze („Wer bewegt die Billardkugel?“) auf der Seite zur Wissenschaftstheorie.
1. Juni
Alles oder Nichts: Das Leben von Clare Crockett
Von Lara Ullmann
Zweiter Teil
Mit 15 erhielt sie ihren ersten Job beim bekannten britischen TV-Sender Channel 4. Mit 16 bekam sie Sendezeit auf Nickelodeon. Schnell hatte sie erreicht, wovon sie geträumt hatte: Geld, Ansehen, Erfolg. Doch war sie wirklich glücklich?
Ein Leben in der Welt – und ohne Gott
Clare liebte es zu feiern. Mit 14 besorgte sie sich einen gefälschten Ausweis, um in den Clubs von Derry zu tanzen. Das nötige Geld für Zigaretten und Alkohol verdiente sie sich als Tellerwäscherin in einem Café. Mehrere Tage pro Woche verbrachte sie betrunken in Bars und Clubs. Ein Tag ohne eine Packung Zigaretten war für sie unvorstellbar.
Sie lebte ein Leben, das von der Welt geprägt war – und ganz ohne Gott.
Doch dann kam der Anruf ihrer besten Freundin Sharon, der alles veränderte. Sharon hatte ein bereits bezahltes Flugticket nach Spanien, konnte aber wegen einer Blinddarmentzündung nicht reisen. Sie bot es Clare an.
Sofort dachte Clare an Ibiza – an Partys, Clubs und Bars am Strand – und sagte begeistert zu. Als sie das Ticket abholen wollte, traf sie jedoch auf eine völlig andere Realität: Sharons Haus war voller älterer Menschen und Ordensschwestern, die den Rosenkranz beteten. Sie war fassungslos.
Verwirrt fragte sie, ob wirklich alle mit nach Spanien fliegen würden. Als sie erfährt, dass es sich um eine Pilgerreise handelt, wollte sie umgehend absagen. Doch Sharon überzeugte sie: Das Ticket sei bereits bezahlt, und es wäre eine Verschwendung, nicht mitzukommen. Widerwillig willigte Clare ein.
Auf der Reise begegnete sie zwei jungen Frauen in langen Röcken. Sie konnte nicht anders, als sie zu fragen, warum sie sich so kleideten, keine Ohrringe trugen und ob sie denn in Pubs feiern dürften. Als eine der beiden ihre Berufungsgeschichte erzählte, war Clare überrascht: Konnte Gott wirklich so „gewöhnliche“ Menschen berufen?
Der Tag der Bekehrung
Doch noch hielt sie sich auf Distanz. Während die anderen beteten oder an Gesprächen über den Glauben teilnahmen, lag sie lieber in der Sonne oder rauchte. Sie entzog sich jeder Aktivität, die mit dem Glauben zu tun hatte – bis zum Karfreitag. An diesem Tag überrede sie ein irischer Pilger, wenigstens an diesem Tag in die Kirche zu gehen. Widerwillig setzte sie sich in die letzte Bank. Sie beobachtete, wie die Gläubigen sich anstellten, um die Füße Jesu am Kreuz zu küssen. Als sie schließlich an der Reihe war, tat sie es ebenfalls – und spürte plötzlich einen tiefen Schmerz in ihrem Herzen: keine Vision, kein himmlischer Chor. Nur die Gewissheit: Jesus ist für mich gestorben. Meine Sünden haben ihn ans Kreuz genagelt.
Tränen überströmten ihr Gesicht. Sie ging zurück zu ihrem Platz, unfähig, die Worte aus ihrem Kopf zu verbannen: „Ich habe Gott getötet.“ Gleichzeitig hörte sie eine andere Stimme: „Ich vergebe dir.“
In diesem Moment verstand sie: Zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie nichts mit einem Scherz überspielen. Das Einzige, was sie Jesus als Antwort geben konnte, war ihr eigenes Leben.
Es war der Anfang einer langen Reise – voller Kämpfe, Versuchungen und schließlich der völligen Hingabe an Gott.
Nach der Liturgie blieb Clare weinend in der Bank sitzen und wiederholte immer wieder die Worte: „Er ist für mich gestorben. Er liebt mich.“ Völlig aufgewühlt wandte sie sich an Vater Rafael, den leitenden Priester der Pilgerreise, und erzählte ihm von ihrer tiefen Erschütterung. Sie konnte nicht fassen, dass ihr niemand zuvor gesagt hatte, dass Jesus für sie gestorben war. Ihre bisherige Lebensvision, eine berühmte Schauspielerin zu werden, schien auf einmal nicht mehr sicher. Stattdessen fühlte sie sich auf unerklärliche Weise zu den Ordensfrauen hingezogen. „Kann man auch eine berühmte Ordensfrau werden?“, fragte sie Vater Rafael, ohne zu ahnen, wie wunderbar Gott diesen Wunsch noch erfüllen würde.
Vater Rafael sprach mit ihr über die Notwendigkeit von Demut und Gehorsam und lud sie ein, erneut nach Spanien zu kommen, um am Weltjugendtag mit den Schwestern teilzunehmen. Clare folgte dieser Einladung. Doch während der Pilgerreise verbrachte sie ihre Zeit lieber mit Freundinnen, redete über Stars und Mode und interessierte sich mehr für Souvenirs als für den Glauben. Aber je mehr sie sich von Gott ablenken wollte, desto lauter hörte sie Seine Stimme in ihrem Herzen. Er rief sie zu Gehorsam, Enthaltsamkeit und Armut: Enthaltsamkeit, indem sie sich von ihrem Freund trennte und sich ganz Gott hingab. Armut, indem sie ihre Träume von Ruhm, Reichtum und Popularität sowie ihre Laster wie das Rauchen aufgab. Gehorsam, indem sie ihren eigenen Willen verleugnete und sich vollständig dem Willen Gottes unterwarf.
Wird fortgesetzt
31. Mai
Christlicher Glaube als Gefahr
Nicht vor eingesickerten Islamisten, vor Serien-Messerstechern oder vor korruptionsanfälligem EU-Personal in Brüssel warnt aktuell die ARD: Es sind „die christlichen, die gläubigen Fußballspieler“, von denen Gefahr ausgehe, meint die ARD-Redakteurin. „Sie beten auf dem Platz, danken Gott. Manchen tragen sogar T-Shirts mit religiösen Aufschriften (…)“. So warnt die TV-Redakteurin in ihrem Video-Kommentar in der Tagesschau vor – oh, mein Gott – christlichen und gläubigen Fußballspielern. Und sie meint das auch absolut ernst, denn: Diese Sport-Stars würden nämlich auch missionieren und ihr „ultrakonservatives Weltbild“ unter die Menschen bringen wollen, ja sogar Kinder „in den Schulen“ damit behelligen.
Aus: Richard Schmitt, Zweierlei Maß. Gebühren-Rundfunk warnt vor christlichen Fußballspielern, auf TE vom 30. Mai 2025.
31. Mai
Das Zitat
Liebt die Unbefleckte, soviel ihr nur imstande seid! Schaut auf zu ihr und betet, besonders den kurzen Stoßseufzer 'Maria'!
Hl. P. Maximilian Kolbe
31. Mai
Download-Freigabe 79
In den Standardeinstellungen von Soundcloud ist die Downloadmöglichkeit ausgeschlossen. Die Option existiert allerdings. Deshalb gebe ich nach und nach meine Predigten zum Download frei. Hier folgt die nächste Predigt:
31. Mai
Johannes Vianney und Johannes Eudes
Vor 100 Jahren, am 31. Mai 1925, wurden der Pfarrer von Ars und Johannes Eudes (1601-1680) heiliggesprochen.
30. Mai
Dein Antlitz suche ich!
Zum Sonntag nach Christi Himmelfahrt kann ich diese sieben Predigten anbieten:
Das Zeugnis des Heiligen Geistes
Der Trost des Heiligen Geistes
Das Wunder von Sarwanyzja in der Ukraine
Maria, der Hl. Geist und die Geschlechtertheologie
30. Mai
Grundrecht oder Privileg?
Fast jede Mutter erkennt den bedingungslosen Wert ihres Kindes, wenn es erst einmal geboren ist. Die Kunst ist es, ihr liebevoll aufzuzeigen, dass es dasselbe Individuum ist, das schon in den ersten Wochen in ihr heranwächst. Dann kann deutlich werden: Ein Grundrecht auf Leben ist nur dann ein Grundrecht, wenn es einem Menschen bedingungslos zusteht. Ansonsten ist es ein Privileg. Das Recht auf Leben bildet zudem die Grundlage für die Inanspruchnahme aller weiteren Rechte. Also: ohne Recht auf Leben keiner körperliche Selbstbestimmung.
Sabina Scherer, Autorin des Buches Mehr als ein Zellhaufen, im Interview mit Bernhard Meuser, Vatican-Magazin Januar 2025, S. 12-16.
Zum Thema: Das Hörerleben des Ungeborenen
29. Mai
Zur Analyse des Subjektsbegriffs
Von Bronislaw Wladislaus Switalski
35. und letzte Folge
Ab uno te (Deus) aversus,
in multa evanui.
S. Aug. Conf. II 1.
Subjektivitat und Autonomie gegen einander abzuwägen und in das rechte Verhältnis zu einander zu setzen, bildete die eigentliche Aufgabe unserer Studie. Wenn wir hierbei unsere Aufmerksamkeit auf das Erkenntnisgebiet konzentrierten, obwohl an sich jede wertende Stellungnahme des Subjekts an diesem Problem beteiligt ist, so geschah es deshalb, um auf einem uns geläufigen Gebiete und zugleich, wie es uns scheint, an einem klassischen Beispiele die eigentümliche Problemverschlingung darzustellen und kritisch zu analysieren. Wir glauben nun nachgewiesen zu haben, dass die eigenartige Mittelstellung des empirischen Subjekts zwischen vorgefundener Naturgebundenheit und selbständiger Geistigkeit eine uneingeschrankte Gleichsetzung unserer im „Ich" sich kundtuenden Subjektivität mit der Autonomie verwehrt. Nur durch Selbstüberwindung d. h. durch Loslösung von allem empirisch Variablen in uns gelangen wir zur Erstarkung unserer Selbständigkeit, also zur allmahlich fortschreitenden Annäherung an das Ideal der Autonomie. (I.)
Diese Vollendung des eigenen „Selbst" wird aber dadurch erschwert, dass wir nicht bloß Beobachter, sondern Glieder des Wirklichkeilszusammenhanges sind. Im Wirken und Leiden haben wir zur Umwelt Stellung zu nehmen und in diesem Ringen mit ihr unsere Subjektsnatur zu entfalten. Die Variabilität der einzelnen Wirklichkeitsreihen, zu denen auch unsere Subjektivität im allgemeinen und unser Erkenntnisprozes im besonderen gehört, steigert die Komplikation unserer Erkenntnis, die eine allseitige, eindeutige Zuordnung ihrer selbst zu den übrigen Wirklichkeitsreihen anzustreben hat. Von dem Versinken im Strome des wirklichen Geschehens sucht sich nun das empirische Subjekt zu retten, indem es vermöge der in ihm erwachenden und erstarkenden Selbständigkeit (Autonomie) ein ideales Invariantensystem zum Behufe der Fixierung der einzelnen Reihen und ihrer Beziehung zu einander konstruiert. (II.)
Das Ideal des autonomen Subjekts mit dieser Struktur eines apriorischen, aller Erfahrung zu Grunde liegenden Invariantensystems reicht aber als solches nicht aus, um alle Rätsel des Erkenntnisproblems, die aus dem Gegensatz unserer Subjektivität zu den von uns unabhängigen Erkenntnisobjekten sich ergeben, zu beseitigen. Gerade die Beziehung unserer Erkenntnisse auf die Realität wie die einander vielfach durchkreuzende Verknüpfung des Idealen und Realen in uns und um uns hat uns zu der Überzeugung geführt, dass unser Streben nach Autonomie und zugleich nach allgemeingiltiger, sachlich bedingter Erfassung des Gegebenen nur deshalb realisierbar ist, weil das absolut autonome Subjekt nicht bloß ein von uns konstruiertes Ideal, sondern der aus sich seiende, Idealität und Realität, uns und die Umwelt in gleicher Weise schöpferisch begründende Gott ist. Für das empirische Subjekt ergab sich aus dieser Erkenntnis und der in ihr gesetzten Spannung zwischen dem empirischen und dem absoluten Subjekte erst die vollgiltige, unausgesetzt uns anregende und antreibende, ethisch religiöse Verpflichtung, aus der uns zersplitternden Vielheit des Erfahrungslebens zur Einheit einer in Gott begründeten Weltansicht vorzudringen und so unsere Wahrheitserkenntnis immer mehr vom Dunkel der Empirie zu befreien, indem wir auf sie das Licht der „Wahrheit an sich" wirken lassen. (III.)
Die Etappen dieses Vollendungsprozesses unserer Subjektivität und ihrer Umwandlung in die uns erreichbare Autonomie konnen wir zum Schlusse in die Formeln zusammenfassen: Selbstüberwindung zum Behufe der Selbstvollendung! Selbstentfaltung, nicht Selbstvernichtung! Selbstentfaltung durch Selbstbehauptung! Selbstbehauptung durch selbstgewollte Unterordnung unter das absolut autonome Subjekt! Selbstvollendung als Bürgschaft vollendeter Sachlichkeit!
Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas, et si animam mutabilem inveneris, transcende te ipsum! S. Aug. de ver. vel. 72.
27. Mai
Trost für Wüstenzeiten
Zum Fest Christi Himmelfahrt kann ich diese vier Predigten anbieten:
Mit unserem Geist im Himmel wohnen
27. Mai
Kolonialismus der Abtreibungslobby
Eins ist aber klar: die EZ nutzt vor allem drei Instrumente, um den Zugang zu Abtreibungen in Afrika generell sicherzustellen: Zum einen setzt sie Regierungen unter Druck, ihre Abtreibungsgesetze zu liberalisieren, zum anderen bietet sie „Unterstützung“ bei der Ausformulierung der Gesetze an und fördert zuletzt die Schulung von medizinischem Personal in der Durchführung von Abtreibungen (…) Dass die EU Afrika durch die Hintertür die Förderung von Abtreibungen aufzwingt, obwohl sich in den Ländern klar Widerstand dagegen formiert und damit keinerlei demokratische Legitimation für die Gesetzesänderungen besteht, zeigt, dass die Abtreibungslobby dem Kontinent keine Selbstbestimmung zugesteht, sondern vielmehr eine neue Art des Kolonialismus Einzug gefunden hat…
Aus: Veronika Wetzel, Europas Kulturkolonialismus, in: Lebensforum Nr. 153, 1/2025
Mehr über das Thema Abtreibung
26. Mai
Die Art und Weise, vertraulich mit Gott umzugehen
Vom hl. Alfons Maria von Liguori
38. Folge
Was die Heiligen gesagt und getan haben, bestätigt uns diese Wahrheit. Die heilige Theresia pflegte zu sagen: “Leiden oder sterben", die heilige Maria Magdalena von Pazzi hingegen: “Leiden und nicht sterben", und der heilige Johannes vom Kreuz rief aus: “Leiden und schweigen."
Die heiligen Märtyrer forderten selbst ihre Henker auf, sie zu peinigen, sie ermunterten die wilden Tiere, sie zu verschlingen. Die heilige Lidwina litt geduldig 33 Jahre lang eine peinliche Krankheit, die heilige Franziska ertrug freudig die ungerechte Verweisung ihres Gemahls und die Einziehung all ihrer Güter, und der heilige Johannes vom Kreuz ließ sich bereitwillig neun Monate lang einkerkern und litt während dieser Zeit die größten Peinen und Qualen.
Geduld, Geduld ist also ein sicheres und unfehlbares Zeichen, daß man Gott liebt; wenn man nämlich leidet, gerne alles leidet um Gottes willen.
wird fortgesetzt
26. Mai
Download-Freigabe 78
In den Standardeinstellungen von Soundcloud ist die Downloadmöglichkeit ausgeschlossen. Die Option existiert allerdings. Deshalb gebe ich nach und nach meine Predigten zum Download frei. Hier folgt die nächste Predigt:
25. Mai
Carolina von Droste-Vischering
Vor 150 Jahren, am 25. Mai 1875, starb in Hovestadt im Alter von 32 Jahren Prinzessin Carolina von Droste-Vischering. Sie war die Schwester des Vaters der seligen Maria Droste zu Vischering (1863-1899), die Papst Leo XIII. aufgrund der empfangenen Herz-Jesu-Offenbarungen dazu bewegte, die ganze Welt dem heiligsten Herzen Jesu zu weihen.
25. Mai
Kants Autonomie im Strudel heutiger Theologie
Vor zwei Jahren, am 25. Mai 2023, hielt ich auf dem Symposion der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster einen Vortrag über Kants Autonomiebegriff und dessen missbräuchlische Verwendung in den heutigen theologischen Versuchen, mit seiner Hilfe die Autorität des kirchlichen Lehramts auszuhebeln. Der Vortrag wurde gefilmt und ist hier auf Youtube veröffentlicht. Demnächst erscheinen die Vorträge des Symposions in Buchform.
25. Mai
Claude Henri Plantier
Vor 150 Jahren, am 25. Mai 1875, starb in Nîmes im Alter von 62 Jahren der Theologe Claude Henri Plantier. Er lehrte seit 1838 in Lyon Exegese und Hebräisch und wurde 1855 Bischof von Nîmes. Er „nahm in lebhafter Polemik Stellung zu den religiösen und kirchenpolitischen Zeitfragen durch Bekämpfung des Rationalismus, im besondern des Leben-Jesu-Werkes Renans“ (LThK, 1. Auflage).
24. Mai
Natur und Technik
In diesem Vortrag, den ich am UNESCO Tag der Philosophie auf einer Tagung in Hannover gehalten habe, erkläre ich auf den Spuren von Hartmut Rosa, Robert Spaemann und Joseph Ratzinger, wie überzogene Autonomieansprüche ein bereicherndes Resonanzverhältnis zur natürlichen Umwelt verunmöglichen.
24. Mai
Maria Magdalena Postel
Vor 100 Jahren, am 24. Mai 1925, wurde Maria Magdalena Postel (1756-1846) heiliggesprochen. Die Seligsprechung war 1908 erfolgt.
23. Mai
Das Gesetz der Freiheit
Zum fünften Sonntag nach Ostern kann ich diese drei Predigten anbieten:
23. Mai
Sanftes Zeugnis der Wahrheit
Dem Agnostizismus sollte man nicht durch billige Retorsionsargumente begegnen, sondern durch ein entsprechendes sanftes und starkes Zeugnis der Wahrheit – so in Recktenwalds Schlussbetrachtung (S. 201-210). Über Kant hinaus kommt Recktenwald zu einer ursprünglicheren und überzeugenderen Bestimmung dessen, was mit „Gott“ gemeint ist.
Aus der Rezension meines Autonomiebuches durch Franz Prosinger in der ökumenischen Quartalsschrift für Predigt, Liturgie und Theologie Auftrag und Wahrheit Nr. 12, S. 642-644. Weitere Rezensionen.
23. Mai
David Solomon
Vor einem Jahr, am 23. Mai 2024, konvertierte der Philosoph David Solomon zur katholischen Kirche.
22. Mai
Das freiwillige Sterben der Kirche
Die Publizistin Birgit Kelle diagnostiziert die Etablierung einer „willkürlichen neuen Moral“, die nichts mehr mit dem Glauben, mit dem Evangelium und mit „Antworten auf die Sinnfragen des Lebens“ zu tun habe: „Die katholische Kirche legt sich gerade zum freiwilligen Sterben hin.“ Die Analysen, die in diesem Band publiziert sind, zeigen das Elend der Theologie in Deutschland, aber auch den Status einer erschöpften Kirche, die wie eine NGO agiert, noch immer im steuerfinanzierten Wohlstand lebt und sich solche Debatten offenbar leisten kann.
Aus: Thorsten Paprotny, Das katholische Paralleluniversum. Es handelt sich um eine Rezension des Buches An den Früchten erkannt man den Baum. Der Synodale Weg als Scheideweg.
22. Mai
Download-Freigabe 77
In den Standardeinstellungen von Soundcloud ist die Downloadmöglichkeit ausgeschlossen. Die Option existiert allerdings. Deshalb gebe ich nach und nach meine Predigten zum Download frei. Hier folgt die nächste Predigt:
21. Mai
Mexikanische Heilige
Vor 25 Jahren, am 21. Mai 2000, wurden 27 Mexikaner heiliggesprochen.
Vier Heilige wollen wir herausgreifen:
José Isabel Flores Varela wurde am 28. November 1866 in der Erzdiözese Guadalajara geboren. Er wurde Pfarrer, bischöflicher Vermögensverwalter und Gründer einer Schwesterngemeinschaft. Als furchtloser Seelsorger fand er in der mexikanischen Katholikenverfolgung der Märtyrertod. Am 26. Juni 1927 wurde er ermordet, nachdem er von einem ehemaligen Seminaristen verraten worden war.
Julio Alvarez Mendoza wurde am 20. Dezember 1866 in Guadalajara geboren. 1894 zum Priester geweiht, wirkte er während der mexikanischen Katholikenverfolgung im Untergrund, wurde am 26. März 1927 gefasst und vier Tage später nach schlimmen Folterungen erschossen.
Mateo Correa wurde am 23. Juli 1866 in Tepechitlán geboren. 1893 zum Priester geweiht, war er es, von dem der hl. Miguel Pro (1891‑1927) die Erstkommunion empfing. Am 6. Februar 1927 starb er durch Kopfschuss als Märtyrer des Beichtgeheimnisses in der mexikanischen Katholikenverfolgung. Er wurde von General Ortiz erschossen, nachdem dieser ihm die Erlaubnis gegeben hatte, die Beichten der Cristeros entgegenzunehmen, und dann vergeblich versucht hatte, ihn zum Bruch des Beichtgeheimnisses zu verleiten.
Maria Venegas de La Torre wurde am 8. September 1868 geboren. Sie trat in die Kongregation der Dienerinnen des Herzens Jesu ein und widmete ihr ganzes Leben dem Dienst an den Kranken und Armen. Am 30. Juli 1959 starb sie in Guadalajara.
Die Seligsprechung aller vier Heiligen war am 22. November 1992 erfolgt.
21. Mai
Max Thürkauf
Vor 100 Jahren, am 21. Mai 1925, wurde in Basel der Naturwissenschaftler Max Thürkauf geboren. Katholisch getauft, verlor er bald den Glauben an Gott, hielt die naturwissenschaftliche Erkenntnis für die einzig mögliche und trat aus der Kirche aus. Sein Damaskuserlebnis war die Zündung der französischen Plutoniumbombe in der Sahara, deren Entwicklung durch die Gewinnung von schwerem Wasser möglich wurde. Thürkauf war der Miterfinder einer Anlage zur Gewinnung von schwerem Wasser. Ihm wurde klar, dass es keine wertfreie Wissenschaft gibt. Konsequentes Nachdenken führte ihn dann 1981 in die katholische Kirche zurück. Darüber schrieb er in seiner Autobiographie Das Fanal von Tschernobal:
“In meinem 56. Lebensjahr empfing ich aus der Hand dieses Priesters nach dreieinhalb Jahrzehnten zum ersten mal wieder das eucharistische Sakrament. Der Geschmack der Hostie versetzte mich in die Welt meiner Kindheit zurück, und die Sekunden standen still: Der Tag meiner Erstkommunion wurde Gegenwart, die Zeit versank im Meer der Ewigkeit. Ich dankte meinen verstorbenen Eltern für meine Erziehung und bat sie um Verzeihung für den Hochmut meiner Jugend und die Schmerzen, die ich ihnen durch diese Sünde bereitet hatte. Das Geheimnis der Gnade ist unergründlich, aber sie wird allen gewährt, die sich um Gott bemühen.”
Max Thürkauf starb am 26. Dezember 1993 in Weil am Rhein.
Darüber, wie ein Student durch einen Vortrag Thürkaufs zum Glauben kam, berichtete letztes Jahr P. Bernward Deneke.
19. Mai
Dominik Kalata
Vor 100 Jahren, am 19. Mai 1925, wurde im polnischen Nowa Biala Dominik Kalata SJ geboren. 1951 wurde er zum Priester, am 9. September 1955 von Jan Chryzostom Korec SJ zum Bischof geweiht, und zwar aufgrund der kommunistischen Verfolgung geheim. Alle Diözesanbischöfe der Tschechoslowakei waren damals inhaftiert oder unter ständiger Bewachung. Nach vielen Jahren der Verfolgung, Inhaftierung und Zwangsarbeit konnte er 1969 nach Österreich ausreisen. Von 1976 bis 2009 lebte und wirkte er in der Erzdiözese Freiburg. Er starb am 24. August 2018 in Ivanka pri Dunaji, Slowakei.
19. Mai
Ippolito Marracci
Vor 350 Jahren, am 19. Mai 1675, starb in Rom im Alter von 71 Jahren der Theologe Ippolito Marracci. Er war ein "hervorragender Marilog" und "Mitglied der Kongregation der regul. Kleriker Marias" (LThK, 1. Auflage). Sein Bruder Luigi (1612-1700) war Beichtvater des Papstes Innozenz XI.
18. Mai
Download-Freigabe 76
In den Standardeinstellungen von Soundcloud ist die Downloadmöglichkeit ausgeschlossen. Die Option existiert allerdings. Deshalb gebe ich nach und nach meine Predigten zum Download frei. Hier folgt die nächste Predigt:
18. Mai
Kathinfo-Orientierungsservice
Wo sind die Beiträge von der Startseite hingekommen?
Meinen Podcast Seliges Erkanntwerden habe ich auf Seiferts Gottesbeweisseite eingebettet. Oehlers Bericht „Wie es beim Synodalen Weg zuging“ findet sich auf der Glaubensgutseite, die Pressemitteilung „Synodaler Weg entlarvt“ auf der Seite meines Artikels über den Zusammenhang zwischen Missbrauch und Mainstream der deutschen Moraltheologie, Jeffrey Kirbys Bekenntnis „I’m an African“ auf der Jugendseite.
18. Mai
Jacques Marquette
Vor 350 Jahren, am 18. Mai 1675, starb in der Nähe des heutigen Ludington am Michigansee im Alter von 37 Jahren der Indianermissionar Jacques Marquette SJ. Er stammte aus Laon und wirkte unter den Huronen in Trois-Rivières, Sault Ste Marie und St-Esprit, später unter den Miamis. Er „nahm 1673 teil an der Joliet-Expedition, die als erste den Mississippi, vom Wisconsin bis zum Einfluß des Arkansas, befuhr und seine Ausmündung in den Golf von Mexiko feststellte“ (LThK, 1. Auflage).
17. Mai
Gerettet!
Zum vierten Sonntag nach Ostern kann ich diese zwei Predigten anbieten:
17. Mai
Die Kapitulation der deutschen Kirche
Am 15. Mai ist in der Tagespost wieder meine Kolumne Fides et ratio erschienen. Dieses Mal beschäftige ich mich mit der Verdunkelung des kirchlichen Zeugnisses für das Lebensrecht der ungeborenen Kindern.
17. Mai
Therese von Lisieux
Vor 100 Jahren, am 17. Mai 1925, wurde Therese vom Kinde Jesu (1873-1897) heiliggesprochen. Ein besonderes Anliegen war ihr die Heiligung der Priester.
11. Mai
Mein philosophisches Bekenntnis
In der neuen Podcast-Folge erkläre ich, wie sich für mich der Gottesbegriff vom Problem zur Lösung verwandelte.
11. Mai
Kritik und Klärung
Hartmut Sommers Rezension meines Autonomiebuches ist jetzt auch auf dem LiteraturBlog des Eulenfischs erschienen.
11. Mai
Maria Angela Truszkowska
Vor 200 Jahren, am 16. Mai 1825, wurde im polnischen Kalisz Maria Angela Truszkowska geboren. Sie gründete die Kongregation der Schwestern vom hl. Felix von Cantalice. Mit 44 Jahren wurde sie taub und lebte seitdem in völliger Abgeschiedenheit. Am 10. Oktober 1899 starb sie in Krakau, am 18. April 1993 wurde sie seliggesprochen.
11. Mai
Charles de Foucauld und Devasahayam Pillai
Vor drei Jahren, am 15. Mai 2022, wurde Charles de Foucauld (1858-1916 heiliggesprochen, ebenso Devasahayam Pillai (1712-1752). Charles de Foucauld wird auf kath-info hier vorgestellt. Von seinen wunderschönen Texten haben wir auf kath-info ein paar Auszüge veröffentlicht: über das Gebet, über den Glauben, die Geburt Jesu.
Devasahayam Pillai war ein hinduistischer Hofbeamter des Raja von Travancore, wurde 1745 katholisch und deshalb seit 1749 verfolgt. Schließlich erlitt er nach schweren Folterungen den Märtyrertod.
Themen
EngelEnglandreise
Entmytholog.
Entweltlichung
Erbsünde
Erlösung
Erneuerung
Evangelien
Evangelisierung
Evangelisierung II
Evangelium
Evolution
Exegese
Exerzitien
Exkommunikation
Falschlehrer
Familie
Familiensynode
Fasten
Fasten aus Liebe
Fegefeuer
Fellay B.
Felix culpa
Feminismus
Feuerwehr
Fiducia supplicans
Fis
Flüchtlinge
Frau
Frauen
Frauendiakonat
Freiheit
Freiheit christl.
Freiheit u. Gnade
Fremde Sünden
Freundschaft
Frömmigkeit
FSSP
FSSP II
FSSPX
Führungsversagen
Fundamentalismus
Gebet
Geburt Jesu
Gehsteigberatung
Geistbraus
geistliches Leben
Gender
Genderideologie
Genderkritik
Gender Mainstr.
Generalkapitel 06
Geschlecht
Glaube
Glauben
Glaubensjahr
Glaubensregel
Glaubensschild
Glossen
Gnadenstuhl
Gnadenvorschuss
Goa
Goertz Stephan
Gold
Gott
Gott II
Gottesbegegnung
Gottes Größe
Gottesknecht
Gotteskrise
Gottesvergiftung
Grabeskirche
Gretchenfrage
Guadalupe